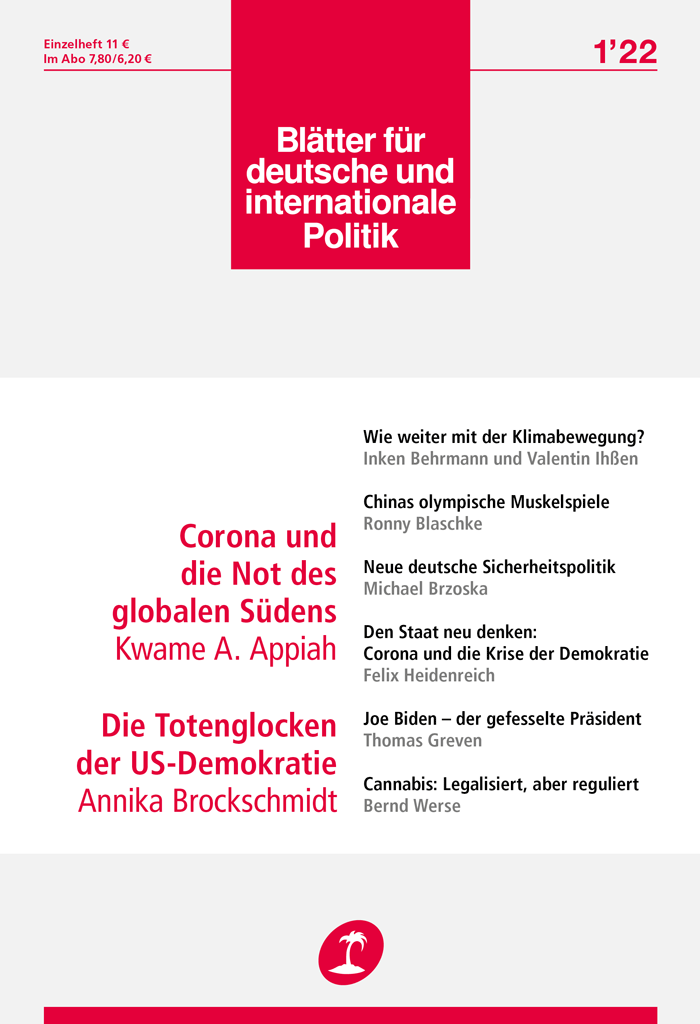Bild: Ein Student erhält den Impfstoff gegen Covid-19 im Hospital de La Paz in Madrid, 7.7.2021 (IMAGO / Lagencia)
Die neue Coronavirus-Variante Omikron hat inzwischen auch Südeuropa erreicht. Die Nachrichten über Infektionen mit B 1.1.529, auch von Doppelt-Geimpften, dämpfen die Euphorie, die in Spanien und Portugal noch bis vor kurzem herrschte. Tatsächlich glaubte man dort, das Schlimmste der Pandemie definitiv hinter sich gelassen zu haben – dank gut organisierter und von breiten Teilen der Gesellschaft getragener Impfkampagnen.
Allen berechtigten Sorgen über die neue Variante zum Trotz: Der Fakt, dass Portugal und Spanien seit Wochen das EU-Impfranking anführen, erfüllt die dortigen Epidemiologen und Gesundheitspolitiker immer noch mit Stolz. In Spanien waren Anfang Dezember gut 89 Prozent der Über-Zwölfjährigen doppelt geimpft, rund 91 Prozent hatten zumindest eine Dosis erhalten.[1] Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung hatten fast 80 Prozent mindestens zwei Impfdosen erhalten, im Nachbarland Portugal waren es sogar 86 Prozent. Impfgegner spielen in beiden Gesellschaften kaum eine Rolle. Zu ihren wenigen Protestkundgebungen kamen meist nicht mehr als ein paar Dutzend Menschen. Kein Wunder, dass gerade Länder wie Deutschland mit Staunen gen Süden blicken: Wie haben die das geschafft?
Offensichtlich spielen dabei traumatische Erfahrungen in der Coronakrise eine Rolle, die das Bewusstsein für die Gefährlichkeit des Virus verstärkt haben: Spanien wurde von der ersten, zu spät erkannten Pandemiewelle geradezu überrollt. Im März und April 2020 versuchte dort das Pflegepersonal, oft ohne ausreichende Schutzkleidung, den Ansturm in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen zu bewältigen. Bilder von überfüllten Leichenhallen oder von Altersheimen, in denen Tote tagelang in ihren Betten lagen, schockierten die Öffentlichkeit. Portugal dagegen erwischte im vergangenen Winter die Delta-Variante mit voller Wucht. Rettungswagen standen Schlange vor den Krankenhäusern, Tausende starben.
Doch fragt man Epidemiologen nach den Gründen für den Erfolg der Impfkampagnen, verweisen sie als erstes auf andere Faktoren: die steuerfinanzierten, staatlichen Gesundheitssysteme in beiden Ländern sowie die tief verwurzelte Impfkultur.
Impfen als Ausdruck von Modernität
Für diese Kultur gibt es in Portugal und Spanien ähnliche historische Gründe. So hatte in Spanien Diktator Francisco Franco die Schutzimpfungen gegen Poliomyelitis (Kinderlähmung) vernachlässigt, an der zwischen 1950 und 1963 mehr als 20 000 Menschen erkrankten. Unter seiner Herrschaft gab es nur wenige Schluckimpfungen, bei denen es sich um propagandistische Maßnahmen handelte. Erst nach dem Tod des Diktators gelang es Ende der 1970er Jahre, dank einer staatlich organisierten Impfkampagne der Epidemie Einhalt zu gebieten. Auch in Portugal fiel die erfolgreiche Bekämpfung von Kinderlähmung und Masern in die Zeit unmittelbar nach der Salazar-Diktatur, die von 1932 bis 1974 herrschte.
Impfkampagnen avancierten so in beiden südeuropäischen Ländern zum Ausdruck von Modernität. Während in anderen europäischen Ländern impfskeptische Bewegungen aufkamen, wuchs in den jungen Demokratien auf der iberischen Halbinsel das Vertrauen in die Schulmedizin. Heute sind in Spanien und Portugal über 95 Prozent aller Kinder und Jugendlichen gegen Kinderlähmung, Meningitis oder Hepatitis geimpft – Höchstwerte in der Europäischen Union. Auch für Erwachsene gibt es Kalender mit empfohlenen, kostenlosen Immunisierungen.
„Alleine während der jährlichen Grippeimpfungen verabreichen wir in zwei Wochen Millionen Dosen“, sagt Amos García, Präsident der spanischen Gesellschaft für Immunologie. „Das hat für die Pandemie geschult.“ Das Personal für solche Impfkampagnen ist vorhanden: In Spanien wie in Portugal ist Krankenpflege ein vierjähriges Universitätsstudium und der Aufgabenbereich von Pflegerinnen und Pflegern ist sehr viel breiter gefasst als in Deutschland – sie übernehmen viele Aufgaben, für die hierzulande allein Ärzte zuständig sind. Zudem setzen Spanien wie Portugal bei der Verabreichung der Covid-19-Vakzine auf eine strikte Priorisierung nach Altersgruppen: Auch das ist eine Lektion aus den jahrzehntelangen Erfahrungen mit landesweiten Impfkampagnen.
Schützenhilfe vom Militär
Auch wenn sich die Voraussetzungen in Spanien und Portugal ähneln, unterscheiden sich die Kampagnen in der Methodik. Dabei baut Spanien vor allem auf digitale Hilfsmittel. Schon lange hat das südeuropäische Land das E-Government als Instrument der Verwaltung entdeckt. Und in den ersten drei Strategieplänen zur Digitalisierung zwischen 2000 und 2013 war das Gesundheitswesen von Anfang an berücksichtigt.
Heute werden in den für Gesundheit zuständigen 17 autonomen Regionen die Patientenakten von den behandelnden Gesundheitszentren elektronisch erfasst. Dann wird ein gesetzlich festgelegter Mindestdatensatz extrahiert und an die nationalen Behörden weitergegeben. Dieses Grundwissen ist hilfreich bei der Organisation der Covid-19-Impfungen: Die Behörden wissen so nicht nur genau, wie viele Vakzine sie wohin schicken müssen, sondern auch, wie und wo sie die Impfkandidatinnen und -kandidaten erreichen. Im Gegensatz zu Deutschland muss sich in Spanien niemand selbst um seinen Termin bemühen. Ort und Uhrzeit werden per SMS, Anruf oder Brief mitgeteilt. Und seit nach ersten europaweiten Anlaufschwierigkeiten ausreichend Vakzine zur Verfügung stehen, können sich Interessierte des jeweiligen Altersabschnitts via App auch selbst aktiv um Termine kümmern.
Statt auf smarte Technologien setzt man im Nachbarland Portugal auf militärische Effizienz. In Kooperation mit den nationalen Gesundheitsbehörden übernahm dort im Februar 2021 Marine-Admiral Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo die Impfkampagne. Er ließ Impfstraßen in Stadien errichten und diese von Soldaten auf Effizienz und Schnelligkeit prüfen. Polizei und lokale Verwaltungen wurden in die Organisation eingebunden. Doch für den Erfolg der Kampagne war nicht nur die militärisch inspirierte Logistik wichtig. Sondern Gouveia e Melo hielt obendrein Distanz zur Politik und machte so vorangegangene Querelen vergessen: Kurz vor seiner Berufung war der Koordinator des nationalen Impfplans zurückgetreten, weil sich Funktionsträger bei der Impfreihenfolge vorgedrängelt hatten. Diese Distanz stärkte das Vertrauen.
Dabei war auch in Südeuropa die Skepsis gegenüber mRNA-Impfstoffen zunächst groß, vor allem in Spanien. Noch im Oktober 2020 wollten sich laut einer internationalen Befragung des Marktforschungsinstituts Ipsos lediglich 64 Prozent der Spanierinnen und Spanier impfen lassen. Europaweit waren es nur in Frankreich weniger. Besonders groß war der Widerstand gegen eine „sofortige Impfung“. In Spanien hätten sich damals nur 13, in Frankreich nur 12 Prozent impfen lassen.[2] Doch mit Beginn der Impfkampagne wandelte sich die Stimmung rapide.
„Wir konnten an den sinkenden Totenzahlen jeden Tag ablesen, dass die Impfungen funktionieren“, sagt der Epidemiologe Manuel Franco, der an der Johns-Hopkins-Universität und an der Universidad de Alcalá lehrt. Für den Forscher war das ein willkommener Nebeneffekt der strikten Alterspriorisierung: „Am empfindlichsten dem Virus ausgesetzt sind nun einmal die Älteren.“
Solidarität und Familiensinn
Während in anderen Ländern im Laufe der Kampagnen immer wieder auch über eine Impfung nach Berufsgruppen diskutiert wurde, hielten Spanien und Portugal am Alter als übergeordnetem Kriterium fest.[3] In Frage gestellt hat das kaum jemand. Debatten über Impfungen für Beschäftigte im Tourismussektor blieben, trotz dessen großer wirtschaftlicher Bedeutung, eine Randerscheinung. „Die Älteren als Schwächste zuerst zu schützen, war für viele eine Selbstverständlichkeit“, sagt Manuel Franco. „Im katholisch geprägten Südeuropa hat Familie einen hohen Stellenwert, der Kontakt zu Eltern und Großeltern ist sehr viel enger als in Mittel- oder Nordeuropa.“
Solche geteilten gesellschaftlichen Werte seien für den Erfolg von Impfkampagnen ebenso wichtig wie eine gute Organisation, glaubt Franco, der in Spanien und Deutschland studiert hat und beide Länder gut kennt. „Deutschland ist sehr viel individualistischer als Spanien. In Spanien neigen wir eher dazu, Autoritäten zu vertrauen. Wir tun das, was man uns sagt, im Guten wie im Schlechten.“ Beim pandemiebedingten Gesundheitsnotstand gereichte das Spanien zum Vorteil: Weder die strenge Maskenpflicht, die teils auch unter freiem Himmel galt, noch die Impfaufrufe sorgten für gesellschaftliche Zerwürfnisse.[4]
Auch in Portugal blieb die Unterstützung für die Corona-Schutzmaßnahmen durchgehend hoch, auch während des strikten Lockdowns im Frühjahr 2020 – und das, obwohl die Infektions- und Todeszahlen im Gegensatz zum Nachbarland zunächst niedrig ausfielen. Verwaltungsminister Eduardo Cabrita lobte die Bevölkerung denn auch für ihren „unübertrefflichen Bürgersinn“.[5] Diese Mentalität prägt auch die Haltung zur Corona-Impfung: In einer Eurobarometer-Umfrage bezeichnen 80 Prozent der Portugiesinnen und Portugiesen diese als „Bürgerpflicht“.
In den individualistischeren Gesellschaften Mittel- und Nordeuropas werden die von Manuel Franco skizzierten Überzeugungen zuweilen als Autoritätsgläubigkeit abgetan und mit den südeuropäischen Diktaturerfahrungen erklärt. Tatsächlich aber haben diese Haltungen, zumindest was die gesundheitspolitischen Aspekte betrifft, mehr mit der Funktionsweise der Gesundheitssysteme zu tun als mit der jüngsten Geschichte.
In Deutschland seien Eigenverantwortung und Effizienz über das System der Krankenkassen auch in der Gesundheitsversorgung verankert, betont Franco. Dagegen richte sich das steuerfinanzierte spanische System mit einer Abdeckung von 98,9 Prozent der Bevölkerung ans Kollektiv. Wie auch in Portugal sind Gesundheitszentren, in denen Allgemeinmediziner und Fachärzte unter einem Dach arbeiten, erster Ansprechpartner im Krankheitsfall. Die Behandlung ist in Spanien kostenlos, in Portugal wird für die Nutzung der Gesundheitszentren eine kleine Pauschalgebühr fällig. „Es ist etwas völlig anderes, ob ich mich bei einem niedergelassenen Arzt behandeln lasse, der eine Praxis in einem Einfamilienhaus in Pankow hat, oder ob ich in ein Gesundheitszentrum gehe, wo andere Patienten, Ärzte und Pfleger um mich herumwuseln. Dort erlebe ich unmittelbar, dass Gesundheit wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist.“, stellt Franco fest.
Zwar haben die Kürzungen während der Finanzkrise, damals eine Auflage unter dem Vorzeichen der europäischen Austeritätspolitik, das System personell und qualitativ geschwächt,[6] seine Kernaufgaben erfülle es aber immer noch vorbildlich.
Dieses Zusammenspiel aus historischen, gesellschaftlichen und gesundheitspolitischen Faktoren erklärt, warum Impfgegnerinnen und -gegner in Spanien und Portugal kaum Fuß fassen konnten. Laut dem spanischen Gesundheitsministerium hat bisher weniger als ein Prozent der Bevölkerung die Impfung verweigert. Und selbst unter ihnen leugnet nur ein verschwindend geringer Teil die Krankheit selbst.
Isolierte Impfgegner
In Spanien ist der gesellschaftliche Rückhalt für Coronaleugner so gering, dass sogar die rechtsextreme Vox, ganz im Gegensatz zur deutschen AfD, von einer Instrumentalisierung der Pandemie abgerückt ist. Die von ihr betriebenen Proteste richteten sich zunächst gegen die Corona-Auflagen der Regierung, nicht aber gegen die Impfkampagne. Als Parteichef Santiago Abascal in einem Hörfunk-Interview im September 2021 nicht sagen wollte, ob er geimpft sei, bezeichnete der Moderator des parteinahen Senders „Es Radio“ den Politiker als „unverantwortlich“; auch in den sozialen Netzwerken empörten sich Sympathisanten. So ist die Impfkampagne wohl eine der wenigen Themen der polarisierten spanischen Politik, die sich der Dynamik des Schlagabtauschs entzieht. Auch das beweist ihren Erfolg.
In Portugal wiederum begegnete man den wenigen Skeptikerinnen und Skeptikern entschieden. Als dort Impfgegner ein Impfzentrum blockierten, trat „Impf-General“ Gouveia e Melo ihnen in Uniform entgegen. Im Oktober wurde ein Richter wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen vom Dienst suspendiert.[7] Auch wenn nicht alle dieses autoritäre Vorgehen gutheißen, illustriert der ausbleibende Protest dagegen doch gut, wie isoliert die wenigen Impfgegner sind – und wie erfolgreich die offiziellen Anti-Coronamaßnahmen.
[1] Die Daten zur Impfkampagne werden vom Gesundheitsministerium alle drei Tage unter www.mscbs.gob.es aktualisiert.
[2] Vgl. España, el segundo país europeo con menos predisposición para vacunarse ahora de la Covid-19, www.ipsos.com, 10.11.2020.
[3] Parallel dazu wurden systemrelevante Gruppen wie Gesundheitspersonal, Polizeibeamte und Feuerwehrleute geimpft.
[4] Bei einer Befragung der Spanischen Stiftung für Wissenschaft und Technologie FECYT im Februar 2021 gaben rund 95 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, der Maskenpflicht „vollständig“ zu folgen. Im Frühjahr 2020 bescheinigte das britische Meinungsforschungsinstitut YouGov Spanien ebenfalls die europaweit größte Disziplin bei der Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.
[5] Der Minister bezog sich damals auf die geringe Mobilität während des Osterwochenendes 2020. Vgl. Matthew Holroyd und Rosie Wright, ¿Por qué Portugal ha sufrido menos el impacto del coronavirus que su vecina España?, www.es.euronews.com, 14.7.2020.
[6] So haben sich die Wartezeiten für fachärztliche Behandlungen verlängert und Regionen wie Madrid leiden immer noch unter den Folgen eines vorübergehenden Einstellungsstopps.
[7] Rui Fonseca e Castro hatte zuvor eine Anhörung abgebrochen, nachdem ein Staatsanwalt sich weigerte, den Mund-Nasen-Schutz abzunehmen. Zudem hatte er in Videos öffentlich gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Vgl. Tereixa Constenla, Los magistrados portugueses expulsan de la carrera a un juez negacionista del coronavirus, www.elpais.com, 7.10.2021.