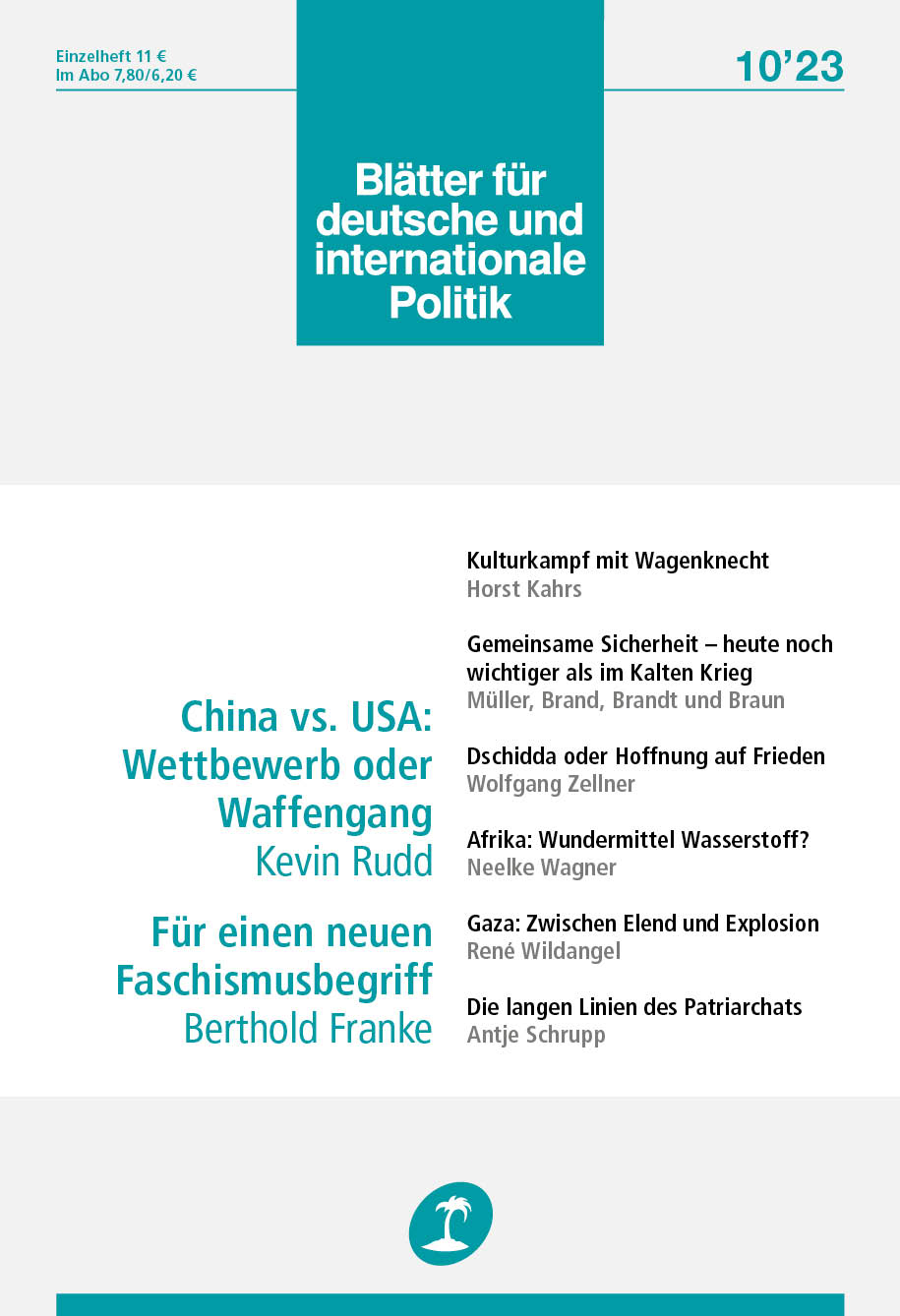Bild: Der argentinische Präsidentschaftskandidat Javier Milei, 7.7.2023 (IMAGO / Aton Chile)
Die Menschen in Argentinien sind wütend – und diese Wut hat das Zeug, den exzentrischen Außenseiter Javier Milei an die Staatsspitze der drittgrößten Volkswirtschaft Lateinamerikas zu katapultieren. Der selbsterklärte Anarchokapitalist, der gegen die „parasitäre politische Kaste“ – und vor allem gegen den regierenden „Kirchnerismus“ unter Präsident Alberto Fernández – wettert, kann sich gute Chancen ausrechnen, als Sieger aus der Präsidentschaftswahl am 22. Oktober hervorzugehen. Bereits die obligatorischen Vorwahlen[1] Mitte August brachten die große Unzufriedenheit und Wut der Argentinier:innen zum Ausdruck: Nur noch etwa 40 Prozent der Wähler:innen stimmten für das Angebot der traditionellen politischen Bündnisse. Die Mehrheit entschied sich für Anti-System-Kandidat:innen, gab einen leeren Stimmzettel ab oder ging trotz Wahlpflicht gar nicht erst zur Abstimmung.
Präsident Fernández trat angesichts seiner spärlichen Regierungsbilanz vorsichtshalber gar nicht wieder an. Der schrille Wirtschaftsprofessor Milei hingegen, noch vor wenigen Jahren ein marginales politisches Phänomen, entpuppte sich bei den Vorwahlen mit seiner jungen Partei La Libertad Avanza („Die Freiheit schreitet voran“) mit 30 Prozent als stärkster Kandidat. Auch in Umfragen für die Präsidentschaftswahl steht er mit 31 bis 33 Prozent der Stimmen aktuell an erster Stelle. Argentinien reiht sich damit ein in die Gruppe jener demokratisch verfassten Länder, die von Protesten gegen „das System“, „die Elite“ oder gegen „die da oben“ geprägt sind und in denen ultrarechte, nationalistische oder rechtsextreme Systemsprenger à la Trump oder Bolsonaro diesen ein Ventil geben.
Der Unmut der Argentinier:innen basiert indes auf harten Fakten: Das Land ächzt unter einer enormen Staatsverschuldung, einer galoppierenden Inflation von fast 130 Prozent, und das bei Löhnen unterhalb der Armutsgrenze, einer steigenden Armutsrate von 40 Prozent oder mehr, gepaart mit einer Reserven- und Devisenknappheit und der Volatilität des „blauen Dollars“ – wie die auf dem Schwarzmarkt zu inoffiziellen Wechselkursen eingetauschten US-Dollar genannt werden. Hinzu kam die extreme Dürre auf der Südhalbkugel im letzten Sommer, die zu Ernteausfällen und einem massiven Rückgang der Deviseneinnahmen des Agrarexporteurs Argentinien führte. Das Auf und Ab der argentinischen Krisenzyklen hat sich mittlerweile zu einer Dauerkrise ausgewachsen, die nun schon zehn Jahre anhält.
Und gegen diese scheint kein Rezept zu fruchten, weder die marktliberale Politik des ehemaligen argentinischen Präsidenten Mauricio Macri noch der moderate Mitte-links-Kurs der Regierung Fernández, der den Bedingungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) gerecht zu werden versucht, aber zugleich staatliche Subventionen hochfährt, um das Elend nicht noch weiter anwachsen zu lassen. Für die Armen ist die rasante Inflation eine humanitäre Katastrophe. Doch auch die Mittelschicht leidet, reichen doch die Lohnanpassungen in Peso bei weitem nicht aus, um die Inflation auszugleichen. Das monatliches Durchschnittseinkommen, umgerechnet in US-Dollar, ist in wenigen Jahren um rund 62 Prozent gesunken.
Ein entscheidender Grund für die anhaltende Wirtschafts- und Sozialkrise liegt in der enormen Schuldenbelastung. 2018 gewährte der IWF Argentinien ein Darlehen in Höhe von 57 Mrd. US-Dollar – das größte in der Geschichte der Institution. Ein Großteil davon landete allerdings auf den Konten von Gläubigern, Finanzspekulanten und Investitionsfonds, was selbst der IWF 2021 indirekt zugeben musste.[2] Und noch immer steht Argentinien beim IWF mit etwa 44 Mrd. US-Dollar in der Kreide. Zwar wurde das Schuldenpaket 2022 neu verhandelt, aber das damals beschlossene Memorandum bindet Überweisungen des IWF an vierteljährliche Inspektionen, bei denen Haushaltsführung und Subventionspolitik eingehend geprüft werden. Doch auch wenn bis 2027 „nur“ Zinsen anfallen – zurückzahlen muss Argentinien die Schulden in absehbarer Zukunft dennoch. Wie dies beim beständigen Dollarmangel in der Zentralbank funktionieren soll, ist völlig unklar. Klar ist hingegen, dass das Schuldenpaket die Entwicklung des Landes bremst, indem es der Politik Fesseln anlegt.
Das Patt der traditionellen Parteien
Die beiden großen politischen Lager – die peronistische[3] Union por la Patria (bisher Frente de Todos) und die konservative Juntos por el Cambio – verharren angesichts der verfahrenen Lage in einer Art politischem Patt. Und erstmals seit 2007 stehen weder Cristina Fernández de Kirchner noch Mauricio Macri – die einstigen Zugpferde beider Lager – zur Wahl. Es scheint, als sei dem Kirchnerismus, der in den letzten 20 Jahren dominanten peronistischen Strömung, die Luft ausgegangen. Dessen politisches Projekt, das für die Ausweitung gesellschaftlicher Rechte und die Verurteilung der Verbrechen der Militärdiktatur stand, verfügt aktuell über keinen klaren Kompass mehr.
Progressiver Höhepunkt der scheidenden Regierung Fernández war sicherlich das von der Zivilgesellschaft 2020 erstrittene Abtreibungsgesetz, Tiefpunkt hingegen ist der permanente regierungsinterne Streit. Einen eigenen Kandidaten konnte Fernández‘ Vorgängerin Cristina Kirchner, Ehefrau des 2010 verstorbenen Ex-Präsidenten und Namensgebers des Kirchnerismus Néstor Kirchner, nicht mehr durchsetzen, so dass der in der Mitte des politischen Spektrums angesiedelte Sergio Massa zum peronistischen Einheitskandidaten gewählt wurde. Dass bei den diesjährigen Präsidentschaftswahlen kein:e Kandidat:in aus dem moderaten linken Spektrum zur Wahl steht – ob nun peronistisch oder nicht –, ist bezeichnend für die Lage im Land. Linkere Kräfte müssen nun versuchen, ihre Anliegen bei dem eher konservativ-sozialdemokratisch orientierten Massa unterzubringen. Die radikalere Linke spielt für das Rennen um die Präsidentschaft keine Rolle.
Im konservativen Lager haben sich mit Patricia Bullrich dagegen die „Falken“ durchgesetzt. Bullrich befürwortet eine Schocktherapie für das Land mit einer raschen Kürzung öffentlicher Ausgaben und einer kräftigen Geldentwertung – beides Maßnahmen, die arme Haushalte besonders treffen würden. Die Chancen der aus einer einflussreichen Familie stammenden Politikerin sinken derzeit allerdings, da sie sich politisch zwischen Milei und dem peronistischen Lager nicht profilieren kann. Egal in welchem Lager sie um Stimmen wirbt, im jeweils anderen wird sie potenzielle Wähler:innen abschrecken.
Aus der Schwäche der beiden traditionellen Parteiallianzen und der Wut der Menschen auf den stetigen sozialen Abstieg schlägt der Outsider Milei Kapital. Angesichts der wirschaftlichen und sozialen Misere gelingt es dem ultrarechten Politiker derzeit am besten, das Bild einer besseren Zukunft zu malen. Bei den Vorwahlen konnte der 52jährige mit seinen einfachen Botschaften gerade in traditionell peronistischen Gegenden, ärmeren Vierteln und bei der jüngeren Generation punkten. Mileis Idee von „Freiheit“ findet anscheinend vor allem dort Anklang, wo wenig Hoffnung auf sozialen Aufstieg ist. Mit seinem radikalen Anti-Etatismus scheint es ihm zu gelingen, die Lebensrealität jener in der informellen Wirtschaft Tätigen treffend zu artikulieren[4] und das verängstigte, wirtschaftlich marginalisierte und politisch abgestumpfte „Prekariat“ zu einem wahrnehmbaren politischen Akteur zu verwandeln.
Ultralibertär – und unrealistisch
Doch anders als seine ultrarechten „Freunde“ Trump und Bolsonaro ist Milei Anhänger einer extrem libertären Ideologie – des sogenannten Anarchokapitalismus, der die einzige Funktion des Staates darin sieht, den Bürger:innen Armee, Polizei und Gerichte zur Verfügung zu stellen, um ihre Eigentumsrechte durchzusetzen. Diese theoretische Schule geht auf den US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Murray Rothbard zurück und proklamiert naturrechtlich, dass die Bereitstellung aller Güter und Dienstleistungen in der Gesellschaft durch freiwillige Verträge zwischen Einzelpersonen geregelt werden soll. Der freie Tausch von Gütern ist das Grundprinzip, dies gilt selbst für Menschen- oder Drogenhandel, Straßenbau, Waffen, Bildung, sogar für Kinder, die im Prinzip von den Eltern verkauft werden können. Der Staat ist in dieser Denkschule der Feind und Aggressor.[5]
Milei möchte in diesem Sinne die öffentlichen Ausgaben um mindestens 15 Prozent senken und das Primärdefizit innerhalb seines ersten Regierungsjahres auf null bringen. Um dies zu erreichen, will er die hohen Subventionen für Strom und Gas streichen, die Zahl der Ministerien von 18 auf acht reduzieren, die föderalen Transferzahlungen an die 24 argentinischen Provinzen reduzieren und die privilegierten Pensionen für hohe Beamte streichen. Alle 34 argentinischen Staatsunternehmen sollen privatisiert und Steuern gesenkt oder abgeschafft werden. Auch das staatliche Bildungs- und Gesundheitssytem will er zunehmend dem Wettbewerb aussetzen und schließlich ganz privatisieren.
Wie realistisch eine derart rapide Senkung der öffentlichen Ausgaben ist, das steht allerdings auf einem anderen Blatt, zumal eine Abschaffung der Subventionen die Preise noch weiter in die Höhe treiben würde. Kaum vorstellbar, dass dieses Kahlschlagprogramm keine Gegenreaktion der Zivilgesellschaft hervorrufen würde. Völlig unklar ist auch, wie sich Mileis Wahlkampfhit – die Dollarisierung der argentinischen Wirtschaft – umsetzen ließe, immerhin bräuchte das Land dafür Zugang zu real vorhandenen Dollarnoten, die zumindest in der Zentralbank derzeit nicht zu finden sind.
Und schließlich ist fraglich, ob eine Milei-Regierung tatsächlich zum Regieren in der Lage wäre. Denn über eine eigene Mehrheit wird seine Partei La Libertad Avanza im Kongress voraussichtlich nicht verfügen. Entsprechend würde das konservative Bündnis Juntos por el Cambio zum Zünglein an der Waage, weshalb Milei bereits öffentlich Avancen in Richtung des ehemaligen konservativen Präsidenten Macri gemacht hat.
Wie die Konservativen mit Milei umgehen und welche möglichen thematischen Koalitionen sich dabei bilden werden, davon wird die weitere demokratische Entwicklung Argentiniens wesentlich abhängen. Bisher zumindest lehnen die großen Medien und weite Teile der argentinischen Unternehmerschaft Mileis Kandidatur ab – ein wichtiger Unterschied zu Bolsonaro in Brasilien. Außerdem verfügt Argentinien über eine überaus aktive Zivilgesellschaft: Die Frauen- und LGBTIQ+-Bewegung, die Feministinnen, Gewerkschaften, soziale Bewegungen, Menschenrechtsaktivist:innen, Umweltgruppen, Vertreter:innen der peronistischen Bewegung und der Mittelschicht werden Reformen, die hart erkämpfte (Menschen-)Rechte infrage stellen, nicht kampflos hinnehmen.
Argentinien im Kulturkampf
Diese Bewegungen waren es auch, die in den vergangenen Jahrzehnten Argentiniens vorbildliche Erinnerungskultur erkämpft haben, allen voran die Madres de la Plaza de Mayo. Der menschenverachtenden Verbrechen der Militärdiktatur zu gedenken, ist heute in Argentinien demokratischer Konsens. Doch dieser wird gegenwärtig durch den Aufstieg der Ultrarechten herausgefordert. Mileis Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Victoria Villaruel, ist Tochter von Oberst Eduardo Villaruel, der Mitte der 1970er Jahre an der Operativa Independencia, der ersten großen Aufstandsbekämpfungsaktion des sogenannten schmutzigen Krieges mitgewirkt hat – die in ihrem Rahmen begangenen Verbrechen stufte die argentinische Justiz Jahrzehnte später als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als genozidale Akte ein. Heute relativiert Victoria Villaruel die Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Militärdiktatur und setzt sie mit den gewaltsamen Aktionen der linksgerichteten Guerrilla der 1970er Jahre gleich. Erst Anfang September bezichtigte sie die Präsidentin der Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, öffentlich, Terrorismus zu rechtfertigen.[6] Milei selbst arbeitete in den 1990er Jahren für den ehemaligen Gouverneur der Provinz Tucumán, Antonio Bussi, der ebenfalls für die Verbrechen der Operation Independencia verantwortlich ist.
Fest steht: In der Polykrise, die Argentinien derzeit durchlebt, haben Antidemokrat:innen à la Milei leichtes Spiel. Leid, Skepsis und eine düstere Stimmung haben sich im ganzen Land breitgemacht. Milei treibt die politische Agenda gezielt nach rechts und kokettiert mit Rechtsextremen auf globaler Ebene. Damit bedroht er nicht nur soziale Errungenschaften, sondern auch und vor allem die hart erkämpfte Demokratie und die Menschenrechte.
Bis zur Wahl kann im flatterhaften Argentinien allerdings noch viel passieren. Alles deutet derzeit auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Milei und Massa hin. Der Peronist Massa kann sich dabei eines riesigen Parteiapparats bedienen und wird angesichts fehlender Alternativen viele Stimmen aus dem linken und liberalen Spektrum bekommen. Ein Sieg über Milei ist damit aber keineswegs garantiert. Auch auf Mileis pöbelhafte Art und seine Schimpftiraden hinzuweisen, wird den traditionellen Politiker:innen nicht helfen. Glaubwürdige, solidarische und im besten Falle progressive Alternativen werden die Wählerschaft dagegen schon eher überzeugen – und zwar nicht nur inArgentinien.
[1] Das argentinische Wahlsystem hat folgende Besonderheit: Nur wer hier über 1,5 Prozent der Stimmen erhält und zudem innerhalb des jeweiligen Parteienbündnisses die meisten, kann bei der eigentlichen Wahl antreten.
[2] El préstamo del FMI a Macri „se usó para financiar fuga y no en hospitales ni rutas”, pagina12.com.ar, 1.8.2023.
[3] Das politisch diverse Lager, das sich auf den ehemaligen Präsidenten Juan Perón (1946-1955 und 1973) beruft.
[4] Maristella Svampa, Milei y la crisis argentina, in: „Nueva Sociedad”, 4/2023, nuso.org.
[5] Vgl. Pablo Stefanoni, La rebeldía se volvió de derecha?, Buenos Aires 2021, S. 97 ff.
[6] Abuelas de Plaza de Mayo sobre los dichos de Villarruel, „Nos retrotraen a lo peor de nuestra historia“, pagina12.com.ar, 6.9.2023.