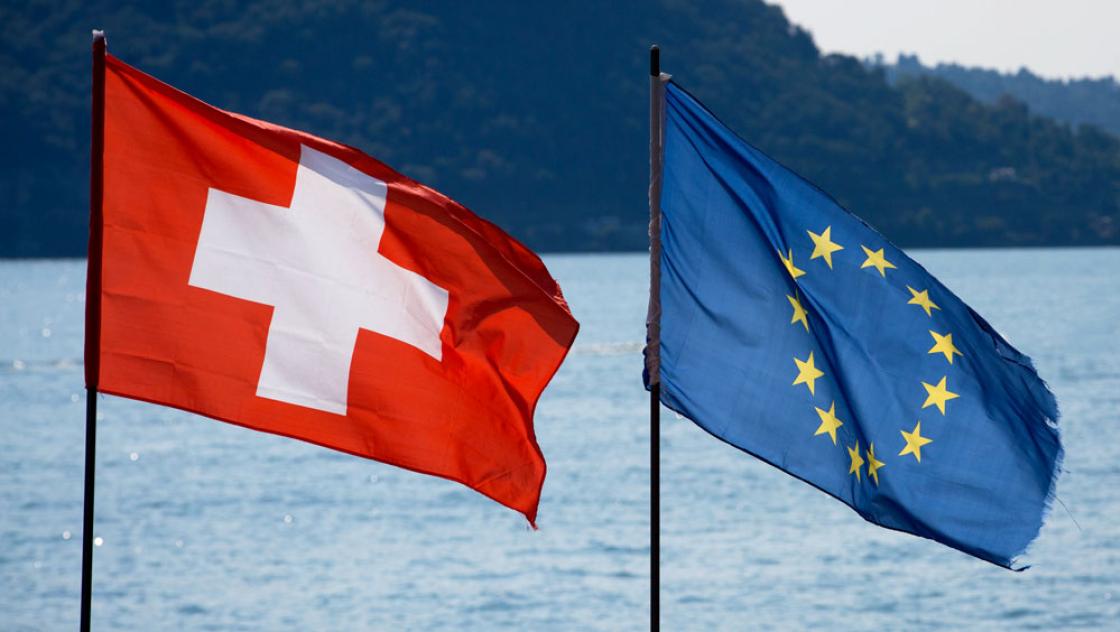
Bild: Flaggen der EU und der Schweiz, 13.9.2019 (IMAGO / CHROMORANGE)
Stellen Sie sich vor, in Deutschland oder Österreich würde nächstes Wochenende eine Volksabstimmung stattfinden. Und zwar darüber, ob die Personenfreizügigkeit und die Dienstleistungsfreiheit mit den anderen Ländern der Europäischen Union bestehen bleiben sollen. Ob also der deutsche oder österreichische Arbeitsmarkt für Migrant:innen aus der EU offenbleiben und ob es Unternehmen, insbesondere aus den neuen EU-Staaten, weiterhin erlaubt sein soll, Beschäftigte für die Erledigung bestimmter Aufträge zu entsenden. Man muss nicht den Teufel an die Wand malen, um die Prognose zu wagen, dass es dem proeuropäischen Lager zumindest einiges an Einsatz abverlangen würde, eine solche Volksabstimmung zu gewinnen. Gleiches gilt wohl auch für andere Bereiche der europäischen Integration.
Die Schweizerische Sozialdemokratie (SP) und die Gewerkschaften standen in den vergangenen 30 Jahren achtmal vor genau dieser Aufgabe. Wie ist es dabei gelungen, in einem Nicht-EU-Land immer wieder Mehrheiten für eine Anbindung an den Staatenbund zu beschaffen?
Die Antwort ist banal und herausfordernd zugleich: mit der Formel „wirtschaftliche Integration flankiert mit sozialem und ökologischem Schutz“. Wenn in der Schweiz derzeit um neue Verhandlungen mit Brüssel nach dem Abbruch des Rahmenabkommens mit der EU im Jahr 2021 gestritten wird, so geht es dabei genau um diese Formel.









