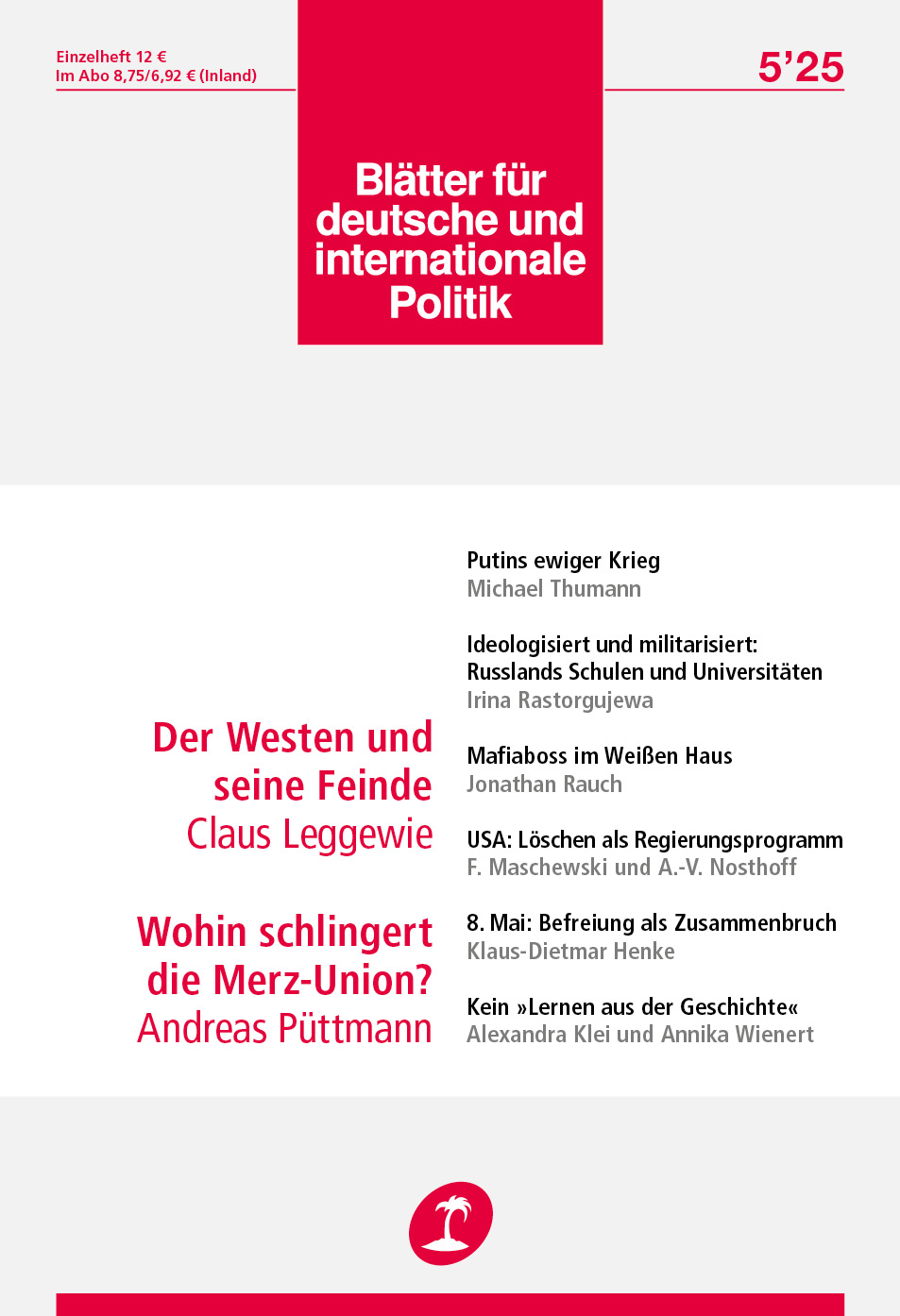Wie die Deutschen 1945 das Kriegsende erlebten

Bild: Russische Soldaten und ein Zivilist schieben einen großen bronzenen Reichsadler zu den Trümmern, 1945 (IMAGO / Photo12 / Ann Ronan)
Im August 1941 wandte sich Thomas Mann in einer seiner berühmten Radiobotschaften aus dem amerikanischen Exil wieder einmal an die deutschen Hörer. Die Sowjetunion schien fast besiegt, die Vereinigten Staaten befanden sich noch nicht im Krieg, Präsident Roosevelt und Winston Churchill hatten mit der Atlantik-Charta eben ihren Gegenentwurf zu Hitlers Pax Germanica der totalen Unterwerfung verkündet. Es sei ein Streit in der Welt, teilte der Nobelpreisträger seinen Landsleuten mit, „ob man zwischen dem deutschen Volk und den Gewalten, die es heute beherrschen, eigentlich einen Unterschied machen kann, und ob Deutschland überhaupt fähig ist, sich der neuen, sozial verbesserten, auf Frieden und Gerechtigkeit gegründeten Völkerordnung, die aus diesem Krieg hervorgehen muss, ehrlich einzugliedern.“ Thomas Mann gab eine optimistische Antwort: Obgleich der Nationalsozialismus mit seinen langen Wurzeln in der deutschen Tradition eine „Sprengmischung“ bilde, welche die gesamte Zivilisation bedrohe, sei er doch „gutgläubig und vaterlandsliebend genug“, den positiven deutschen Traditionen den „längeren historischen Atem zuzutrauen“. Den negativen Traditionen werde der Atem ausgehen, prophezeite er auf dem Höhepunkt von Hitlers Machtentfaltung. Die unheilvolle deutsche Tradition sei nämlich „im Begriffe, sich auszuleben, sich wahrhaftig zu Ende und zu Tode zu leben.