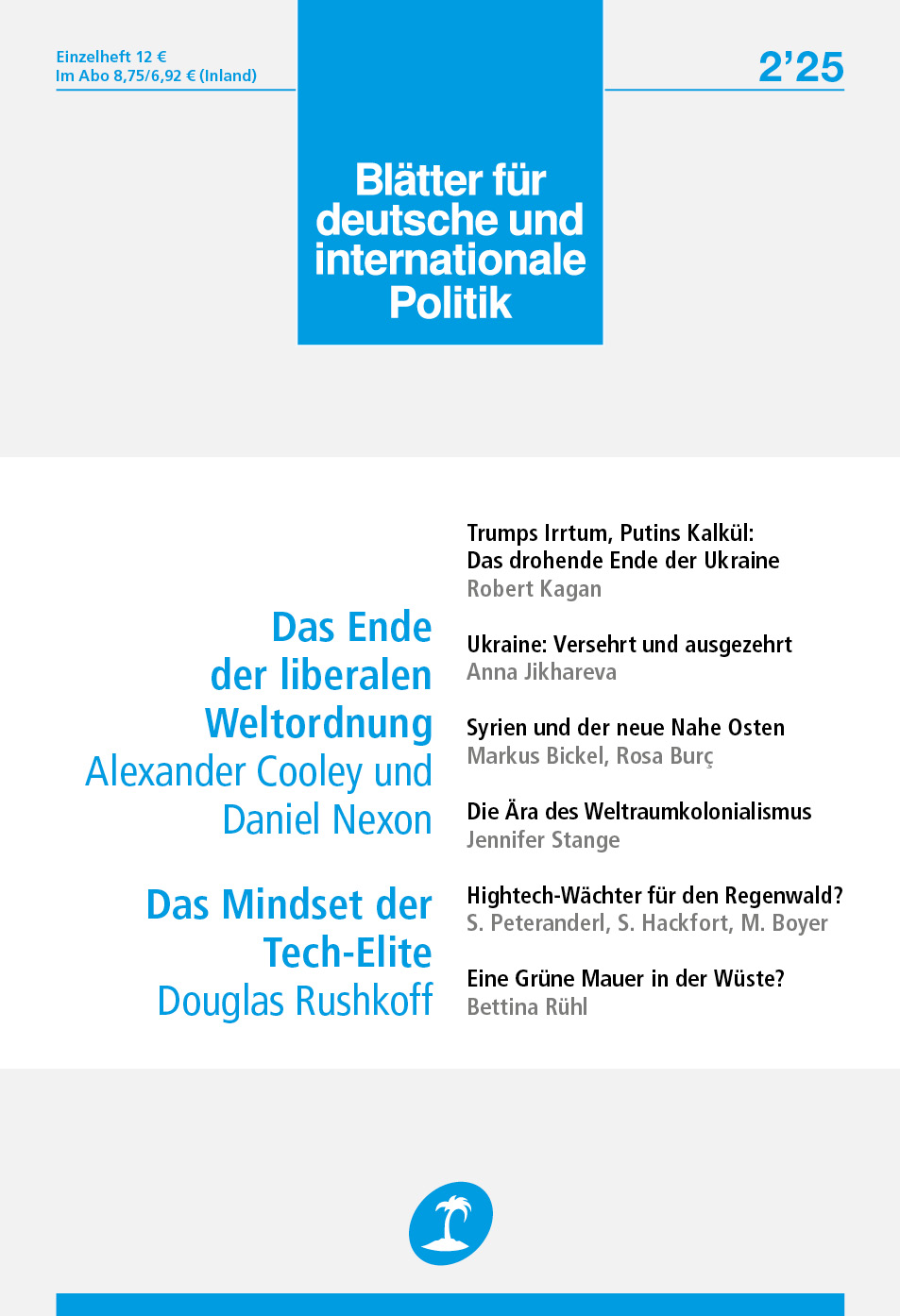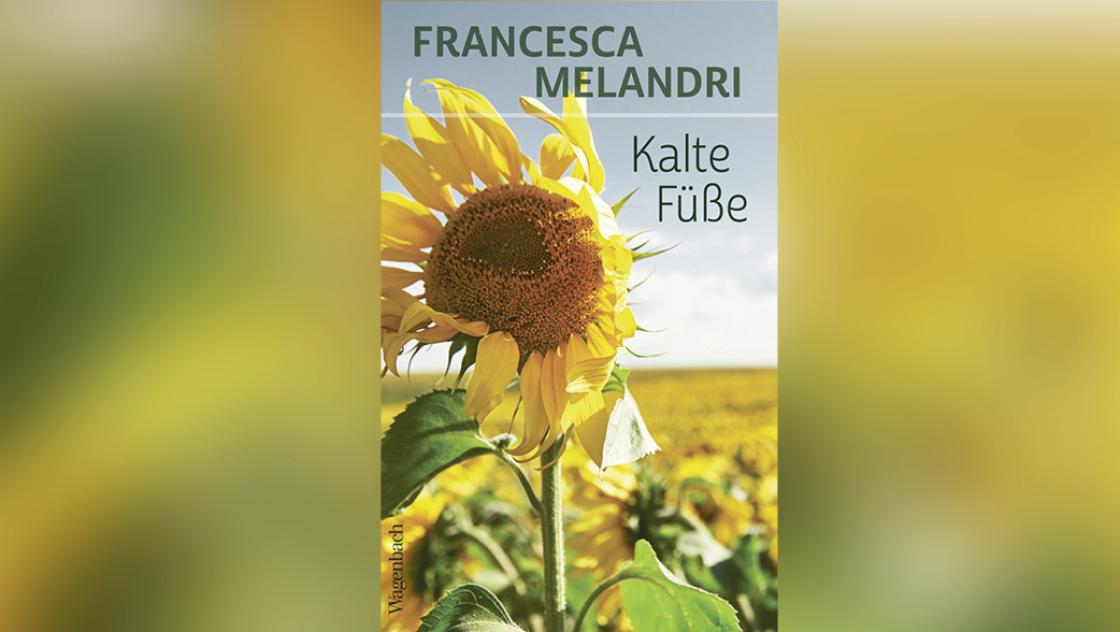
Bild: Francesca Melandri: Kalte Füße, Cover: Wagenbach Verlag
Franco Melandri diente als Leutnant der Alpini, der italienischen Gebirgsjäger, in Mussolinis Armee. Als solcher marschierte er in die Sowjetunion ein und trat später den chaotischen Rückzug an. Anders als in Deutschland, wo sich die Kriegsgeneration öffentlich in Schweigen hüllte, wurde in Italien über diese Ritirata di Russia, den „Rückzug aus Russland“ gesprochen. Die Veteranen erzählten ihn als Opfergeschichte junger Männer, die sich nur mit Pappsohlen unter den Stiefeln durch den harten russischen Winter bis nach Hause schleppten und sich dabei oft Gliedmaßen abfroren. „Kalte Füße“ nennt Francesca Melandri, die Tochter des körperlich heil zurückgekehrten Leutnants, denn auch ihr Buch, das fulminant Erinnerung mit politischem Essay verbindet.
Ihr Ausgangspunkt ist eine jähe Erkenntnis im Vorfrühling des Jahres 2022. Als Melandri, zu diesem Zeitpunkt schon eine international bekannte Schriftstellerin, die Nachrichten über die russische Invasion der Ukraine verfolgt, stellt sie fest, dass sie die Namen der heutigen Kriegsschauplätze aus den Erzählungen und Büchern ihres Vaters kennt: Isjum, Dnipro, Charkiw. Der Soldat Franco Melandri, das realisierte seine Tochter erst in jenen Tagen, hatte nicht den Rückzug aus Russland angetreten, sondern aus der Ukraine.