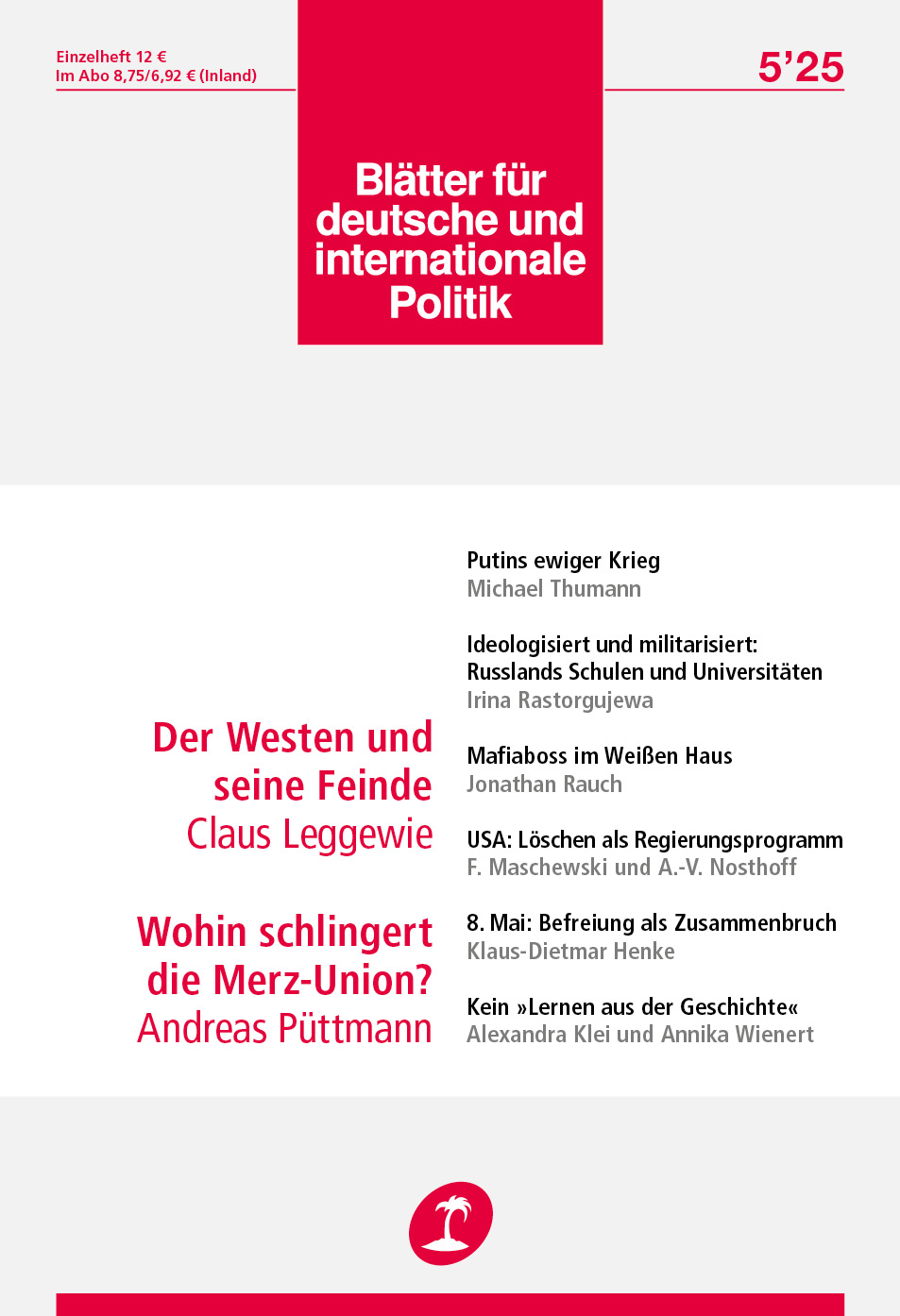Bild: Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum im Nationalpalast in Mexiko-Stadt, 13.12.2024 (IMAGO / aal.photo / Carlos Santiago)
Ist es ein gutes Zeichen, heutzutage von US-Präsident Donald Trump gelobt zu werden? Diesen „Ritterschlag“ erhielten bisher nur männliche Rechtspopulisten wie Javier Milei, Nayib Bukele oder Jair Bolsonaro. Dass nun der als links geltenden mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum diese Ehre gleich mehrmals zuteilwurde, hat auch die internationale Presse bewegt. Der ersten Frau im mexikanischen Präsidentenamt war es wiederholt gelungen, die US-Zölle gegen Mexikos Wirtschaft zu verhindern – noch bevor Trump am 9. April überraschend einen Großteil seiner kurz zuvor gegenüber vielen Ländern angekündigten Sonderzölle für 90 Tage aussetzte, ausgenommen denen gegenüber China. Ob sich die EU Sheinbaum nicht für zwei Wochen im Tausch gegen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausleihen könne, scherzte gar ein spanischer Moderator des kleinen Onlinesenders „Negocios TV“.1 Auch innerhalb Mexikos geht Sheinbaum mit Zustimmungswerten von 82 Prozent gestärkt aus ihren ersten sechs Monaten im Amt hervor – und das, obwohl sie außen- wie innenpolitisch ein kompliziertes Erbe zu verwalten hat.
Wenn Trump die mexikanische Präsidentin erwähnt und sie als „very nice woman, very fine woman“ oder „wonderfull women“ bezeichnet, kommt man nicht umhin, den ihm typischen misogynen Ton herauszuhören. Sheinbaum sei verantwortlich für seinen persönlichen „Aha-Moment“: Sie habe ihm vorgeschlagen, das US-Drogenproblem mit Kampagnen zur Konsument:innenaufklärung anzugehen – wie sie es auch in Mexiko versuche. Wenngleich Fachleute diesen Vorschlag kaum als bahnbrechend empfinden dürften, deutete man die positive Rezeption durch Trump in Mexiko als Resultat von Sheinbaums diplomatischem Geschick. Tatsächlich aber sagt Trumps naiv wirkende Auseinandersetzung mit den drogenpolitischen Vorschlägen der Präsidentin mehr über seinen Politikstil aus als über den von Sheinbaum.
Dennoch sticht die 62-Jährige aus der mexikanischen Politiker:innenkaste hervor. Weder gehört sie der alten politischen Oligarchie des Landes an, noch kommt sie aus den führenden Wirtschaftsebenen. Die säkulare Jüdin und Physikerin, deren Eltern in den 1920er Jahren aus Litauen und Bulgarien nach Mexiko migrierten, ist mit ihrer grazilen Erscheinung und tiefen Stimme auch nicht die populäre Aufsteigerin aus dem Volke.
Was sie für den Job auszeichnet, ist ihre nüchterne Standhaftigkeit. Auch angesichts schwerer Kritik neigt sie selten zum Drama. Was nicht heißen soll, dass sie nicht auch gegen ihre Kritiker:innen austeilt, doch sie tut es subtiler als ihr Vorgänger und Wegbereiter Andrés Manuel López Obrador (Amlo). Spätestens seit sie im Januar dieses Jahres nebenbei erwähnte, gerade die Biografie von Angela Merkel zu lesen, wird besonders in Lateinamerika der Vergleich zur ehemaligen deutschen Kanzlerin immer wieder aufgegriffen. Das Bild von der mexikanischen Merkel dient nicht zuletzt dazu, ihren Umgang mit Trump zu beleuchten. Sheinbaums politisches Geschick beschränkt sich indes nicht nur auf diese eine, besonders unkalkulierbare, Persönlichkeit. Stattdessen geht es generell um „Männer“ – um Merkel zu zitieren –, und den pragmatischen Umgang mit ihnen.
Mexikos Merkel
Der höhere Politikapparat in Mexiko ist ein dezidiert männlicher, das Land in weiten Teilen tief konservativ und katholisch. Obwohl es eine große, breite und bunte feministische Bewegung gibt und besonders die Regierungspartei Morena sich dadurch auszeichnet, viele hochqualifizierte junge Frauen in ihren Reihen zu zählen, ist die gläserne Decke dick.
Trotz einer gesetzlich verankerten Geschlechterparität bei der Aufstellung der Kandidat:innen ist auf lokaler Ebene regelmäßig zu beobachten, wie gewählte Frauen nach wenigen Monaten unter Vorwänden aus dem Amt ausscheiden und ihre Ehemänner den Platz dankbar einnehmen. Dieses Vorgehen hat System. Auf föderaler Ebene gab es bis zu den Wahlen 2022 in den 32 Bundesstaaten lediglich neun weibliche Gouverneurinnen, die sich jedoch vorwiegend in den weniger einflussreichen Bundesstaaten fanden. Mit einer Ausnahme: Claudia Sheinbaum regierte zuletzt den Hauptstadtbezirk.
Sheinbaum selbst zeigt sich von den misogynen Angriffen, die sie ebenfalls erfährt, nahezu ungerührt. Gleichzeitig vermeidet sie es, ihren männlichen Kollegen den Spiegel vorzuhalten. Sie ist keine Feministin, die das Patriarchat herausfordert, sondern eine kluge Strategin, die das politische System geschickt zu ihrem Vorteil nutzt. In ihrem Kabinett zählt sie auf die Loyalität einiger männlicher Verbündeter, die sie trotz teilweise schwerwiegender Skandale auf wichtige Posten hievte. Wenn es darauf ankommt, weiß Sheinbaum zu glänzen. Damit ist sie, mehr noch als Angela Merkel, trotz aller Widersprüche eine wichtige Inspirationsfigur für viele Frauen in Mexiko.
Erst Anfang April konnte Sheinbaum bereits zum dritten Mal verbesserte Konditionen für Mexiko in der Zollfrage aushandeln. Die Zölle traten zwar bis zu ihrer neuerlichen Aussetzung in Kraft, doch Produkte, die im Rahmen des nordamerikanischen Freihandelsabkommens USMCA, des Nachfolgers von NAFTA, hergestellt werden, wurden von den 25-Prozent-Zöllen ausgenommen. Damit blieben die wichtigsten Wirtschaftszweige Mexikos verschont, und mit ihnen auch die der USA. Im internationalen Zollstreit hat Mexiko auch deswegen eine herausragende Stellung, weil 84 Prozent der mexikanischen Exporte in die USA gehen. Damit ist Mexiko der primäre Handelspartner der USA, noch vor China und Kanada. Diese herausgehobene Rolle Mexikos wird gerade in Europa oft unterschätzt. General Motors etwa ist der größte Exporteur von Autoteilen aus Mexiko. Die Teile überqueren während des Produktionsprozesses bis zu sieben Mal die Grenze. Zölle würden hier eine immense logistische und finanzielle Herausforderung bedeuten. Zudem können Produktionsketten auch nicht einfach in die USA zurückverlegt werden, wie Trump es fordert. Obwohl Mexiko unter Sheinbaum den Mindestlohn angehoben hat und Arbeitsrechte wie Umweltschutz verbessert, bleibt der Unterschied im Durchschnittslohn weiter erheblich: 11 000 US-Dollar in Mexiko stehen 65 000 US-Dollar in den USA gegenüber.
Sheinbaum hat mit Mexikos Wirtschaft somit einen bedeutenden Trumpf in der Hand. Dieser wird umso relevanter, je mehr Trump sich zu einem Handelskrieg mit China hinreißen lässt. Darüber hinaus ist Mexiko in der komfortablen Lage, spätestens seit Beginn des Ukrainekrieges und den Sanktionen gegen Russland auch von der EU umworben zu werden. Sheinbaum lässt angesichts dessen keine Chance aus, den USA freundlich zu signalisieren, dass man sich auch nach anderen Handelspartner:innen umsehe. In diesem Sinne kam es ihr sehr gelegen, dass im Januar endlich die schleppenden Verhandlungen über eine Erneuerung des Globalabkommens zwischen Mexiko und der EU ein Ende fanden.
Druckmittel Drogenkartelle
Bekanntermaßen werden in Mexiko jedoch nicht nur legale Exportgüter produziert. Laut den Vereinten Nationen zählen Mexiko, Myanmar, Afghanistan und Syrien zu den wichtigsten Produktionsstandorten für Methamphetamin und Fentanyl. Besonders der Konsum des Opioids Fentanyl hat sich in den vergangenen zehn Jahren in den USA zu einer Epidemie ausgeweitet; allein 2023 starben daran rund 75 000 Menschen. Aufklärungskampagnen allein werden das Problem kaum lösen.
Sheinbaum forderte die USA entsprechend immer wieder dazu auf, die organisierte Kriminalität auch innerhalb der USA selbst zu bekämpfen. Trump hingegen verortet die Ursachen des Konsums ausschließlich außerhalb der Landesgrenzen: in Mexiko. Mit dieser Externalisierung übt er Druck auf die mexikanische Regierung aus. Die Zölle setzt er dabei als Strafe ein. Als US-Außenminister Marco Rubio im Februar die größten mexikanischen Drogenkartelle als terroristische Organisationen einstufte – ein Schritt, der theoretisch militärische Interventionen ermöglichen würde –, verschärfte sich der Konflikt. Auch wenn ein solches Szenario derzeit als unwahrscheinlich gilt, ist die Botschaft in Mexiko angekommen – und Sheinbaums diplomatisches Geschick umso mehr gefragt.
Der Vorwurf wiegt schwer: Nicht nur gehe Mexiko unzureichend gegen die Kartelle vor, sondern der Staat selbst sei in Teilen von ihnen durchdrungen. Immer wieder geraten hochrangige Politiker:innen und Beamt:innen in den Verdacht, mit der organisierten Kriminalität zu kooperieren. Unklar bleibt jedoch, wie weit diese Verbindungen tatsächlich reichen. Werden lediglich Straftaten gedeckt, was bereits schwerwiegend wäre? Werden Dienstleistungen der organisierten Kriminalität wie Stimmenkauf oder politische Gewalt gezielt in Anspruch genommen? Oder sitzen Vertreter:innen der Kartelle womöglich selbst in staatlichen Ämtern? Verschiedenen Recherchen zufolge, darunter auch der Investigativjournalistin Anabel Hernández, ist es schwer von der Hand zu weisen, dass Morena-Politiker:innen mindestens auf Gehaltslisten einzelner Kartelle stehen oder standen.
Für Nervosität innerhalb der Morena-Partei sorgt aktuell eine Klage gegen Ex-Präsident López Obrador sowie die Gouverneure von Sinaloa und Tamaulipas, die von mehreren US-Staatsanwälten vor einem New Yorker Gericht eingereicht wurde. Sie und weitere werden beschuldigt, Bestechungsgelder erhalten und Ermittlungen behindert zu haben. Die mexikanische Regierung weist die Vorwürfe als unbegründet zurück und spricht von einer politisch motivierten Diskreditierungskampagne. Doch die Anschuldigungen setzen Sheinbaum unter Druck.
Wenige Tage bevor Trump Anfang März den zweiten Zollaufschub für mexikanische Exporte verkündete, übergab Mexiko überraschend 29 mutmaßliche Drogenhändler an die USA. Solche Auslieferungen sind grundsätzlich nicht unüblich, erfolgen jedoch in der Regel nach einem langwierigen juristischen Verfahren, das insbesondere den Ausschluss der Todesstrafe im Empfängerland garantieren muss. Im vorliegenden Fall jedoch wurden die Betroffenen ohne Ankündigung, teils mitten im laufenden Prozess, überstellt. Wenig später erklärte Sheinbaum, es gebe bereits weitere Listen zur möglichen Auslieferung inhaftierter Kartellmitglieder an die USA. All das wirkt, als treibe die USA die mexikanische Regierung vor sich her und zwinge sie zu immer neuen Zugeständnissen. Mexiko selbst könnte aber einen hohen Preis dafür bezahlen. Denn neben wirtschaftlichen Sorgen durchlebt die mexikanische Bevölkerung seit Jahrzehnten eine schwerwiegende Menschenrechtskrise. Dabei tun sich immer wieder neue und tiefe Abgründe auf, die ein gesamtgesellschaftliches Trauma bewirken.
Keine Priorität: Mexikos 122 000 Verschwundene
Erst am 15. März versammelten sich in über 40 Städten Mexikos zehntausende Menschen zu einem nationalen Trauertag, ausgerufen von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich dem drängenden Thema des gewaltsamen Verschwindenlassens widmen. Kurz zuvor hatte eine Gruppe von Madres Buscadoras („Suchende Mütter“) erneut Massengräber entdeckt, darunter ein Trainingscamp der organisierten Kriminalität im Landkreis Teuchitlán, das auch als „Vernichtungslager“ bezeichnet wird. Neben Verbrennungsstätten fanden sich auf einer verlassenen Ranch verkohlte Knochenreste und etwa 200 Paar Schuhe sowie 400 Kleidungsstücke. Der Fund bestätigt Berichte über Exterminierungszonen, in denen Opfer des Verschwindenlassens beseitigt werden. Es handelt sich hierbei überwiegend um zwangsrekrutierte Männer, die die Ausbildung zum Auftragsmörder nicht überlebt haben.
Im September 2024 hatten Militär und Nationalgarde am selben Ort mehrere leitende Kartellmitglieder festgenommen, die Ranch wurde jedoch nicht durchsucht und es wurden auch keine weiteren Ermittlungen eingeleitet. Mittlerweile hat die Bundesstaatsanwaltschaft den Fall übernommen, doch die Kritik reißt nicht ab. Auch die Reaktion der Regierung und nicht zuletzt von Präsidentin Sheinbaum gegenüber den Angehörigen wird als unsensibel wahrgenommen. Während die Angehörigen der Verschwundenen einen entscheidenden Beitrag zur Aufklärung leisten, sind sie selbst massiven Drohungen ausgesetzt. Auf Regierung und Behörden können sie bei der Suche nach Wahrheit kaum zählen. Dabei sollte dem Thema höchste Priorität eingeräumt werden: 122 000 Menschen gelten laut staatlichem Register aktuell als verschwunden.
Doch Sheinbaums Fokus liegt auf international vorzeigbaren Fakten wie der Vernichtung von Drogen und Festnahmen von Kadern der organisierten Kriminalität, die gegebenenfalls an die USA ausgeliefert werden können. Das Bedürfnis der mexikanischen Bevölkerung nach Aufklärung und der Beerdigung ihrer Toten aber bleibt unerfüllt.
Der eigentliche Skandal, dass Mütter ohne nennenswerte Unterstützung des Staates in der Wüste mit Holzstöcken in der Erde stochern und ihre verschwundenen Kinder anhand von aufsteigendem Verwesungsgeruch suchen – und finden (!) –, gehört in Mexiko längst zur Normalität. Dass die massive Menschenrechtskrise im Land nicht zu Sheinbaums primären Anliegen zählt, ist bitter für ein Land, dessen Bewohner:innen seit zwei Jahrzehnten einer oft unvorstellbaren Gewalt ausgesetzt sind und in einem Krieg leben, der offiziell keiner ist.
Dennoch füllt Sheinbaum ihre Rolle als professionelle Politikerin auf eine beeindruckend routinierte Art aus, von der sich auch hiesige Spitzenpolitiker:innen einiges abschauen könnten. Die Tatsache, dass sie eine Frau ist, macht sie dabei ebenso wenig zu einer Feministin, wie sie die unbürokratische Ausschüttung von Geld an breite Teile der Bevölkerung zu einer dezidiert linken Politikerin macht. Und trotz alledem ist Claudia Sheinbaum in diesen Zeiten das Beste, was Mexiko passieren konnte.
1 ¿Nos pueden cambiar a Von der Leyen por Sheinbaum? El gran error de Europa en la guerra comercial, youtube.com, 4.2.2025.