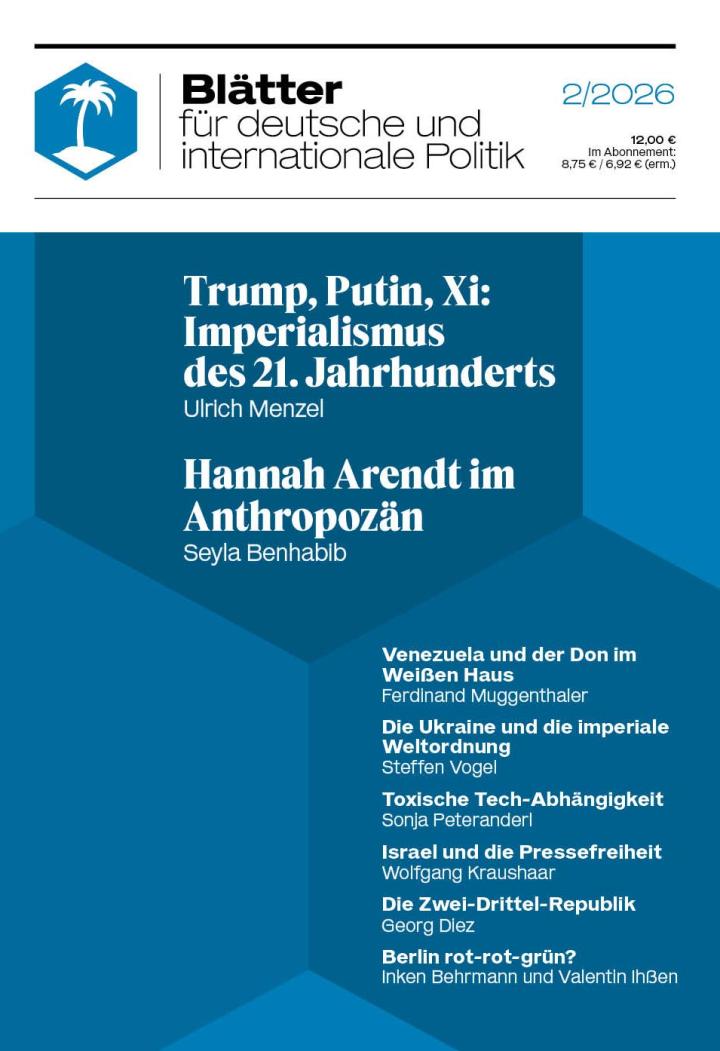Zum 150. Geburtstag von Konrad Adenauer

Bild: Konrad Adenauer, von 1949 bis 1963 erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, 31.3.1965 (IMAGO / Sven Simon)
Am 5. Januar 1876 wurde der Mann geboren, der wie kein Zweiter die bundesdeutsche Nachkriegsgeschichte prägen sollte. Konrad Adenauer, aufgewachsen im Wilhelminismus, wurde ein überzeugter Demokrat – und zugleich ein zum Einsatz vieler Mittel bereiter Machtpolitiker. Auf diese Weise stellte er die entscheidenden Weichen in der Außenpolitik der jungen Republik und dominierte deren Innenpolitik.
Konrad Adenauer, der erste und bis heute zweifellos wichtigste, mit seiner eindeutigen Hinwendung zum Westen wegweisende Kanzler der Bundesrepublik, war kein Intellektueller, aber er war auch kein bloßer Macher. Nach einer von vielen bestaunten, von seinen nationalsozialistischen Feinden gewaltsam beendeten Karriere in der Kommunalpolitik als Oberbürgermeister in seiner Heimatstadt Köln und als Präsident des Preußischen Staatsrats war er ein mit allen Wassern gewaschener Mann der Exekutive, der nach zwölf Jahren im inneren Exil – eine auf ihn kaum je angewandte, aber zutreffende Formel – keine Mühe hatte, seine erprobten Arbeitsprinzipien und Lebensmaximen in der neugegründeten Bundesrepublik auf die Ebene höchster Staatspolitik zu übertragen. Dass man ihn deshalb den »großen Vereinfacher der Politik« nannte, störte ihn nicht: »Das halte ich für ein ganz großes Lob, denn in der Tat, man muss die Dinge auch so tief sehen, dass sie einfach sind«, erklärte er, fast neunzigjährig, im Gespräch mit Günter Gaus. Nur dann nämlich sehe man »das Wirkliche, und das ist immer einfach. Ob das angenehm ist, das ist eine andere Frage.«[1]
Dem Unangenehmen ins Auge zu blicken, auch dem Unglück, hatte Adenauer früh gelernt. Die großen persönlichen Tragödien, der frühe Tod seiner ersten Frau Emma, das Siechtum von Gussie Adenauer, seiner zweiten Frau, die Anfang März 1948 starb, lagen zu Beginn der Bundesrepublik bereits hinter ihm. Der neuen Aufgabe begegnete er daher als gänzlich freier, aber auch als ein im Innersten zutiefst einsamer Mann. Ungeachtet aller von außen kommenden Erwartungen und unabweisbaren Veränderungen, die mit dem Amt einhergingen, gelang es Adenauer, die Rolle des Bundeskanzlers ganz nach seinen eigenen Vorstellungen anzulegen und auszufüllen. Das galt für den streng geregelten Tagesablauf, in den sich die Gremiensitzungen und Besprechungstermine einzufügen hatten, das galt für seine öffentlichen Reden, bei deren Vorbereitung er sich am liebsten auf sich selbst verließ, und das galt für den Modus seiner Korrespondenz: klar und konzentriert und oft genug von legendärer Kürze.
Adenauer war stolz und stur und selbstbewusst, doch ohne eine Spur von Eitelkeit. Er war fordernd und anspruchsvoll und rechthaberisch, aber selten selbstgefällig. Er hatte ein Auge für die Schönheit der Natur, sein Kunstsinn war konventionell, und der Kern einer Sache war ihm wichtiger als die Verpackung. Auf dem Weg zu einem als richtig erkannten Ziel war er nicht zimperlich in der Wahl seiner Mittel. Im Umgang mit Menschen, sogar in seiner nächsten Umgebung, konnte er kalt und hart und rücksichtslos sein, aber auch charmant und fürsorglich. Seine wenigen Freundschaften pflegte er. Seine Familie sah er als »Clan«, natürlich mit sich selbst im Zentrum und als von allen zu respektierendes Oberhaupt.
Doch waren das nicht alles Eigenschaften und Verhaltensweisen, die seiner gesellschaftlichen Position entsprachen, in keinem Punkt ungewöhnlich für seine noch unter Bismarck aufgewachsene Generation? Worin also lag das Besondere dieses Mannes, was machte Adenauer aus? Und woher rührte diese ungeheure Leidenschaft für die Politik?
Politik als Schicksal
Vielleicht war es wirklich vor allem der Umstand, dass sich ihm der erhoffte Weg in ein bequemes Notariat auf dem Lande nicht eröffnet hatte, der den jungen Juristen Adenauer in die städtische Politik verschlug. Als großer Redner, gar als Agitator, trat er jedenfalls nicht hervor, weder vor noch nach seiner Wahl zum – mit 41 Jahren bis dahin jüngsten – Kölner Oberbürgermeister 1917, also mitten im Ersten Weltkrieg. Zugleich scheint er der politischen Ordnung, in der er aufgewachsen war und in der er immerhin bis in die erwartbare Mitte seines Lebens reüssiert hatte, nicht lange nachgetrauert zu haben. Augenscheinlich bereitete es ihm keine allzu große Pein, die Privilegien hinter sich zu lassen, die das Kaiserreich einem Mann seines durch eigene Leistung erworbenen Standes und Ansehens gewährte, und noch weniger fehlten ihm Bereitschaft und Fähigkeit, die neuen politischen Verhältnisse anzunehmen und mitzugestalten. In diesem Sinne zählte Adenauer, als das Ancien Régime 1918/19 zusammenbrach, rasch zu den lernstarken Demokraten.
Den Kölner Oberbürgermeister zu einem Vorkämpfer gesellschaftlicher Aufklärung zu stilisieren, wäre jedoch vermessen. Aber die Weimarer Republik hatte in ihm einen glaubwürdigen Repräsentanten. Adenauer war kein Gegner des Fortschritts. Er stand für eine sozialkonservative, technische Moderne – ganz im Einklang mit seinem traditionellen Glauben, seinem optimierungsfreudigen Erfindergeist und seinem ausgeprägt besitzbürgerlichen Erwerbssinn. Dass ihm in den Krisenjahren von Weimar seit 1930 der politische Kompass im Umgang mit der anschwellenden NS-Bewegung zeitweilig abhanden kam und er im Sommer 1932 als Ergebnis einer Unterredung mit rheinischen Parteifreunden festhielt, das Zentrum werde bereit sein, eine Regierung aus Nationalsozialisten und Deutschnationalen unter einem Reichskanzler Hitler »zu tolerieren und ganz unvoreingenommen nur nach seinen Taten zu beurteilen«, besagt wenig über seine prinzipielle weltanschauliche Gegnerschaft zu Nationalsozialismus und Kommunismus. Aus der Perspektive dieses im Katholizismus fest verankerten Mannes waren beides böse Blüten eines grassierenden »Materialismus« und »Nihilismus«, letztlich eines, aber so sagte er es nicht, aus den Fugen geratenen Kapitalismus.
Das »Dritte Reich« als persönliche wie politische Tortur
Die Jahre des »Dritten Reiches« wurden für Adenauer zu einer persönlichen wie politischen Tortur, an der er zeitweise zu zerbrechen drohte. Was ihn rettete, war der völlige Rückzug in die Familie und der Rückhalt, den er dort fand. Seine Distanz zum Widerstand, namentlich zu den Kreisen um Carl Goerdeler, seinen vormaligen Leipziger Amtskollegen, entsprang zum einen seiner berechtigten Sorge um sich und die Seinen, zum anderen aber der Überzeugung, dass das Regime erfolgreich nur von außen zu erledigen sei und kein Raum bleiben dürfe für eine neue Dolchstoßlegende. Daraus wiederum sprach, in einer nur schwer von seinem ohnehin skeptischen Menschenbild zu unterscheidenden Weise, sein Misstrauen gegenüber den Deutschen und besonders ihren Eliten, dessen Ausgangspunkt in der Kriegsbegeisterung von 1914 lag.
Adenauers Zug ins Autoritäre – bei gleichzeitiger persönlicher Abneigung gegenüber allem Militärischen – hatte hier seinen Grund. Jenseits dessen, was charakterliche Disposition gewesen sein mag, war es offenkundig seine politische Überzeugung, dass es einer straffen Führung bedürfe, als ihn die Amerikaner im Frühjahr 1945 zurück auf die politische Bühne baten. Sein anfängliches Zögern, noch einmal das Amt des Kölner Oberbürgermeisters zu übernehmen, wich alsbald, und die Schmach seiner Entlassung durch die Briten nur ein halbes Jahr später scheint seine Leidenschaft für die Politik nur bestärkt zu haben. (In seinen späten Jahren hat er gelegentlich eingeräumt, dass sie ihm auch ein Laster war.)
Die enorme Durchsetzungskraft und der Gestaltungswille, den Adenauer zuerst innerhalb der neu gegründeten Christlich-Demokratischen Union und dann im Parlamentarischen Rat an den Tag legte, machte ihn binnen kurzem zu einer maßgeblichen Stimme in der sich neu organisierenden deutschen politischen Klasse. Aber natürlich wäre er eine Figur des Übergangs geblieben und bald wie viele andere in Vergessenheit geraten, hätte es am 15. September 1949, bei der ersten Wahl des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland, nicht zur denkbar knappsten Mehrheit gereicht: mit 202 von 402 Stimmen, darunter bekanntlich seine eigene.
So aber setzte eine Persönlichkeit das Gespräch mit den Vertretern der Siegermächte fort, die in ihrem natürlichen Selbstbewusstsein, ihrem politischen Geschick und ihrer unverkrampften Würde kaum ihresgleichen hatte. Und zudem ein Mann mit einer Lebenserfahrung von 73 Jahren in drei Systemen. Zum Vergleich: Friedrich Merz, der zum Zeitpunkt seiner Wahl bis heute zweitälteste Kanzler, schaffte es erst im zweiten Anlauf in sein Amt, im Alter von 69 Jahren.
Ein straffes Regiment für eine Vielzahl entscheidender Weichenstellungen
Dank seines Zugangs zu den Alliierten Hohen Kommissaren – genauer gesagt: aufgrund seiner Entscheidung, diesen Gesprächskanal mehr oder weniger zu monopolisieren – verfügte Adenauer alsbald über jenen Informationsvorsprung, der seiner verfassungsmäßigen Richtlinienkompetenz anfangs überhaupt erst Substanz (und später schwer zu bestreitenden Nachdruck) verlieh. Auf dieser Basis gelang es dem Kanzler erstaunlich rasch, alle wichtigen Fäden der Regierungspolitik im Bundeskanzleramt zusammenzuziehen, namentlich die Außenpolitik im Zeichen eines zunächst noch fehlenden Auswärtigen Amts.
Die Vielzahl der Weichen, die eine doch ziemlich zusammengewürfelte Koalition unter dem straffen Regiment des schon damals mit dem Senioritäts- und Erfahrungsbonus agierenden Kanzlers bis 1953 zu stellen vermochte, verblüfft auch noch im Rückblick nach einem Dreivierteljahrhundert. Dies umso mehr, wenn man sich vor Augen führt, dass Adenauer, als er 1949 zum ersten Mal zur Wahl stand, ja nicht als Kanzlerkandidat auftreten konnte, sondern lediglich als Parteichef einer in ihrem interkonfessionellen Anspruch zwar zukunftsweisenden, aber noch ausgesprochen schwächlich organisierten CDU, und dass zudem die Erwartungen auf einem Sieg der von Kurt Schumacher geführten SPD gelegen hatten.
Als Adenauer dann 1953 zum zweiten Mal kandidierte, waren alle wesentlichen Entscheidungen auf dem Weg in den Westen bereits gefallen: Von der 1951 gegründeten Montanunion über den 1952 ausverhandelten »Deutschlandvertrag« und die (später gescheiterte) Europäische Verteidigungsgemeinschaft bis zum 1953 geschlossenen Londoner Schuldenabkommen und dem Israel-Vertrag. Die Bundesrepublik war damit im Begriff, souverän zu werden, jedenfalls in dem durch die Teilung und den fehlenden Friedensvertrag definierten Rahmen der alliierten Vorbehaltsrechte.
Für einen in den ersten deutschen Nationalstaat hineingeborenen Mann, doch auch für die meisten der Jüngeren in der Bonner Politik, war Souveränität nach innen wie nach außen ein hohes Gut und ein selbstverständlich anzustrebendes Ziel. Aber Adenauer war kein Nationalist. Sein Blick war, sehr im Unterschied zu jenem Bismarcks seit 1871, fest auf den politischen Westen gerichtet. Seine Entschlossenheit, europäisch zu denken und zu handeln, die Schwerindustrien supranational zusammenzuschweißen, die Aussöhnung mit dem »Erbfeind« Frankreich voranzubringen und die Bundesrepublik unauflöslich in die transatlantische Staatengemeinschaft zu integrieren, war keine Taktik auf dem Weg zu dem höheren Ziel der Wiedererringung staatlicher Einheit; für Adenauer, der die europäische Einigung wollte wie wenige andere, war es eine Strategie zur Sicherung der Existenz der von außen gestifteten und von ihm mitbegründeten zweiten deutschen Demokratie.
Freiheit vor Einheit
Das bedeutete Freiheit vor Einheit. Daran hat Adenauer zwar nie einen Zweifel gelassen, aber er hat über viele Jahre wider besseres Wissen falsche Erwartungen geschürt und Hoffnungen genährt, nicht nur hinsichtlich der Wiedervereinigung, sondern auch und fast mehr noch in Bezug auf den verlorenen deutschen Osten. Erleichtert hat ihm diese eindeutige Westorientierung eine stets mobilisierbare Rhetorik des Antikommunismus. Dass seine Prioritäten im Kalten Krieg andere waren als jene der parlamentarischen und außerparlamentarischen Opposition, wurde unübersehbar in seinem strikt abweisenden Umgang mit den Stalin-Noten 1952, als der sowjetische Diktator mit der Einheit Deutschlands lockte, aber auch in seiner fast ängstlichen (Nicht-)Reaktion auf den brutal niedergeschlagenen Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni 1953 und in seinem tagelangen Zögern, den West-Berlinern nach dem 13. August 1961, dem Tag des Mauerbaus, wenigstens als Besucher beizustehen.
Kalkuliertes Beschweigen bestimmte Adenauers Umgang mit der NS-Vergangenheit.
Die Skrupellosigkeit, zu der Adenauer jederzeit fähig war, zeigte sich auch in seiner notorischen Neigung, die deutschlandpolitischen Konsequenzen seiner revolutionären Westpolitik zu beschweigen. Zugute kam ihm dabei freilich, dass diese Politik den Deutschen und Europäern jahrzehntelangen kalten Frieden und Sicherheit, den Westdeutschen überdies ungeahnten Wohlstand garantierte. Dass für Adenauer nicht so selten der Zweck die Mittel heiligte, zeigte sich aber auch im Umgang mit seinen politischen Gegnern: In seinen mit heute undenkbarer Härte geführten, auf ihn selbst wie ein Jungbrunnen wirkenden Wahlkämpfen gegen die Sozialdemokraten – und in deren von ihm geduldeter jahrelangen illegalen Ausspionierung, beginnend noch zur Zeit der auf ihre Übernahme in den Staatsdienst hoffenden Organisation Gehlen, des späteren Bundesnachrichtendienstes.[2]
Pragmatismus auf Kosten der politischen Kultur
Kalkuliertes Beschweigen bestimmte auch Adenauers Umgang mit der NS-Vergangenheit. Nicht, dass er je Illusionen gehabt hätte über das Ausmaß der Bereitschaft seiner Landsleute, sich dem Nationalsozialismus zu verschreiben, von der Verfolgung der Juden zu profitieren und im Namen der »Volksgemeinschaft« monströse Verbrechen zu begehen; doch öffentlich über das Ungeheure des Judenmords zu sprechen – über den gesellschaftlich erst im Jahrzehnt nach seinem Tod als »Holocaust« begriffenen »Zivilisationsbruch« (Dan Diner) –, das hat er, soweit es eben möglich war, vermieden.
Dass dieser Pragmatismus zu Lasten der ethischen und intellektuellen Durchdringung der gerade durchlebten Zäsur und auf Kosten der politischen Kultur des entstehenden Nachkriegsdeutschlands gehen würde, war für den routinierten Verwaltungsmann Adenauer kein Problem. Ab dem Moment, da er 1945 in Köln wieder politische Verantwortung übernahm, leitete ihn der Gedanke, dass der Neuaufbau letztlich mit den Menschen erfolgen müsse, »die da sind«. Das bedeutete nicht, dass Adenauer die säuberungspolitischen Ansprüche der Alliierten abgelehnt hätte – schon gar nicht »Nürnberg« und die justizielle Ahndung von NS-Verbrechen. Wohl aber plädierte er schon früh für ein geschäftsmäßiges Vorgehen bei der Entnazifizierung. »Man schüttet kein dreckiges Wasser aus, wenn man kein reines hat!«, lautete dazu seine auf den ersten Blick moralisch nachgerade empörende Allerweltsweisheit.[3] Dahinter aber stand die nicht verkehrte Vermutung eines breit anzutreffenden Opportunismus der Vielen – und die ausgesprochen selbstbewusste Annahme, den Wenigen von seinem Schlage und seiner Autorität werde es gelingen, in der praktischen Arbeit, in den Behörden wie in der Politik, die Spreu vom Weizen zu trennen, sprich: die hoch Belasteten und Unverbesserlichen von den anpassungswilligen »Ehemaligen«. Was eine solche Vorgehensweise in Wirtschaft und Gesellschaft, in Kultur und Wissenschaft bedeuten würde, scheint ihm nicht so wichtig gewesen zu sein.
Vor diesem Hintergrund ist auch die Causa Globke zu sehen, die Adenauers moralischer Glaubwürdigkeit, nicht zuletzt im Ausland, geschadet hat wie weniges sonst. Obgleich in diesem Fall sogar Verbindungen in den Widerstand geltend gemacht wurden und niemand daran zweifelte, dass der ewige Staatssekretär im Kanzleramt und engste Mitarbeiter Adenauers je anderes wollte, als dem Kanzler loyal zu dienen, hat dieser bemerkenswerterweise offenbar nie aufgehört, in Ambivalenzen zu denken. Jedenfalls verstand sich Adenauer, als die Kritik an Hans Globke 1956 wegen dessen Tätigkeit in der NS-Zeit (unter anderem als Mitverfasser und Kommentator der Nürnberger Rassengesetze und verantwortlicher Ministerialbeamter für die Namensänderungsverordnung von 1938) wieder einmal aufbrandete, zu einer Form der Distanzierung, die ihm schon Jahre zuvor, im Skandal um die vielen NS-Belasteten im Auswärtigen Amt, leicht über die Lippen gegangen war: »Ich für meine Person muss Ihnen sagen, ehrlich, ohne dass ich ein Urteil über diejenigen fällen will, die geglaubt haben, mitarbeiten zu müssen, ich würde nicht weitergearbeitet haben unter dem Nationalsozialismus«; er hätte das, so Adenauer im Sommer 1951 in einem seiner Teegespräche, »innerlich nicht gekonnt«.[4] Vermutlich waren solche persönlichen, über zwei Jahrzehnte zurückgestellten Bedenken im Spiel, als er nach seiner Israel-Reise 1966 ungewöhnlich offen Stellung bezog gegen die »hartnäckigen Antisemiten«, die »ewig Gestrigen« und gegen »jene, die meinen, mit der Wiedergutmachung müsse es einmal ein Ende haben, und das deutsche Volk könne sich nicht selbst zu ewiger Schuldsklaverei verurteilen«.[5]
Während seiner Kanzlerschaft blieb sich Adenauer zugleich allerdings auch stets bewusst, dass ihm Verdammungsurteile über das verflossene Regime, zumal wenn er sie mit der Frage nach Schuld und Verantwortung verbinden und realistisch beantworten würde, kein Mehr an Stimmen brächten. Hingegen half es, wenn man im Wahlkampf die Gefühle der Vertriebenen pflegte, die der soldatischen Sympathisanten verurteilter Kriegs- und NS-Verbrecher und der Angehörigen der noch immer in sowjetischer Kriegsgefangenschaft befindlichen Soldaten. Genau deshalb war im Urteil seiner Zeitgenossen nicht etwa der Abschluss der Pariser Verträge, sondern »Moskau 1955« sein größter Triumph. Die Heimkehr der letzten »Kriegsverurteilten« zahlte nicht nur auf seinen beispiellosen Wahlsieg 1957 ein, sie rechneten ihm die Deutschen noch jahrzehntelang dankbar an.
Mit der dynamischen Rente zur einzigen absoluten Mehrheit der Union
Dass er rechtzeitig vor der dritten Bundestagswahl die »dynamische« Rente eingeführt und damit zahllosen Sozialrentnern aus engster materieller Bedrängnis geholfen hatte, war der zweite große Grund für die in der Geschichte der Bundesrepublik nie mehr wieder erreichte absolute Mehrheit einer Partei. Schon damals vorgebrachte Warnungen vor Veränderungen in der demographischen Entwicklung, die das neue System gefährden könnten, wischte Adenauer beiseite.
Doch nach der 57er-Wahl, auf dem Gipfelpunkt seiner Popularität, ging es nicht mehr lange in gleicher Höhe weiter. Die Frage seiner Nachfolge drängte sich auf. Dass sie, aufs Ganze gesehen, dem mittlerweile über Achtzigjährigen noch immer kaum offen gestellt wurde, verdankte er seiner nach wie vor erstaunlich aufrechten, fast federnden Erscheinung. Mochten ihn seine Kritiker in den Medien auch als Greis titulieren: So wirkte er noch lange nicht.
Dabei verfügte Adenauer über alles andere als eine robuste Konstitution. Die schwachen Bronchien, die ihm seit seiner Jugend zu schaffen machten, zwangen ihn meist zweimal im Jahr wegen eines Infekts oder gar einer Lungenentzündung das Haus zu hüten, nicht selten mehrere Wochen lang und oft unbemerkt von der Öffentlichkeit. In seiner faktisch fragilen Gesundheit, die er im innenpolitischen Kampf wie bei internationalen Verhandlungen immer wieder bedenkenlos aufs Spiel setzte, lag auch ein Grund für seine nach heutigen Maßstäben schier endlosen Ferien in wilhelminischer Manier: im zeitigen Frühjahr und im Sommer, im Alter nicht mehr im Gebirge, sondern an der französischen Mittelmeerküste und schließlich im milden Klima der oberitalienischen Seen. Dank eines »fliegenden Kanzleramts« liefen zwar auch dort die Dienstgeschäfte weiter, aber in Cadenabbia am Westufer des Comer Sees gelang es Adenauer fast immer, sich zu regenerieren und zu entspannen, vor allem beim täglichen Boccia-Spiel.
Im Frühjahr 1959 war das nicht der Fall. Im Rückblick markiert dieser Urlaub den Anfang vom bitteren Ende seiner Kanzlerschaft. Denn mit seinem dort gereiften Entschluss, seine unmittelbar vor der Italienreise verkündete Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten wieder zurückzuziehen, zerschlug er mehr Porzellan, als in der Villa Hammerschmidt je vorhanden war. Grund für das Hin und Her, mit dem er nicht nur den amtierenden Bundespräsidenten Theodor Heuss, sondern auch seine Getreuen in der Union zutiefst irritierte, war die Erkenntnis, dass es ihm vermutlich sogar mit diesem Ämterwechsel nicht gelingen würde, sein eigentliches Ziel zu erreichen: seinen Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, den vielbewunderten »Vater des deutschen Wirtschaftswunders«, als seinen Nachfolger zu verhindern. Genau das nämlich – verbunden mit der Annahme, die großen Linien vor allem in der Außenpolitik auch als Bundespräsident weiter bestimmen zu können – hatte ihn die Rochade überhaupt erwägen lassen.
Natürlich ging es auch nach dem Fiasko weiter, waren die Machtbasis und die Autorität des »Alten« immer noch stark genug, seine jungen Verfolger in der Partei und in der Publizistik im Zaum zu halten. Aber fortan mehrten sich doch die Fehler und zeigten sich die Schwächen seiner Politik, erkannte eine sich emanzipierende Öffentlichkeit in Adenauer nun einen Mann, der in seinem Amtsverständnis und mit seinen Ansichten nicht mehr in die Zeit passte. Das »Fernsehurteil« des Bundesverfassungsgerichts, die Wiederkehr des Antisemitismus nicht nur in Köln, mit der Schändung der dortigen Synagoge, und der »unbewältigten Vergangenheit« im Jerusalemer Eichmann-Prozess, dann die im Mauerbau sichtbar werdende Perspektivlosigkeit seiner Wiedervereinigungspolitik, schließlich die Spiegel-Affäre und über allem der junge, auf Entspannung zielende amerikanische Präsident John F. Kennedy: Adenauer wirkte plötzlich unendlich alt.
Führungsstärke, die heute fehlt
Aber die Gravitas des Alters half ihm in diesen späten Kanzlerjahren auch: Als er in Charles de Gaulle einen Partner für die Aussöhnung mit Frankreich fand und als sein Treffen mit David Ben-Gurion in New York zum Zeichen der Annäherung an Israel wurde; dass er im letzten Jahr seines Lebens dorthin reisen konnte, erfüllte ihn mit Dankbarkeit.
Dass es ihm gelungen war, die Bundesrepublik entgegen allen Widrigkeiten fest im Westen zu verankern, betrachtete Adenauer selbst als seine wichtigste Leistung. Entsprechend fiel die Antwort des fast Neunzigjährigen aus, als ihn Günter Gaus zu Jahresende 1965 nach der schwersten Niederlage in seinem politischen Leben fragte: »Die bitterste Enttäuschung und der größte Rückschlag für die gesamte Politik war nach meiner Meinung der Rückschlag in der Frage der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft.«[6] Zugleich blieb sich Adenauer zeitlebens bewusst, dass dieses Scheitern nicht allein an der Absage Frankreichs lag, der Gaullisten wie der Kommunisten in der Nationalversammlung, sondern dass auch die schleppende Ratifizierung des EVG-Vertrags im Bonner Parlament dazu beigetragen hatte, das Momentum zu verpassen.
Die dramatische Aktualität der bis heute fehlenden Verteidigungsfähigkeit der Europäischen Union demonstriert das eminent Politische im Denken Adenauers. »Er hat die Bundesrepublik nicht ›gemacht‹, nicht ›geschaffen‹, hat das deutsche Volk nicht ›erzogen‹, sondern dessen westliche zwei Drittel zehn Jahre lang regiert und 14 lange Jahre beherrscht; hat Deutschland Vertrauen in den USA, in Frankreich und Israel erworben, und Selbstvertrauen«, bilanzierte »Spiegel«-Gründer Rudolf Augstein, sein früher Bewunderer, bald sein Verächter und am Ende wieder sein Verehrer, Adenauers Werk anlässlich dessen Todes am 19. April 1967. Und er fügte hinzu: »Wem das nicht reicht, dem sei gesagt: Er war ein ganz großer Häuptling.« [7]
Die Führungsstärke, die hier anklingt, wäre heute genau so bitter nötig wie zu Adenauers Zeit.
Dieser Beitrag basiert auf dem jüngsten Buch des Autors, »Konrad Adenauer. Kanzler nach der Katastrophe«, das im Verlag C.H.Beck erschienen ist.
[1] Zit. nach Günter Gaus: Zur Person. Von Adenauer bis Wehner. Porträts in Frage und Antwort, Köln 1987, S. 20.
[2] Klaus-Dietmar Henke, Adenauers Superwatergate: Mit dem BND gegen die SPD, in: »Blätter«, 5/2022, S. 112–120.
[3] Konrad Adenauer, Teegespräche 1950–1954, bearb. von Hanns Jürgen Küsters, Berlin 1984, S. 245.
[4] Ebd., S. 88 f.
[5] Konrad Adenauer, Bilanz einer Reise. Deutschlands Verhältnis zu Israel, in: »Die politische Meinung«, 11/1966, zit. nach Adenauer, Letzte Lebensjahre, Bd. 2 (September 1965 – April 1967), Paderborn 2009, S. 244.
[6] Günter Gaus, a.a.O.
[7] Jens Daniel (d.i. Rudolf Augstein), Konrad Adenauer, in: »Der Spiegel«, 23.4.1967.