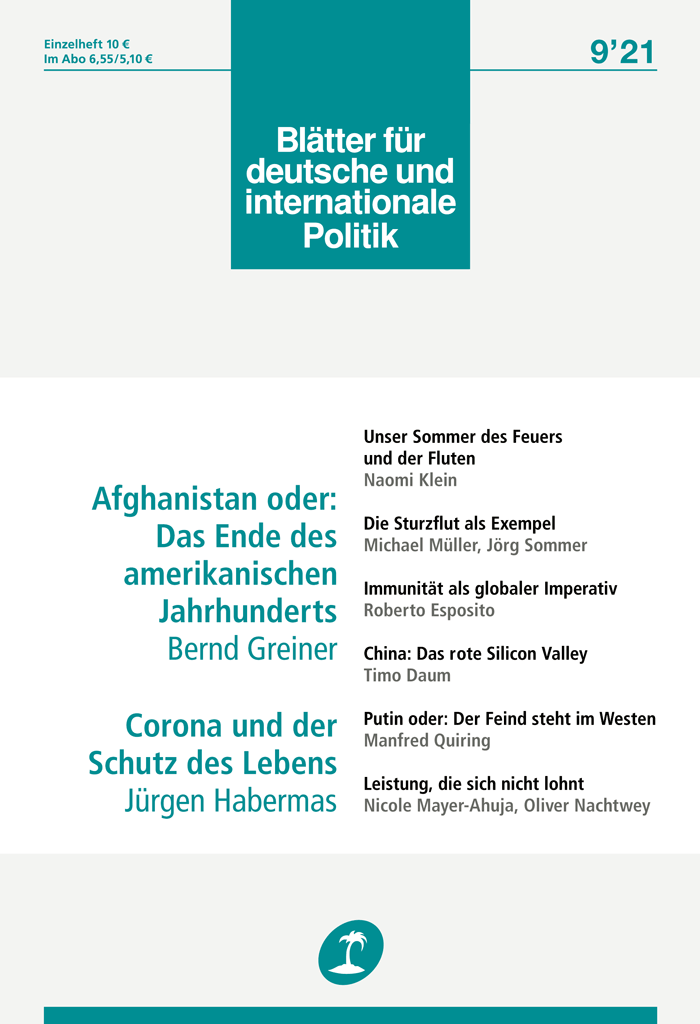Wie Arbeit in der Kohl-Schröder-Merkel-Ära entwertet wurde
Nach 16 Jahren Merkel wird jetzt allerorten Bilanz gezogen. Allerdings fällt diese nicht selten zu kurzsichtig aus. Denn die Ära Merkel steht keineswegs für sich allein, sie ist vielmehr Teil einer weit längerfristigen Entwicklung, die mit ihren Vorgängern Helmut Kohl und Gerhard Schröder einsetzte – und die noch lange nicht am Ende ist. Weit sinnvoller als auf die kurzfristigen Zustimmungswerte der Kanzlerin und ihrer potentiellen Nachfolger*innen zu starren, ist es daher, die langen Linien dieser Epoche nachzuzeichnen.
„Leistung muss sich wieder lohnen!“ Mit diesem Versprechen leitete Helmut Kohl (CDU) im Jahr 1982 das ein, was man damals die „geistigmoralische Wende“ nannte. Wer könnte sich auch der Kraft des Arguments entziehen, dass diejenigen, die Leistung erbringen, davon auch etwas haben sollen? Sehen wir uns nicht alle als Leistungsträger*innen? Und möchten wir nicht alle, dass unser Einsatz, unsere Mühen anerkannt werden, dass wir besser dastehen als diejenigen, die nichts oder weniger leisten? So weit der „gesunde Menschenverstand“. Allerdings steckte hinter dem eingängigen Plädoyer für Leistung und deren Belohnung eine problematische Agenda: eine ideologische Neudefinition dessen, was als Leistung gelten sollte, und damit einhergehend der langfristige Rückbau von sozialen Rechten. Es war der Beginn eines langen „Reformprozesses“, der in den kapitalistischen Staaten des globalen Nordens die Arbeitswelt grundlegend veränderte. Für diejenigen, die ihren Lebensunterhalt durch Lohnarbeit bestreiten mussten, indem sie ihre eigene Arbeitskraft verkauften und „abhängig beschäftigt“ waren, war das Kohlsche Versprechen keine gute Nachricht. Es begann eine Ära, in der die gesellschaftliche Norm der Leistung nachhaltig umgedeutet wurde. Die traditionelle Arbeiter*innenschaft hatte bislang einen nicht unwesentlichen Anteil ihrer Würde und ihres Stolzes aus der Tatsache bezogen, dass sie sich als Produzent*in des gesellschaftlichen Reichtums betrachtete. Eine ihrer frühen politischen Forderungen lautete: „Ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagewerk“. Darin spiegelte sich nicht nur das Leistungsprinzip, sondern auch der Wunsch nach Anerkennung. Diese Anerkennung wurde Arbeiter*innen (und auch „kleinen Angestellten“) allerdings zunehmend verwehrt. Der Produzent*innenstolz verschwand zwar nie völlig, aber er war immer schwerer aufrechtzuerhalten. Als Leistungsträger*innen galten fortan andere: Unternehmer*innen, Manager*innen, Berater*innen und all diejenigen, die Geld, Einfluss und Erfolg hatten, egal ob diese selbst erarbeitet waren.[1] Die Leistung „normaler“ Beschäftigter hingegen wurde weniger anerkannt und „lohnte sich“ weniger als zuvor. Dies gilt speziell für die Gruppen, die seit Beginn der Corona-Pandemie gerne als „Held*innen des Alltags“ bezeichnet werden. Wie konnte das passieren?
Fünf Zusammenhänge
Erstens wurde der Appell, dass Leistung sich wieder lohnen müsse, schnell in Forderungen nach einer Senkung von Steuern übersetzt. Ausgehend von der gewagten Annahme, dass Vermögen schon irgendetwas mit besonderen Leistungen zu tun haben müsse, verzichtete der Staat auf erhebliche Steuereinnahmen. Dieses Geld fehlte in den folgenden Jahren für die Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen. Dies hatte (zweitens) direkte Auswirkungen auf die Arbeit in öffentlichen Diensten und deren Bedingungen. In staatlichen Krankenhäusern, Kindertagesstätten oder Einrichtungen der Jugendhilfe wurden die Budgets gekürzt, insbesondere die Personalkosten sollten sinken. Erreicht wurde dies oft durch die Auslagerung von Tätigkeiten an Subunternehmen, ein Trend, der auch in der Privatwirtschaft vielerorts stark ausgeprägt war. Wenn etwa Gebäude nicht mehr durch eigene Angestellte gereinigt werden, die Wäsche nicht mehr durch „eigene Leute“ gewaschen und das Essen nicht mehr durch sie gekocht wird, sondern durch das Personal einer Fremdfirma, werden häufig deutlich geringere Löhne gezahlt oder „Minijobs“ eingerichtet, für die keine Sozialversicherungsabgaben anfallen. Selbst dort, wo staatliche Einrichtungen weiterhin eigene Beschäftigte einsetzen, wird in Zeiten leerer öffentlicher Kassen oft am Personal gespart, weshalb die vorhandene Belegschaft immer mehr Arbeit in immer kürzerer Zeit zu leisten hat. Und private bzw. privatisierte Einrichtungen, die weniger Arbeitskraft einsetzen und entsprechend billigere Angebote unterbreiten können, legen damit Standards fest, an denen auch öffentliche Einrichtungen gemessen werden. Kurz: Die steuerliche Entlastung von Vermögenden trug zur massiven Reduzierung öffentlicher Dienstleistungen bei. Zugleich schlug sie sich in deutlich schlechteren Arbeits- und Lebensbedingungen für viele derjenigen nieder, die weiterhin für den Staat tätig sind oder in Unternehmen arbeiten, die privatisiert wurden und ihre Personalkosten durch die Einrichtung prekärer Jobs und die Steigerung des Arbeitsdrucks senkten.
Drittens wurde das soziale Sicherungssystem, das Beschäftigte gegen die Risiken der Lohnarbeit absichern soll, zurückgeschnitten. Damit Leistung sich wieder lohnt, so die Argumentation der Verantwortlichen, sollten Unternehmen und Beschäftigte, die sich etwa im deutschen System die Beiträge zur Sozialversicherung teilen, gleichermaßen entlastet werden. Für Unternehmen war die Senkung der als „Lohnnebenkosten“ verunglimpften Sozialabgaben eine ungetrübte finanzielle Erleichterung: In dem Maße, in dem die Personalkosten sanken, stiegen die Gewinne. Für Beschäftigte hingegen bedeutete die Durchsetzung von „mehr Netto vom Brutto“, dass sie im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit oder im Alter immer weniger Unterstützung bekamen. Die Koppelung der Lohnarbeit an soziale Sicherung, die nach dem Zweiten Weltkrieg in fast allen kapitalistischen Staaten ausgebaut worden war, wurde dadurch deutlich geschwächt. Die Leistung, die abhängig Beschäftigte im Laufe ihres Erwerbslebens erbringen, lohnt sich seit der Umstellung auf eine „Sozialpolitik der mageren Jahre“ immer weniger.[2]
Viertens begannen staatliche Stellen ab den 1980er Jahren, den Druck auf Arbeitslose zu erhöhen, damit sie möglichst schnell auf den Arbeitsmarkt zurückkehrten und weniger Leistungen der Arbeitslosenversicherung in Anspruch nahmen. Die Beitragszahler*innen sollten, wie es hieß, sicher sein können, dass sich ihre Leistung insofern lohnte, als mit ihren Geldern kein Missbrauch getrieben wurde. Oder, wie es der damalige deutsche Arbeitsminister Franz Müntefering (SPD) im Jahr 2006 formulierte: „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.“ Mit der sogenannten aktivierenden Arbeitsmarktpolitik wurde dafür gesorgt, dass Arbeitslose sich so intensiv wie möglich um einen neuen Job bemühen – wer das nicht will oder kann (also nach Maßstäben der Arbeitsagentur keine ausreichende Leistung bringt), muss eine Kürzung der Unterstützungszahlungen oder andere Sanktionen hinnehmen. In Deutschland wurde dieses System im Zuge der Hartz-Reformen zwischen 2003 und 2005 eingeführt. Auf Bezieher*innen von Arbeitslosengeld oder Grundsicherung wird seither deutlich mehr Druck ausgeübt. Wer arbeitslos wird, muss sich permanent auf Stellen bewerben, auch auf solche, die unterhalb der eigenen Qualifikation und des bisherigen Einkommens liegen.
Auch dank dieser staatlichen Arbeitsmarktpolitik fanden, fünftens, Unternehmen selbst für unattraktive Jobs genügend Interessent*innen. In der Privatwirtschaft wurde es üblich, prekäre Randbelegschaften aufzubauen und/oder Teile des Produktions- oder Dienstleistungsprozesses an Subunternehmen auszulagern. Gerade dort, wo ganze Subunternehmer-Pyramiden aufgebaut wurden, gewannen Leiharbeit und Scheinselbstständigkeit an Bedeutung. Unter diesen Bedingungen wuchs der Niedriglohnsektor in Deutschland rasant – er umfasste 2017 (unter Berücksichtigung von Nebentätigkeiten) etwa jede*n vierte*n abhängig Beschäftigte*n.[3] In dem Maße, in dem die Prekarisierung von Arbeit voranschritt, machte eine immer größere Zahl von Menschen die Erfahrung, dass ihnen im Job immer mehr Leistung abverlangt wurde, die sich (in Sachen Einkommen, Beschäftigungssicherheit oder Lebensplanung) immer weniger lohnte.
Es gibt offenkundig ein dreifaches Problem mit der Rede von Leistungsträger*innen. Zum einen wird selten klar definiert, worin „Leistung“ eigentlich besteht. Ist es Ausdruck von Leistungsfähigkeit, ein großes Vermögen geerbt zu haben – oder zeigt sie sich darin, dass man selbst unter schwierigsten Bedingungen gesellschaftlich nützliche Arbeit erbringt? Und was ist eigentlich gesellschaftlich nützliche Arbeit? Zum anderen wurde die Frage, woran man Leistung messen kann, im Laufe der Zeit sehr unterschiedlich beantwortet. Seit den 1980er Jahren wurde Leistung immer weniger an der Dauer einer Tätigkeit und dem dafür notwendigen Aufwand festgemacht, sondern an deren Marktergebnis. Damit wurden Formen von Arbeit materiell und symbolisch entwertet, die vermeintlich einfach waren, aus Routinetätigkeiten bestanden, die anstrengend und ermüdend, aber nicht immer sichtbar waren. Dies ist deshalb von so großer Bedeutung, weil das Leistungsprinzip in kapitalistischen Gesellschaften eine der wichtigsten Normen für die Verteilung von Lebenschancen, Reichtum und Macht darstellt – und umgekehrt das zentrale Argument für die Rechtfertigung sozialer Ungleichheiten ist.
Drittens wird „Leistung“ im Zuge der „Reformen“ von Arbeitsmarkt und sozialem Sicherungssystem, die wir seit Jahrzehnten erleben, im Wesentlichen als individuelle Eigenschaft verhandelt. Und wer Leistung bringt, soll belohnt werden. Leistung hat aber gesellschaftliche Voraussetzungen: Wer welche Leistungen erbringen kann, hängt (abgesehen von Arbeitsmarktdynamiken, sozialer Sicherung und öffentlicher Infrastruktur) nicht zuletzt auch vom familiären und weiteren sozialen Umfeld ab, aus dem man stammt, also von der Unterstützung durch Familie und soziale Netzwerke. Diese bestimmen (in den Begrifflichkeiten von Pierre Bourdieu) wiederum, welches ökonomische, soziale und kulturelle Kapital man jeweils hat. Deshalb müssen wir über Dynamiken der Klassengesellschaft sprechen, also über die Scheidelinie zwischen Kapital und Arbeit, aber auch über die vielfältigen Gräben, welche die immer weiter wachsende Gruppe der abhängig Beschäftigten und Alleinselbstständigen durchziehen, die eben kein Kapital besitzen und deshalb vom Verkauf ihrer Arbeitskraft leben (müssen). „Verkannte Leistungsträger*innen“, das hat die Coronakrise gezeigt, sind letztlich diejenigen, die in ihrer Arbeit große Leistungen erbringen, deren Position in der Klassengesellschaft dies jedoch nicht angemessen widerspiegelt.
Tatsächlich traf die Coronakrise die Gesellschaft wie ein Blitz, und in seinem grellen Licht stellen sich die Verhältnisse in der Arbeitswelt auf ungewohnte, aber höchst erhellende Weise dar. Das Bild verhält sich wie ein Negativ zur normalen Fotografie. Plötzlich war die sonst unsichtbare Arbeit der Leistungsträger*innen sichtbar geworden. Jene Berufe und Tätigkeiten, die für gewöhnlich kaum wahrgenommen werden, wurden als unmittelbar „systemrelevant“ anerkannt. Kein Weg ging mehr an der Erkenntnis vorbei, dass insbesondere in den Sektoren Gesundheit, Logistik, Sicherheit und Ernährung Menschen tagtäglich buchstäblich unverzichtbare Arbeit leisten. Krankenpfleger*innen und Reinigungskräfte, Post und Transportarbeiter*innen, Verkäufer*innen und Regalauffüller*innen in Lebensmittelgeschäften, Erzieher*innen, Arbeiter*innen in der Ernährungsindustrie und auch Landarbeiter*innen, ohne die der geliebte Spargel oder die Erdbeeren nicht auf den heimischen Tisch gelangen, halten den Alltag in der pandemiebedingten Krise am Laufen. Ohne sie geht (fast) nichts mehr.
Wer von „Systemrelevanz“ spricht, will damit meist nur betonen, dass es hier um gesellschaftlich sehr nützliche Arbeit geht. Schaut man sich den Begriff jedoch ein wenig genauer an, stellt sich die Frage, was „das System“ ausmacht, für das die genannten Beschäftigtengruppen von so hoher Relevanz sind. Offenkundig handelt es sich bei diesem System um den Kapitalismus, also um eine besondere Form, das Zusammenwirken von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu organisieren.
Damit die Wirtschaft läuft, müssen Menschen arbeiten
Im Mittelpunkt steht dabei die Produktion von Waren, durch deren Herstellung und Verkauf das eingesetzte Kapital immer weiter vergrößert wird, indem man durch den Einsatz fremder Arbeitskraft Mehrwert schafft, sich einen möglichst großen Teil davon aneignet und dadurch Gewinne erzielt. Insofern ist es nicht erstaunlich, dass bislang vor allem Berufe und Tätigkeiten als systemrelevant galten, die entweder für die Produktion oder für die Vermarktung von Waren besonders wichtig sind. Wenn in den Jahren der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2008 von Systemrelevanz gesprochen wurde, ging es etwa in Deutschland meist um die exportorientierte Industrie (etwa die Automobilbranche) oder um die Finanzwirtschaft. Manager*innen, Banker*innen oder Berater*innen galten als die zentralen Leistungsträger*innen. Aber kapitalistisches Wirtschaften hat gesellschaftliche Voraussetzungen, die tagtäglich wiederhergestellt werden müssen.
Damit die Wirtschaft läuft, müssen Menschen arbeiten. Sie müssen ihre Arbeitskraft und ihre Leistungsfähigkeit immer wieder neu herstellen, indem sie essen und schlafen, sich vom Arbeitsalltag oder auch von Krankheiten erholen, neue Kenntnisse erwerben, Anregungen sammeln usw. Wenn man den Blick über den oder die Einzelne*n hinaus richtet, gehören selbstverständlich auch die Geburt, Betreuung und Erziehung von Kindern sowie die Pflege von Kranken oder Alten zu den notwendigen Prozessen der (Wieder-)Herstellung bzw. der Reproduktion von Arbeitskraft. Jene Tätigkeiten aber, die (oft im Dienstleistungsbereich) dazu beitragen, nicht nur Arbeitskraft, sondern auch die gesellschaftlichen Verhältnisse und Beziehungen zu reproduzieren, auf denen kapitalistisches Wirtschaften beruht, genossen bislang meist wenig gesellschaftliche Anerkennung.
Wer durch seine oder ihre Arbeit den Erhalt oder die Wiederherstellung von Gesundheit, die Erziehung von Kindern, die Pflege von Alten oder die Versorgung mit den Notwendigkeiten des täglichen Lebens gewährleistet und so das System am Laufen hält, ist gesellschaftlich nur wenig sichtbar und arbeitet zudem besonders oft unter prekären Bedingungen. Viele Beschäftigte können von ihrer Vergütung kaum die eigene Existenz sichern und haben (manchmal mehrere) Jobs, die auf kurzfristigen Verträgen beruhen, durch Vorgesetzte und Kund*innen streng kontrolliert werden und wenig Raum für Stolz auf die eigene Leistung lassen. Diese Arbeiten sind oft besonders hart, sie werden besonders wenig honoriert und sie sind besonders „systemrelevant“. Anders als die „Bullshit Jobs“, die David Graeber aufs Korn genommen hat, sind diese Tätigkeiten gesellschaftlich hochgradig nützlich. Es handelt sich in der Regel um Dienstleistungen, die den reibungslosen Ablauf des gesellschaftlichen Alltags gewährleisten: Um im Supermarkt einkaufen zu können, muss nicht nur jemand an der Kasse sitzen, sondern der Supermarkt muss auch regelmäßig gereinigt werden, und die Konservendosen finden trotz Digitalisierung noch immer nicht von allein den Weg ins Regal. Weil es bei solchen Tätigkeiten vor allem darum geht, „normale“ Abläufe und Routinen zu gewährleisten, bleiben sie häufig unsichtbar – sie werden erst als notwendig erkannt, wenn sie ausbleiben. Spätestens im Zeichen der Corona-Pandemie ist jedoch klar geworden: Wenn Kranke nicht gepflegt, Lebensmittel nicht produziert, transportiert und verkauft oder Kinder nicht betreut werden, bricht das System zusammen. Auf die Krankenschwester können wir nicht verzichten, auf den Berater oder die Produktion von Autos zeitweise schon.
Der Umstand, dass besonders im Frühjahr 2020, während des ersten Lockdowns, den damals sogenannten Held*innen des Alltags, die sich stärkeren Infektionsrisiken ausgesetzt sahen als andere Berufsgruppen,[4] regelmäßig von den Balkonen applaudiert wurde, hat allerdings bislang nicht dazu geführt, dass sich ihre Löhne, ihre Arbeitsbedingungen oder ihre gesellschaftliche Position wesentlich verbessert hätten. Die neue Einsicht in die Systemrelevanz der Tätigkeiten diente hingegen vor allem als Argument dafür, den Zugriff auf die nun als unverzichtbar geltende Arbeitskraft auszuweiten. Sie führte allenfalls zu einer kurzfristigen moralischen Aufwertung, nicht aber zu substanziellen Verbesserungen für die Beschäftigten. Schon im zweiten Lockdown (ab November 2020) war dann selbst von der öffentlichen Sympathie nicht mehr viel zu spüren. Wer an der Supermarktkasse saß, konnte kaum noch mit kleinen Geschenken oder warmen Worten rechnen, sondern sah sich der zunehmend gereizten Stimmung vieler Kund*innen ausgesetzt, die unter Social Distancing litten und zum Beispiel den Einkauf nutzten, um Dampf abzulassen. Die „Held*innen des Alltags“ mögen nun als systemrelevant gelten, unterbezahlt, schlecht abgesichert und sozial zu wenig geachtet bleiben sie jedoch weiterhin.
Was tun?
Generationen von Beschäftigten haben die Erfahrung gemacht, dass eine „Aufwertung“ von Lohnarbeit nur gelingen kann, indem man sich zusammenschließt und Interessen gemeinsam durchsetzt. Das ist aber keineswegs selbstverständlich, denn kapitalistisches Wirtschaften beruht auf Differenz und Konkurrenz: zwischen Unternehmen, Standorten, Stamm- und Randbelegschaften sowie zwischen Männern und Frauen, Jungen und Alten, Menschen unterschiedlicher Herkunft, die in der Klassengesellschaft eher gegen- als miteinander um Jobs und Lebenschancen kämpfen.
Seit Jahrzehnten sind die Gräben zwischen Arbeitenden durch die Politik von Unternehmen und Staat weiter vertieft worden; die materiellen Grundlagen von Solidarität (in Form von Arbeitsrechten, sozialer Sicherung, planbaren Berufswegen usw.) wurden systematisch zerstört. Und gerade die „verkannten Leistungsträger*innen“ sind besonders selten gewerkschaftlich organisiert. Das ist kein Zufall, denn mit Niedriglohn muss man sich den Gewerkschaftsbeitrag vom Mund absparen; man wechselt oft zwischen Branchen und Unternehmen, und wer für Kranke oder Kinder Verantwortung trägt, streikt selten, um sie nicht im Stich zu lassen. Daher ist das Hauen und Stechen, das gern als „Wettbewerb“ verniedlicht wird, die Regel – und ein gemeinsames Eintreten für Rechte und Würde eine immer wieder neu zu erkämpfende Ausnahme. Trotzdem hat sich in der Pandemie gezeigt, dass eine solidarische Politik möglich wäre, die trotz aller objektiven Konkurrenz verschiedene Gruppen von Arbeitenden zusammenbringt. So haben sehr unterschiedliche Beschäftigte ähnliche Erfahrungen gemacht: Mit weiter steigendem Arbeitsdruck – im Homeoffice wie bei den „Held*innen des Alltags“. Mit der fortschreitenden Polarisierung von Arbeitszeiten, weil manche immer länger arbeiten müssen, während andere isoliert zu Hause sitzen, nachdem sie den Minijob verloren oder als Alleinselbstständige keine Aufträge mehr haben.
Der schnelle Absturz droht, wenn das Einkommen ganz oder teilweise wegfällt und die Auffangnetze nicht halten, weil man als Minijobber*in oder Alleinselbstständige*r weder Arbeitslosen- noch Kurzarbeitergeld bekommt oder als Niedriglöhner*in von Letzterem nicht leben kann. Gerade hier kann eine Politik ansetzen, die ganz unterschiedliche Teile der arbeitenden Klasse verbindet: etwa durch eine Arbeitszeitverkürzung mit Lohn- und Personalausgleich als Beitrag zur Neuverteilung von Zeit und gesellschaftlichem Reichtum, durch die Abschaffung von Minijobs und die Einführung von Sozialversicherungsschutz für alle oder durch eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns, um „Armut trotz Arbeit“ zu verhindern. Solche Projekte können unterschiedliche Gruppen von Beschäftigten mobilisieren, die sonst wenig miteinander zu tun haben. Statt moralischer Appelle für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt braucht es innovative Ansätze von Klassenpolitik, um Solidarität zwischen Arbeitenden herzustellen und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der sich gesellschaftlich nützliche Arbeit endlich lohnt.
Die Bedingungen für eine solche Politik sind derzeit nicht ungünstig. Zwar zählen abhängig Beschäftigte in der Regel nicht zu den Gewinner*innen der Pandemie, aber einige von ihnen konnten für einen kurzen Moment spüren, dass ihre Stellung in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung potentielle Macht bedeutet. Um die Situation von Arbeitenden tatsächlich zu verbessern, braucht es jedoch eine grundlegende Erneuerung der Demokratie. Das gilt für den politischen Prozess, wo die Anliegen der arbeitenden Klasse in den vergangenen Jahren kaum Gehör fanden, aber auch und vor allem für die Verfassung von Unternehmen. In ihrem Innern herrscht eine „private Regierung“, wie es die US-amerikanische Philosophin Elizabeth Anderson nennt.[5] Diese kontrolliert die Tätigkeiten der Arbeitenden im Detail und wird – insbesondere wo Betriebsräte fehlen und Gewerkschaften schwach sind – kaum demokratisch kontrolliert. In der Pandemie wurde jedoch mehr als deutlich, dass Arbeit keine Privatsache ist. Stattdessen sind die Ausbeutung von Menschen auf Spargelfeldern, in Schlachthöfen und bei Amazon wie auch schlechte Arbeitsbedingungen in der Krankenpflege eine öffentliche Angelegenheit.
Für eine neue Klassenpolitik
Moderne Klassenpolitik ist deshalb auch Bürgerrechtspolitik. Der britische Soziologe T. H. Marshall hat Mitte des 20. Jahrhunderts skizziert, wie Bürgerrechte in der (britischen) Klassengesellschaft schrittweise ausgebaut wurden: Nach zivilen Rechten wie Redefreiheit, freier Berufswahl und Vertragsfreiheit kamen politische Rechte wie das allgemeine Wahlrecht und soziale Rechte durch den Wohlfahrtsstaat hinzu, welche laut Marshall die „Fußbodenhöhe im Keller des sozialen Gebäudes“[6] anhoben. Diese Entwicklung hat sich nicht fortgesetzt, sondern wurde in den vergangenen Jahrzehnten teilweise sogar umgekehrt: Durch die Prekarisierung von Arbeit, den Ausbau des Niedriglohnsektors, die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen und Dienstleistungen sowie tiefe Einschnitte im Bereich der sozialen Sicherung ist Wasser in den Keller eingedrungen und sind die Fundamente marode geworden. Eine neue Klassenpolitik beinhaltet daher auch das Streiten für wirtschaftliche Bürgerrechte. Sie müssten für alle Menschen gelten, die hierzulande arbeiten, da eine Bindung an die Staatsbürgerschaft nur neue Ausschlüsse produzieren würde. Wirtschaftliche Bürgerrechte würden etwa einen Lohn umfassen, der zum Leben reicht, den Zugang zu sozialer Sicherung für alle ermöglichen und einen markanten Ausbau der Mitbestimmung in Unternehmen vorsehen.
Wirtschaftliche Bürgerrechte müssen aber auch das Leben von Arbeitenden außerhalb der Erwerbssphäre regulieren. Sie sollten ein Moratorium für Mietensteigerungen und einen garantierten Zugang zu Strom, Wasser und Internet festlegen. Das Gesundheitswesen sollte zudem dem Markt entzogen und Großunternehmen verpflichtet werden, ihre wirtschaftliche Tätigkeit am Allgemeinwohl auszurichten. All das wären Elemente eines Infrastruktursozialismus, der für Arbeitende insgesamt – und gerade auch für die verkannten Leistungsträger*innen unter ihnen – deutlich bessere Bedingungen schaffen kann, sich ohne Existenzangst für ein Arbeiten und Leben in Würde einzusetzen. Damit würden wir noch nicht die Klassengesellschaft überwinden, es wäre aber ein wichtiger Schritt in diese Richtung.
Der Beitrag basiert auf „Verkannte Leistungsträger:innen: Berichte aus der Klassengesellschaft“, dem jüngsten Buch der Autorin und des Autors, das soeben im Suhrkamp Verlag erschienen ist.
[1] Sighard Neckel, Flucht nach vorn: Die Erfolgskultur der Marktgesellschaft, Frankfurt am Main und New York 2008.
[2] Manfred G. Schmidt, Sozialpolitik in Deutschland. Historische Entwicklung und internationaler Vergleich, Opladen 1998.
[3] Markus Grabka und Carsten Schröder, Der Niedriglohnsektor in Deutschland ist größer als bislang angenommen, DIW-Wochenbericht 14/2019, www.diw.de, S. 252.
[4] Hajo Holst, Agnes Fessler und Steffen Niehoff, „Covid-19, Social Class and Work Experience in Germany: Inequalities in Work-related Health and Economic Risks“, in: „European Societies“, sup1/2021, S. 495-512.
[5] Elizabeth Anderson, Private Regierung. Wie Arbeitgeber über unser Leben herrschen (und warum wir nicht darüber reden), Berlin 2019.
[6] Thomas H. Marshall, Bürgerrechte und soziale Klassen. Zur Soziologie des Wohlfahrtsstaates, Hg. von Elmar Rieger, Frankfurt und New York 1992 [1949].