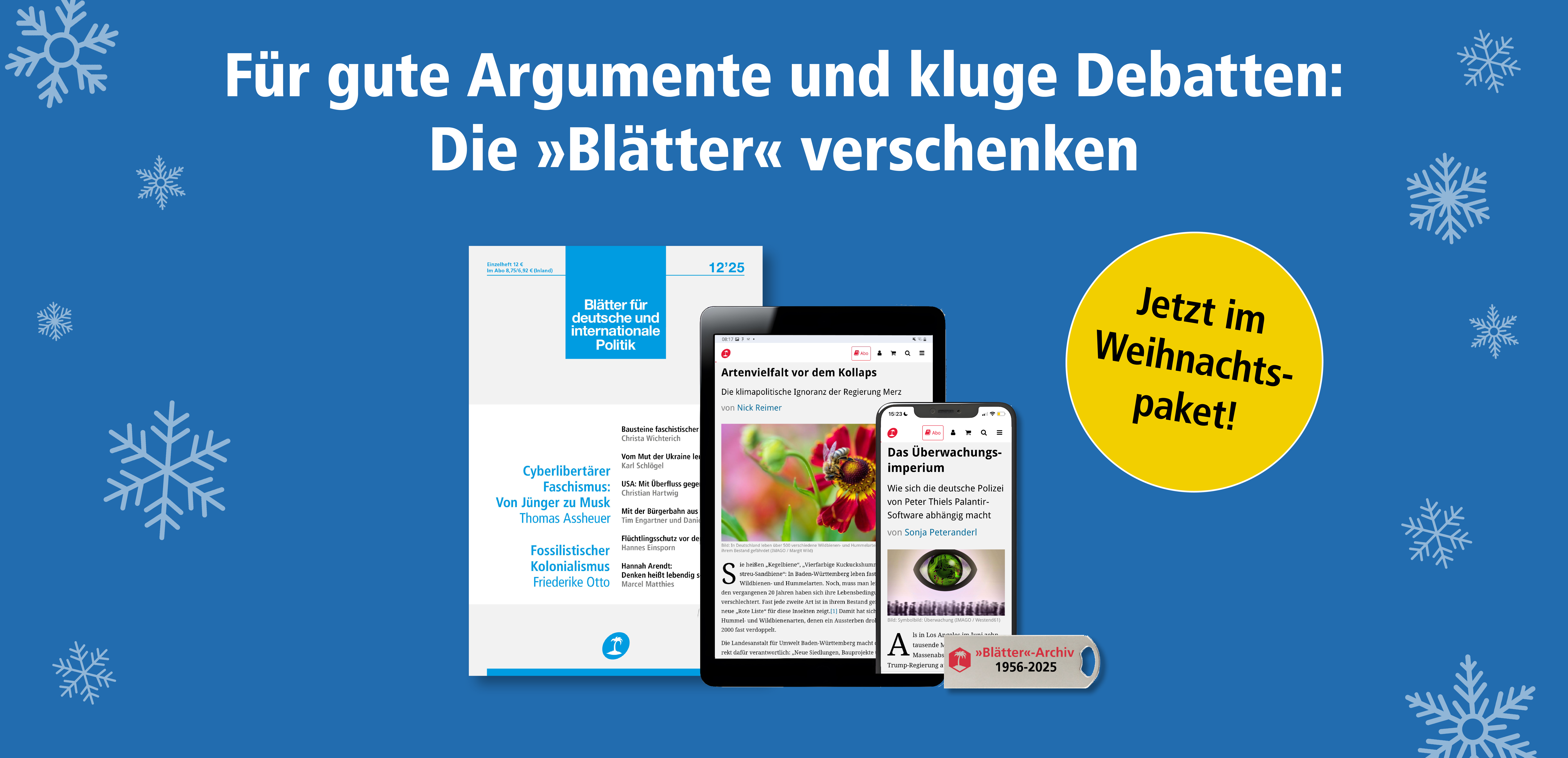Bild: Protest gegen die Umweltzerstörung durch den neuen »Tren Maya« in Playa del Carmen, 6.3.2022 (IMAGO / Eyepix Group / Natalia Pescador)
Es ist das Prestigeprojekt des in diesem Jahr scheidenden mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador (Amlo): der „Tren Maya“, eine 1500 Kilometer lange Bahnstrecke quer durch Mexikos Südosten, die fünf Bundesstaaten, deren größte Städte und die wichtigsten prähispanischen archäologischen Stätten verbindet und auf der Tourist:innen sowie Güter transportiert werden sollen. Drei Millionen Fahrgäste pro Jahr sollen mit dem Zug reisen können und 100 000 neue Arbeitsplätze entstehen. Kein vergleichbares „Meisterwerk“ auf dieser Welt sei in einer solchen Rekordzeit fertiggestellt worden, prahlte Amlo noch auf der Pressekonferenz zur Einweihung des ersten Streckenabschnitts am 15. Dezember 2023 – nur vier Jahre nach Baubeginn.[1]
Der Präsident sieht in der Bahnstrecke gar einen historischen Eckpfeiler der sogenannten vierten Transformation, einer mexikanischen Fortschrittserzählung, die von der Unabhängigkeit im Jahr 1821 über die Reformzeit und die Revolution (1910-1920) bis in die Gegenwart reicht. Die mit dem Tren Maya verknüpfte linksnationalistische Erzählung verspricht nicht weniger als die „Wiedergeburt Mexikos“[2], Wohlstand für die lokale Bevölkerung und die sozial verträgliche ökologische Transformation einer ganzen Region.
Doch aufgrund zahlreicher technischer und rechtlicher Hindernisse sowie des demokratischen Widerstands der Zivilgesellschaft vor Ort stagniert die Vollendung von Amlos „obra magna“, wie er das Projekt selbst nennt. Denn das Selbstverewigungsprojekt des 70-Jährigen erweist sich zunehmend als brachialer Akt gegen Menschen und Umwelt.
Nach der pompösen Eröffnung des ersten Teilabschnitts Mitte Dezember ist es denn auch stiller geworden um den Tren Maya. Die ersten Züge rollen zwar, aber sie rollen langsam, Verzögerungen im Betrieb häufen sich. Und der heftig umkämpfte letzte Streckenabschnitt entlang der Karibikküste ist im vorgesehenen Zeitplan nicht mehr zu verwirklichen. Die lautstarken Bedenken von Umweltexpert:innen zwangen selbst den scheinbar unbeirrbaren Amlo, das ehrgeizige Ziel aufzugeben, die Zugstrecke bis Ende Februar fertigzustellen. Und das, obwohl der Präsident seit Baubeginn kritische Stimmen systematisch übergeht. Mehr noch: Immer wieder polemisierte Amlo gegen die Kritiker:innen des Projekts. Das ist fatal in einem Land, das eine der höchsten Mordraten an Umweltaktivist:innen weltweit aufweist.[3]
Dabei soll der Zug offiziell den in der Agenda 2030 vereinbarten Nachhaltigkeitszielen dienen. Im Vordergrund stehen dürften für Amlo allerdings eher wirtschaftliche Erwägungen: Als klassisches Fortschritts- und Modernisierungsprojekt soll der Tren Maya die wirtschaftliche Entwicklung des ländlichen Südosten Mexikos vorantreiben sowie die Wettbewerbsfähigkeit des mexikanischen Tourismussektors stärken. Die insgesamt 34 Stationen, von denen zwölf noch nicht in Betrieb sind, sollen dabei als „Entwicklungspole“ fungieren, die in die Region ausstrahlen und einen ganzheitlichen wirtschaftlichen Aufschwung erzeugen. Die 130 Ortschaften entlang der Bahnstrecke werden, so das Versprechen, von zahlreichen Infrastrukturprojekten wie Straßenreparaturen, neuen Stromleitungen und Kanalisationssystemen sowie Gewerbe- und Wohnflächen profitieren.
Kritker:innen sehen im Tren Maya dagegen einen reinen Tourist:innenzug, dessen Bau die Umwelt massiv belaste. Sie beklagen den mit seiner Errichtung einhergehenden Ausverkauf der kulturellen und ökologischen Vielfalt der Region. Laut dem mexikanischen Zentrum für Umweltrecht (Cemda) wurden bereits 2500 Hektar Regen-
wald für das Projekt gerodet, ganze 23 Naturschutzgebiete sind davon betroffen. Darunter auch die wichtigste Wasserquelle der Region, das teils unter- und teils überirdische System von Karstgesteinshöhlen sowie das Naturreservat Calakmul mit seiner großen Artenvielfalt.
Diese wertvollen Ökosysteme könnte der Tren Maya schwer beschädigen und die traditionellen Austausch- und Wanderungsbewegungen zwischen ihnen behindern. Das aber nimmt die Regierung in Kauf, auch wenn immerhin einige Streckenabschnitte aufgrund von Umweltbedenken verändert wurden. Die Sorgen von Zweifler:innen versucht die Regierung etwa mit dem Wiederaufforstungsprogramm „Sembrando Vida“ zu zerstreuen, das diesen die guten Absichten zum Erhalt der Biodiversität und Artenvielfalt vor Augen führen soll. Aus Sicht von Umweltschützer:innen handelt es sich dabei allerdings um ein Blendwerk, das nicht einmal den von der Regierung selbst gesetzten Ansprüchen an die Nachhaltigkeit gerecht werde.
Auch bei den obligatorischen Konsultationen der indigenen Gemeinden der Region, durch deren Territorien große Teile der Strecke verlaufen, wurden wichtige Informationen über ökosystemische Veränderungen unterschlagen, weshalb das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte in Mexiko den Beteiligungsprozess für unzureichend erklärte.[4] Und in der Region Quintana Roo, wo nun der dritte und letzte Streckenabschnitt fertiggestellt werden soll, fehlt eine staatlich zertifizierte Umweltprüfung für ein 42 Kilometer langes erhöhtes Viadukt, das ein Karstgebiet mit mehr als 100 Höhlen und Cenoten durchqueren soll. Weil Expert:innen vor einer Verunreinigung des Grundwassers und aufgrund der Installation tausender Stahl- und Betonpfähle in dem porösen Gestein vor Einsturzgefahr warnen, wurde der Bau vorläufig gestoppt.
Neuordnung einer ganzen Region
Es handelt sich bei dem Tren Maya also längst nicht mehr um das ökologisch unbedenkliche Bahnprojekt, als das es Amlo einst bezeichnete, sondern um ein nationales Entwicklungsprojekt, das eine massive „territoriale Restrukturierung“[5] der gesamten Region nach sich zieht. Und diese wird notfalls auch mit autoritären Mitteln durchgesetzt.
Besonders deutlich wird die Neuordnung der Region anhand der Aufweichung des sogenannten Ejido-Systems, das vornehmlich in ländlichen Regionen Mexikos existiert. Diese genossenschaftlich organisierten Agrargemeinschaften wurden im Zuge der mexikanischen Revolution erstritten und schließlich als eine Art gesellschaftliches Eigentum institutionalisiert. Das System sieht vor, dass die Ejiditarios, die genossenschaftlichen Anteilseigner:innen an den Landparzellen (Ejidos), über die Landnutzung und deren Veränderung abstimmen müssen. Mehr als die Hälfte der Zugstrecke passiert solches Ejido-Territorium.[6] Über den Bau von Straßen, Hotels und anderer Infrastruktur entlang der Zugstrecke muss die Regierung also mit den Ejiditarios verhandeln. Um eine Enteignung der Ejidos zu umgehen, stellte die Regierung ihrem Projekt einen Infrastruktur- und Immobilienfonds zur Seite – ein Finanzierungsinstrument, das auf den Kapitalmärkten gehandelt wird. Anstatt ihr Land zu verkaufen, können die Ejiditarios dieses an die Inverstor:innen vermieten und auf diese Weise „Partner“ des Projekts werden. Das aber bedeutet: Wo vormals die Kontrolle über das Land in kommunaler, gemeinschaftlicher Hand lag, werden die Ejido-Parzellen nun in die Marktlogik eines globalen finanzialisierten Kapitalismus eingespeist, womit zugleich der Einfluss transnationaler Unternehmen, die in das Projekt investieren, gestärkt wird.
Laut Guillermo D‘Christy, langjähriger Umweltaktivist, sind bereits mehr als 500 Immobilienprojekte allein rund um die auf der Bahnstrecke liegende Maya-Stadt Tulum an der Karibikküste geplant oder bereits im Bau. Dies bedeute nicht nur zusätzliche Abholzung und Bevölkerungszuwachs, sondern auch eine Verschärfung der ohnehin schon dramatischen Wasserknappheit.[7]
Folglich entpuppt sich die mexikanische Regierung als Kollaborateurin ebenjener neokolonialen Kräfte, deren Einfluss sie eigentlich zurückzudrängen vorgibt. Transnationale Unternehmen und Investor:innen wie etwa die spanische Bahngesellschaft Renfe oder eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, aber auch große Banken und Hotelketten wurden von Anfang an umworben und sind längst Teil des Projekts. Statt einen Bruch mit dem neoliberalen Paradigma zu vollziehen, setzt Amlo die seit den 1980er Jahren voranschreitende Liberalisierung fort, wenn auch unter postneoliberalen Vorzeichen: Neoliberale Politik wird dabei zum vermeintlichen „Wohle der Bevölkerung“ und im Namen des „nachhaltigen Wachstums“ durchgesetzt, während die negativen Auswirkungen ebenjener Politik durch das Aufsetzen umfangreicher Sozialprogramme aufgefangen werden sollen.[8]
Mexikanischer Postneoliberalismus
Insofern ist der Tren Maya ein Sinnbild für diesen mexikanischen „Postneoliberalismus“, der mit einem linkspopulistischen und zunehmend autoritären Politikstil einhergeht. Dabei wird ein starker paternalistischer Staat beschworen, der die in den 1990er Jahren privatisierte mexikanische Eisenbahn wieder in die öffentliche Hand überführen möchte und dem Ausverkauf von Land und Gemeingütern an ausländisches Kapital einen Riegel vorzuschieben gelobt – was sich im Falle des Ejido-Systems als Farce erweist.
Mit der Durchführung seines „Jahrhundertprojekts“ beauftragte Amlo zudem das Militär, das den Zug auch betreiben und die durch ihn generierten Einnahmen erhalten soll. Im Schatten der Coronapandemie hatte er das gesamte Vorhaben per Nationaldekret gar zur Angelegenheit „nationaler Sicherheit“ erklärt. Auch das muss für viele wie Hohn klingen, ist doch das mexikanische Militär für sexualisierte Gewalt, Menschenrechtsverletzungen und die Zusammenarbeit mit dem organisierten Verbrechen bekannt. Nicht wenige befürchten nun eine Militarisierung der Region und ein wirtschaftliches Erstarken der in zahlreiche Korruptionsskandale verstrickten Armee.
Die zunehmend autoritäre Durchsetzung des Projekts hat überdies zur Delegitimierung einer kritischen Zivilgesellschaft, der Gewaltenteilung und der demokratischen Institutionen und Verfahrensweisen in Mexiko beigetragen. Ob gerichtlich angeordnete Baustopps, Konsultationsprozesse mit indigenen Gemeinschaften, Menschen- und Umweltrechte oder das Urteil des Obersten Gerichtshofs, das Amlos Nationaldekret als verfassungswidrig einstufte – über all das hat sich der Präsident hinweggesetzt, um sein „Meisterwerk“ bis zum Ende seiner Amtszeit zu verwirklichen.
Das soziale Geflecht auf der Halbinsel droht in diesem Prozess zwischen Kapitalinteressen und der Verwirklichung eines linksnationalistischen, ökomodernistischen Traums zerrieben zu werden. Ob die versprochenen Tourist:innenmassen am Ende tatsächlich kommen und die erhofften Arbeitsplätze entstehen werden, ist dabei längst nicht ausgemacht. Befürchtet wird vielmehr, dass vor allem Jobs im Niedriglohnsektor entstehen. Fest steht dagegen: Die Veränderung der Landnutzung, aber auch die Aneignung der „Maya“-Kultur durch den Tren Maya schürt bereits heute Identitätskonflikte innerhalb der indigenen Gemeinschaften. Das zumindest beklagt die indigene Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin Wilma Esquivel Pat. Die auf der Bahnstrecke liegenden Maya-Stätten würden mit kolonialen Bildern „exotischer Indigener“, ihren Tänzen, Riten und Mythen beworben. Dass traditionelle Praktiken der Maya wie der Milpa-Anbau – eine Mischkultur aus Mais, Bohnen und Kürbis – oder die Bienenzucht durch die mit dem Zugprojekt einhergehende Urbanisierung verdrängt werden könnten, gerate dabei aus dem Blick.[9] Der Tren Maya wirkt sich überdies besonders negativ auf die Frauen der indigenen Gemeinschaften aus, die in dem extrem patriarchal geprägten Ejido-System kaum über Entscheidungsmacht darüber verfügen, wie das Land künftig genutzt wird.
Der Tren Maya ist somit ein paradigmatisches Beispiel einer ökomodernistischen Entwicklungspolitik, die soziale Ungleichheit und die Ausbeutung der Natur zugunsten eines kapitalistischen Wachstumszwangs gegeneinander ausspielt. Denn während die Bevölkerung dazu gedrängt wird, ihre Parzellen dem Bahnprojekt zur Verfügung zu stellen und ihre traditionelle Lebensform aufzugeben, wird durch den Bau der Bahnstrecke die Zerstörung der Natur – und damit die Lebensgrundlage der dort lebenden Menschen – vorangetrieben.
Trotz all dieser Widersprüche ist Amlo nach wie vor ungemein beliebt, was der aussichtsreichen Präsidentschaftskandidatin seiner Morena-Partei, Claudia Sheinbaum, einen Vertrauensvorschuss für die Präsidentschaftswahl am 2. Juni verschafft.[10] Kann sie sich durchsetzen, wofür derzeit vieles spricht, wird sie wohl den linksnationalistischen Kurs von Amlo fortsetzen und die territoriale Neuordnung im Südosten weiter vorantreiben. Zu hoffen bleibt, dass Sheinbaum dabei andere Akzente als ihr autokratischer Vorgänger setzen und bei künftigen Infrastrukturprojekten um ernsthafte demokratische Beteiligung ringen wird. Schließlich wird der Tren Maya, so viel ist schon jetzt absehbar, nicht das letzte Megaprojekt in dem mexikanischen Jahrhundertvorhaben der „vierten Transformation“ bleiben.
[1] Jesús Vázquez, AMLO inaugura el primer tramo del Tren Maya; „obra magna que se logró en tiemo record“, in: „El Economista“, 15.12.2023.
[2] Salvador Corona, Sheinbaum: „El Tren Maya es símbolo del renacimiento del país“, in: „El Universal“, 15.10.2023.
[3] 2021 war Mexiko sogar das Land mit den weltweit höchsten Mordraten an Umweltaktivist:innen, vgl. Global Witness Report 2022.
[4] ONU-DH, El proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia, hchr.org.mx, 19.12. 2019.
[5] Vgl. Ivet Reyes Maturano, Análisis discursivo del Tren Maya: fragmentación territorial de una promesa desarrollista, in: „Maya America: Journal of Essays, Commentary and Analysis”, 2/2022, S. 181-185.
[6] Cemda, Todo lo que tienes que saber sobre el Tren Maya, cemda.org.mx.
[7] Jesús Vázquez, Tren Maya: Perforación de cavernas, el inicio de una afectación mayor al acuífero de Quintana Roo, in: „El Economista”, 28.1.2024
[8] Vgl. Edwin F. Ackerman, Posneoliberalismo realmente existente en México, in: „Política y gobierno“, 2/2021, S. 1-8.
[9] Mariana Beltrán, Tren ¿Maya?: las voces de las mujeres que defienden la vida, in: „Volcánicas“, 2.2.2023.
[10] Vgl. auch Wolf Dieter Vogel, Mexiko: Das Erbe des linken Patriarchen, in: „Blätter“, 1/2024, S. 95-112.