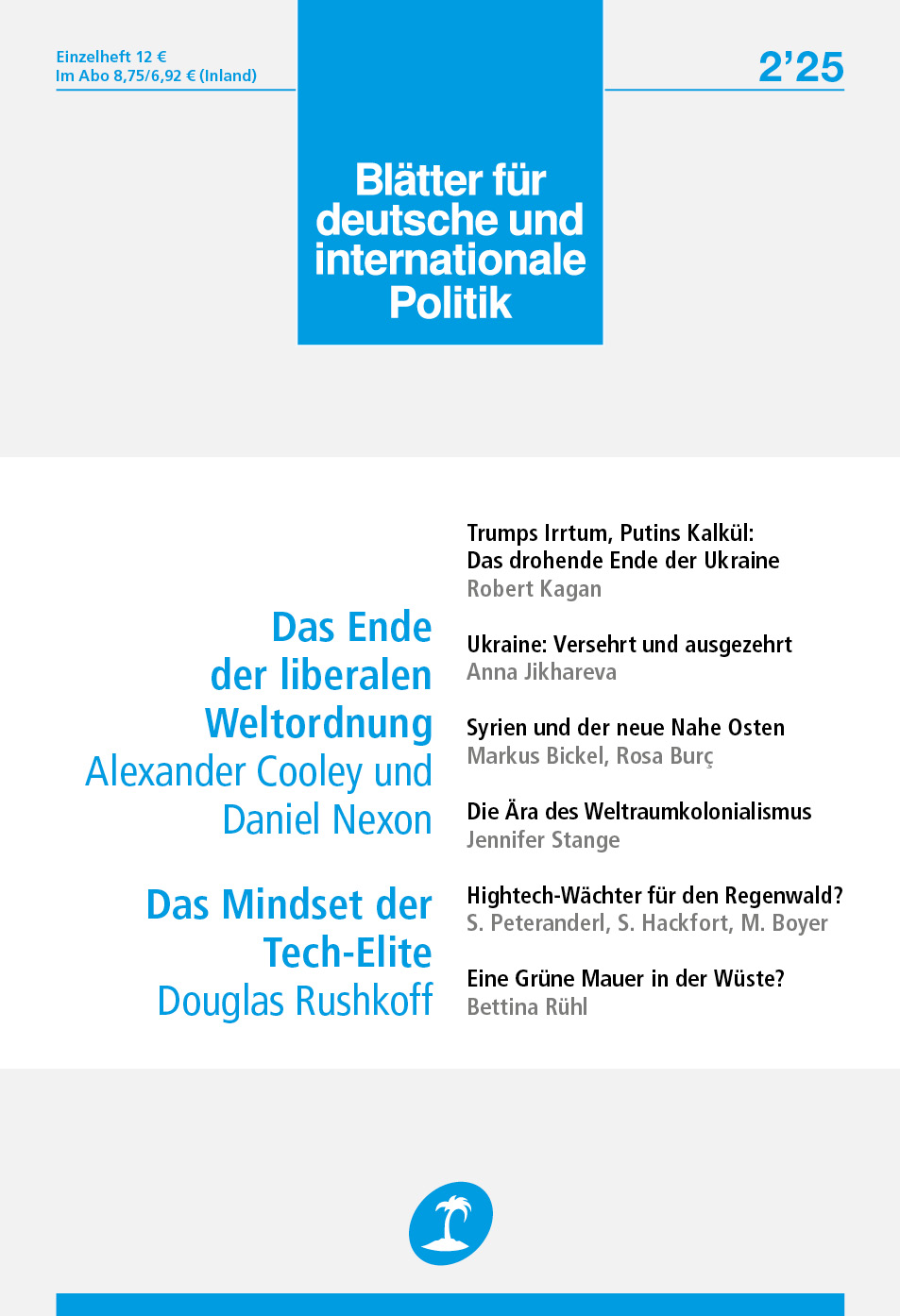Wie Aktivisten in Lateinamerika gegen Umweltverbrechen vorgehen

Bild: Abholzung im Amazonas in Brasilien (IMAGO / Pond5 Images)
Ein Lastwagen nach dem anderen rumpelt aus den Bergen in das touristische Städtchen San Cristóbal de las Casas im mexikanischen Bundesstaat Chiapas, vollbeladen mit Holz. Die Ware wird in der ärmlichen Nordzone der Stadt vertrieben oder in andere Regionen weitertransportiert, etwa in die touristischen Gebiete entlang der Riviera Maya an der Karibikküste – illegal. Umweltverbrechen wie illegaler Holzeinschlag finden in Mexiko auch am helllichten Tag statt. Verübt werden sie zunehmend auch im großen Stil von kriminellen Organisationen – für sie ist es ein lukratives und expandierendes Geschäft, das kaum geahndet wird.
In Chiapas stammen mittlerweile 100 Prozent des Holzes aus illegalen Quellen, schätzt der Umweltaktivist Gustavo Castro Soto von der Organisation Otros Mundos. Dem Colegio de la Frontera Sur zufolge ist Chiapas einer der am stärksten von illegalem Holzeinschlag betroffenen Bundesstaaten in Mexiko. Doch auch in vielen anderen Regionen des Landes ist die Lage ähnlich dramatisch: Schätzungen der Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) zufolge werden mehr als 70 Prozent des im Land gehandelten Holzes illegal gefällt. Jährlich weichen zudem Zehntausende Hektar Wald und Regenwald Viehzucht, Avocadoplantagen, Siedlungen oder Hotels.
Die Gebiete, in denen der Raubbau an der Natur stattfindet, sind oft weitläufig und schwer zugänglich. In Chiapas stellen bewaffnete kriminelle Organisationen auf den von ihnen kontrollierten Routen auch Straßensperren auf, halten Fahrzeuge an, kontrollieren Smartphones, scrollen durch WhatsApp-Verläufe, Fotos und Kontakte. Auch Umweltaktivisten laufen Gefahr, in solche Kontrollen zu geraten.
Der Umweltschützer Gustavo Castro Soto versucht trotz der Risiken, die kriminellen Netzwerke und deren Einfluss in Chiapas zu verstehen und Karten zu erstellen, auf denen Transportrouten und inoffizielle Kontrollposten verzeichnet sind – dabei helfen ihm auch WhatsApp-Kanäle, in denen Informationen, etwa zu Schusswechseln zwischen Kartellen, zirkulieren.
Umweltschützer in Mexiko, aber auch in anderen lateinamerikanischen Ländern experimentieren zunehmend mit moderner Technologie, um Umweltverbrechen aufzudecken und Flora und Fauna zu schützen. Smartphones und Apps, GPS-Geräte, Drohnen, Sensoren, Satellitenaufnahmen oder Künstliche Intelligenz helfen ihnen dabei, Missstände zu dokumentieren und anzuprangern. Denn bisher bleiben viele Umweltverbrechen unsichtbar – und Täter werden viel zu selten zur Verantwortung gezogen.
Umweltverbrechen: Ein wachsendes Geschäftsfeld der Organisierten Kriminalität
Umweltkriminalität habe sich „zu einem der lukrativsten Wirtschaftszweige für transnational organisierte kriminelle Organisationen entwickelt, der jährlich Milliarden von US-Dollar an kriminellen Gewinnen einbringt und Gemeinden, Wirtschaft und die Umwelt destabilisiert“, warnt Interpol. „Umweltverbrechen sind für kriminelle Organisationen ein gutes Geschäft mit wenig Risiko“, beobachtet auch Edgardo Buscaglia, Direktor der Wildlife Justice Commission, einem Netzwerk aus Ermittlern, Juristen und Kriminalitätsexperten, das sich zum Ziel gesetzt hat, mit Wildtieren, Holz und Fisch handelnde transnationale kriminelle Netzwerke zu bekämpfen.
„In den meisten Ländern haben Regierungen sehr wenige Ressourcen für Polizei, Geheimdienste und Justiz, um kriminelle Netzwerke zu bekämpfen, die Umweltkriminalität begehen“, so Buscaglia. Der Fokus liege auf der Bekämpfung von Drogen- oder Waffenhandel. In Lateinamerika sind Regierungen und korrupte Politiker, Sicherheitskräfte, Behörden und Firmen zudem oft selbst an Umweltverbrechen beteiligt, paktieren teils mit kriminellen Gruppierungen.
Mexikos Kartelle oder kriminelle Gruppen aus Kolumbien haben ihre Geschäfte in den vergangenen Jahren stark diversifiziert und auf Bereiche wie illegalen Holzhandel, Wildtierhandel, die Ausbeutung von Rohstoffen wie illegal geförderte Mineralien oder Fischfang ausgeweitet.
In Mexiko treiben kriminelle Netzwerke den Kahlschlag von Wäldern immer professioneller und im großen Stil voran: Mit Motorsägen, Funkgeräten, Waffen und Trucks fallen Gruppen von Holzfällern in die Wälder ein. Verarbeitet wird das Holz in Hunderten von oft illegalen Sägewerken im Land, die meist entweder Schutzgeld an kriminelle Netzwerke zahlen oder von diesen direkt kontrolliert werden. Oft sind lokale kriminelle Netzwerke, aber auch Gemeinden – teils freiwillig, teils gezwungenermaßen – an der Ausbeutung beteiligt und bilden etwa in Chiapas Allianzen mit Kartellen wie dem Cártel de Jalisco Nueva Generación oder dem Sinaloa-Kartell. Beim Export von teuren Hölzern wie Grenadill nach China treten die großen Organisationen Edgardo Buscaglia zufolge dann als „Broker auf dem Weltmarkt“ auf.
Kriminelle Organisationen kontrollieren in Lateinamerika viele ländliche Regionen und Waldgebiete, teils sogar Naturparks. Das Ausmaß der territorialen Kontrolle offenbarte sich auch rund um den Weltnaturgipfel COP 16 im November 2024 im kolumbianischen Cali. Néstor Gregorio Vera Fernández alias „Iván Mordisco“, Chef der aus nichtdemobilisierten Einheiten der ehemaligen FARC-Guerilla hervorgegangenen kriminellen Gruppierung Estado Mayor Central (EMC), nutzte die internationale Aufmerksamkeit, um sich als Umweltschützer zu inszenieren. 2023 konnte die kolumbianische Regierung historisch niedrige Entwaldungsraten vermelden – „Iván Mordisco” hatte dazu beigetragen, indem er in dem von ihm kontrollierten Amazonasgebiet ein Abholzungsverbot durchsetzte. Doch er demonstrierte auch, dass er die Regeln jederzeit wieder ändern kann. So wurde, als die Gespräche seiner Gruppierung mit der Regierung stockten, die Abholzung vorrübergehend wieder beschleunigt.
„Kriminelle Gruppen in Kolumbien versuchen sich zu legitimieren, indem sie die Entwaldung stoppen“, sagt Héctor Camilo Morales Muñoz, der sich bei der europäischen Beratungsfirma Adelphi mit Klimadiplomatie und Sicherheit beschäftigt. „Sie nutzen Umweltschutz auch als Verhandlungsmasse bei den Gesprächen mit der Regierung.“ Dennoch seien es nicht nur bewaffnete Gruppen allein gewesen, die zum Rückgang der Abholzung beigetragen hätten, schränkt Morales Muñoz ein – Kolumbien habe unter Präsident Gustavo Petro auch lokale Gemeinden stärker in den Waldschutz eingebunden.
Waldgebiete zu kontrollieren, ist für Staaten in ganz Lateinamerika eine Herausforderung, denn die Gebiete sind so groß, dass es schwierig ist, überall präsent zu sein. „Die kriminellen Organisationen in Kolumbien gehen sehr strategisch vor, sie haben Drohnen und überwachen, wo die Behörden sind, um schnell in andere Bereiche zu wechseln“, so Morales Muñoz. Auch Mexikos Kartelle setzen Überwachungsdrohnen ein. Und sie verüben Luftanschläge mit per Drohnen transportierten, selbstgebastelten Sprengsätzen: auf Rivalen, Sicherheitskräfte und teils auch auf Gemeinschaften, die versuchen, ihnen Widerstand zu leisten. In Mexiko wurden allein 2023 Hunderte solcher Luftanschläge registriert, in Bundesstaaten wie Michoacán sichern Kartelle Gebiete nach kolumbianischem Vorbild zunehmend mit Landminen ab. All das geschieht in weitgehender Straflosigkeit, zu der auch die verbreitete Korruption beiträgt: In Mexiko bleiben mehr als 90 Prozent aller Verbrechen ungestraft.
2023: 166 getötete Umweltschützer in Lateinamerika
Land- und Umweltschützer, die sich kriminellen Organisationen, aber auch an Umweltverbrechen beteiligten Firmen, Militärs oder Regierungen in den Weg stellen, leben angesichts dessen gefährlich. Der Organisation Global Witness zufolge wurden allein im Jahr 2023 weltweit mindestens 196 Land- und Umweltschützer getötet – die meisten in Lateinamerika. 54 Morde geschahen in Mexiko und Mittelamerika, 112 in Südamerika. Kolumbien ist weltweit das tödlichste Land für Umweltschützer.
Auch deshalb bedienen sie sich zunehmend modernster Technik. Mussten Regierungen und Umweltschützer früher schwer zugängliche Gebiete aufwändig mit Helikoptern überfliegen, um sich aus der Luft einen Eindruck vom Grad der Zerstörung zu verschaffen, reichen heute ein paar Klicks. Google Earth Pro etwa bietet aktuelle und historische Satellitenaufnahmen. Kommerzielle Anbieter wie Planet Labs oder Maxar bieten eine noch bessere Qualität, sind normalerweise aber teuer. Für spezielle Projekte stellen die Firmen ihr Material allerdings kostenfrei zur Verfügung.
Oft nutzen Umweltschützer auch Google Maps. Eine mexikanische Gruppe etwa identifizierte mit der Streetview-Funktion illegale Sägewerke und gab die Positionen der Gebäude an Ermittlungsbehörden weiter. Auch Elias Siebenborn, der die Regenwaldzerstörung durch Regierung, Konzerne und teils auch kriminelle Akteure auf der mexikanischen Yucatán-Halbinsel verfolgt, verschafft sich so einen ersten Überblick.
Mit Drohnen gegen die Abholzung
Wenn der Umweltaktivist aus Playa del Carmen an der Riviera Maya in den Regenwald fährt, um Flora und Fauna sowie Umweltverbrechen vor Ort zu dokumentieren, arbeitet er mit einem ganzen Tech-Arsenal: Er nutzt professionelle Fotokameras, eine GoPro-Kamera für Unterwasseraufnahmen und eine DJI Mini 2 SE Drohne. Zudem stellt er Wildkameras auf, die durch Bewegungen Aufnahmen auslösen. „Fotos und Videos sind die besten Beweise“, sagt Siebenborn, der sein Material auch Juristen zur Verfügung stellt, die Umweltverbrechen anzeigen. Damit die Beweise gerichtsfest sind, nutzt er die App „TimeStamp“ oder ein GPS-Gerät, um die Aufnahmen mit Standort, Datum und Uhrzeit zu versehen.
Da Anzeigen in Mexiko selten Konsequenzen haben, setzt Siebenborn auch auf öffentliche Aufmerksamkeit. „Das Beste ist eine Drohne, um Klarheit zu bringen, was an einem Ort passiert, zu dem ich nicht hinlaufen kann”, meint er. Die Umweltschützer brauchen jedoch etwas Übung, wenn sie mit Drohnen den Regenwald überfliegen wollen. In dicht bewaldeten Gebieten ist es schwierig, einen Start- und Landepunkt zu finden. Nach dem Abflug ist die Drohne schnell außer Sichtweite – bricht der Empfang weg, kann es sein, dass das Gerät unkontrolliert landet und sich nicht mehr bergen lässt, trotz GPS-Standort. Siebenborn hat in seinem ersten halben Jahr als Drohnen-Operator bereits drei Drohnen verloren.
In Ländern wie Mexiko müssen Umweltschützer zudem mit krimineller Gegenwehr rechnen. So schossen Fischer eine Drohne der US-Umweltorganisation Sea Sheperd ab, die mit einem Schiff im Golf von Mexiko patrouilliert, um mit Nachtsichtdrohnen Fischerboote und illegale Fangnetze aufzuspüren, in denen sich auch die fast ausgestorbenen Kalifornischen Schweinswale verfangen.
Auch wenn Drohnen in den letzten Jahren erschwinglicher geworden sind, ist in Mexiko längst nicht jede indigene Gemeinschaft mit eigenen Drohnen ausgestattet und hat zudem genug Zeit, Ressourcen, Mut und Interesse, digitalen Umweltaktivismus zu betreiben. „Bisher sind es an der Riviera Maya eher eine Handvoll Digitalaktivisten mit Drohnen als eine flächendeckende Bewegung“, erklärt Siebenborn.
Um indigenen Gemeinschaften Technologie niedrigschwellig zur Verfügung zu stellen, haben einige Organisationen mobile Apps entwickelt, die teils auch offline funktionieren. Die Plattform Global Forest Watch etwa bietet kostenfrei Datenanalyse-Tools für den Waldschutz, die App „Forest Watcher“ bringt sie aufs Smartphone. Nutzer können sich durch Wälder navigieren und auf Monitoring-Daten zugreifen, Warnmeldungen zu Abholzung oder Feuern empfangen und Informationen vor Ort eintragen – eine Internetverbindung brauchen sie dafür nicht zwingend.
Umweltschutzinitiativen verbinden zunehmend Wissenschaft, indigenes Wissen und Künstliche Intelligenz – meist stellen internationale Technologiepartner IT-Expertise und Infrastruktur zur Verfügung. Das Projekt „Guacamaya“, das 2023 von dem kolumbianischen Humboldt Institute, der Universidad de los Andes in Bogotá, dem Forschungszentrum Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI und Microsoft lanciert wurde, nutzt Algorithmen, die unter anderem Aufnahmen aus Wildkameras automatisiert durchforsten. Allein dass Algorithmen vorsortieren, ob auf den Aufnahmen überhaupt Tiere erfasst sind, bedeutet Microsoft zufolge eine enorme Zeitersparnis – und ermögliche „viel umfassendere und genauere Studien über die Tierwelt des Amazonas“. Künftig sollen Algorithmen auch Arten automatisiert erkennen. Machine-Learning-Modelle analysieren zudem Tausende Stunden Tonaufnahmen aus dem Regenwald, können Art und Geschlecht von Tierarten erkennen oder Geräusche von Kettensägen oder Baggern herausfiltern.
KI-Warnsystem für den Waldschutz
In Mexiko verknüpft die von einem lokalen Start-up-Gründer entwickelte Initiative Guardián Forestal (Waldhüter) im Bundesstaat Michoacán Waldschutz mit KI. Das 2023 implementierte System analysiert Satellitenaufnahmen und gibt Warnhinweise an Sicherheitskräfte und indigene Gemeinschaften ab. Ressourcen sollen so effizienter gebündelt und die Maßnahmen der Sicherheitskräfte transparenter werden. In Mexikos wichtiger Avacadoanbauregion liefern sich gleich mehrere kriminelle Gruppen brutale Kämpfe um die Macht, oft sind sie mit Politik und Sicherheitskräften vernetzt. Sie verdienen durch das Eintreiben von Schutzgeldern an den Avocadoplantagen und -Exporten, holzen aber auch selbst große Waldgebiete ab, um dort eigene Plantagen anzupflanzen.
Die wöchentlich aktualisierten Warnmeldungen von Guardián Forestal laufen in der Hightechzentrale der Sicherheitskräfte von Michoacán ein und werden dort von Analysten gesichtet. Auch indigene Gemeinschaften erhalten Warnungen, sodass sie Missstände vor Ort prüfen und die Ursache der Entwaldung rückmelden können. Die Daten zum Projekt sind daneben auch auf der Webseite von Guardián Forestal selbst einsehbar. „Das System ist komplett öffentlich“, sagt Padilla Ibarra. Dies soll für Transparenz sorgen und aufzeigen, ob Ermittlungen Konsequenzen haben.
Algorithmen lernen dabei auch aus dem Verhalten des Waldes, um Veränderungen oder Anomalien feststellen zu können. Mit der Zeit können sie so auch lokale Besonderheiten berücksichtigen. „In vielen Gebieten, in denen Avocados angebaut werden, gibt es Eichenwälder, die ihre Blätter für eine gewisse Zeit abwerfen, was es für einige Warnsysteme schwierig macht, die Abholzung der Bäume zu erkennen“, sagt Heriberto Padilla Ibarra, Leiter von Guardián Forestal. Für Umweltschützer hat das automatisierte System auch den Vorteil, dass sie Vorfälle nicht selbst anzeigen müssen und sich so in Gefahr bringen. Der Fallbericht wird automatisch erstellt – bisher sind es mehr als 300 Berichte. „Unser System hat sich als sehr effektiv erwiesen“, so Padilla Ibarra. Derzeit verhandelt die Initiative mit der Regierung, das System auf zehn weitere Bundesstaaten auszuweiten.
2025 will Guardián Forestal zudem eine Whatsapp-Anwendung einführen – sie soll die schnelle Verbreitung des Warnsystems in indigenen Gemeinschaften erleichtern. Anwender müssen sich nicht in eine neue App oder Plattform einarbeiten, sondern erhalten Warnhinweise zum Waldverlust direkt per Whatsapp – mit einem Link zu Google Maps, der sie zum potenziellen Tatort führt. Auch ein KI-Chatbot soll künftig komplexe Walddaten leicht verständlich vermitteln, im digitalen Dialog.
Die Grenzen der Künstlichen Intelligenz
All das zeigt: Technologie kann auf Missstände hinweisen, die Überwachung von weitläufigen Gebieten oder von Kriminellen kontrollierten Regionen erleichtern, Beweise für Umweltverbrechen liefern und teils für mehr Transparenz sorgen. Um die strukturellen Probleme bei Regierungen, Behörden und Strafverfolgungsbehörden anzugehen, die wie in Mexiko oder Kolumbien oft eng mit der Organisierten Kriminalität verflochten sind, reicht eine App jedoch nicht.
„Jeder kann das Gesetz kaufen“, beklagt sich Umweltaktivist Gustavo Castro Soto auch über Chiapas. „Das Holz erreicht sein Ziel, weil Schutzgeld fließt – die Korruption ist groß.“ Die Holzmafia würde Umwelt- und Forstbehörden ebenso bestechen wie lokale und nationale Sicherheitskräfte. In Comitán, einem wichtigen Knotenpunkt für den illegalen Holzschmuggel in Chiapas unweit der guatemaltekischen Grenze wurden im Dezember 2024 mehr als 90 Polizisten wegen Verbindungen zur Organisierten Kriminalität und der Vereitelung von Operationen festgenommen. Einige Gemeinden und Waldschutzgruppen bewaffnen sich angesichts solcher Bedingungen, um sich zu verteidigen.
Nicht nur die Bekämpfung von Korruption ist also für den Schutz der Wälder essenziell, auch müssen Sicherheits-, Klima- und Umweltpolitik künftig stärker miteinander verzahnt werden. „Sicherheitskräfte müssen für ihre Rolle bei der Bekämpfung von Umweltkriminalität stärker sensibilisiert werden“, glaubt Héctor Camilo Morales Muñoz von Adelphi. „Es reicht nicht, einzelne Razzien zu machen und ein paar Leute zu verhaften – sie müssen auch den Finanzstrukturen folgen und internationale Märkte und Netzwerke analysieren, denn die kriminellen Organisationen erinnern an internationale Firmen und reagieren auf die Nachfrage auf globalen Märkten.“
Internationale Kooperation im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität
Um die transnational agierenden kriminellen Netzwerke zu bekämpfen, muss die internationale Zusammenarbeit weiter gestärkt werden. Ansätze dafür gibt es bereits. Interpols Environmental Security Program etwa unterstützt auch lateinamerikanische Strafverfolgungsbehörden bei Umweltkriminalität, unter anderem mit Analysen von Daten, Satellitenaufnahmen oder Technologietrainings. Auch die kürzlich gegründete International Initiative of Law Enforcement for Climate I2LEC, initiiert von den Vereinigten Arabischen Emiraten, UNODC sowie Interpol, versucht die Bekämpfung von Klima- und Umweltkriminalität voranzutreiben.
Bisher mangelt es aber innerhalb von Lateinamerika oft noch an grenzüberschreitenden Strategien gegen Umweltkriminalität, so auch im Amazonasgebiet, wo Kriminelle bisher von unterschiedlichen Gesetzen der das Gebiet umfassenden Länder profitieren. Dass kriminelle Netzwerke sich bei ihren Umweltverbrechen bisher noch zu sicher fühlen, kann dem Kriminalitätsexperten Edgardo Buscaglia zufolge aber auch ein Vorteil für die Ermittler sein. „Umweltverbrechen sind oft das schwächste Glied Organisierter Kriminalität“, so Buscaglia. „Anders als bei Fentanyl-Transporten oder Waffenschmuggel verschleiern kriminelle Netzwerke Umweltverbrechen wie illegalen Holzhandel, Transport und Logistik nicht mit besonders viel Ressourcen und Achtsamkeit.“
Wenn Ermittler bei Umweltverbrechen ansetzen, könnten sie Buscaglia zufolge oft große Netzwerke entlarven, die in sechs bis zwölf verschiedenen Arten von Kriminalität gleichzeitig aktiv seien: „Meist entdeckt man einen ganzen Supermarkt krimineller Tätigkeiten.“ Die Spur von illegalem Holz zu verfolgen, kann also helfen, um Drogenhandel, Menschenschmuggel, politische Korruption oder die Bestechung von Zollbehörden aufzudecken. Diese Verbrechen zu bekämpfen, bleibt dennoch eine Mammutaufgabe, für die vor allem Folgendes nötig ist: der geeinte politische Wille von Regierungen weltweit sowie die Bereitschaft zur Kooperation im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität und gegen Korruption in den eigenen Reihen.