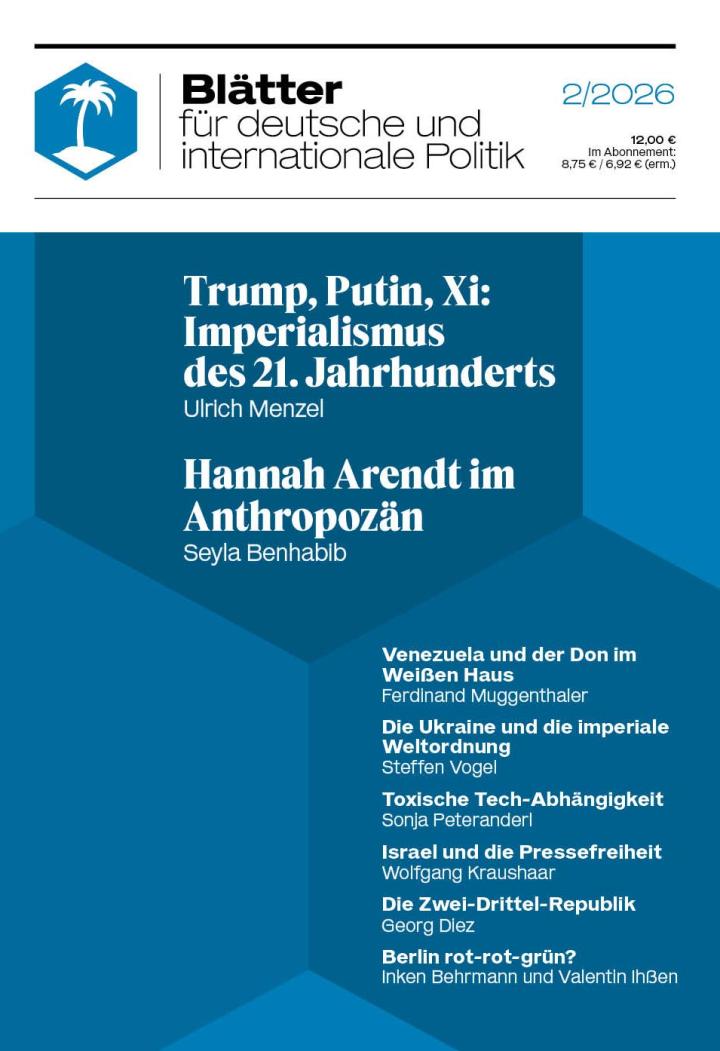Von der Julikrise 1914 zur Politik der "revolutionären Infizierung"
Die in Deutschland immer wieder kaskadenartig geführte Kriegsschulddebatte, in deren Zentrum seit Anfang der 1960er Jahre die Thesen des Hamburger Historikers Fritz Fischer stehen, hat den politischen Blick auf den Ersten Weltkrieg und seine Folgen eher verstellt als geöffnet. Vor allem hat sie die Beschäftigung mit dem Krieg auf dessen Vorgeschichte und die Juli-Krise von 1914 fokussiert, was zur Folge hatte, dass der Verlauf des Krieges ebenso wie die in ihm zusammenfließenden macht- und geopolitischen Konflikte kaum thematisiert wurden. Diese Nicht-Beschäftigung mit dem Krieg selbst, die unter anderem darin ihren Niederschlag gefunden hat, dass in Deutschland über bald vier Jahrzehnte keine große Darstellung des Krieges geschrieben wurde, hat dazu beigetragen, dass die Gewaltförmigkeit der europäischen Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wesentlich auf das Machtstreben der deutschen Eliten zurückgeführt und als moralische Herausforderung der Deutschen begriffen worden ist. Beides hat seine Berechtigung: Die deutschen Eliten haben beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs wie bei der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs in der Tat eine verhängnisvolle Rolle gespielt.