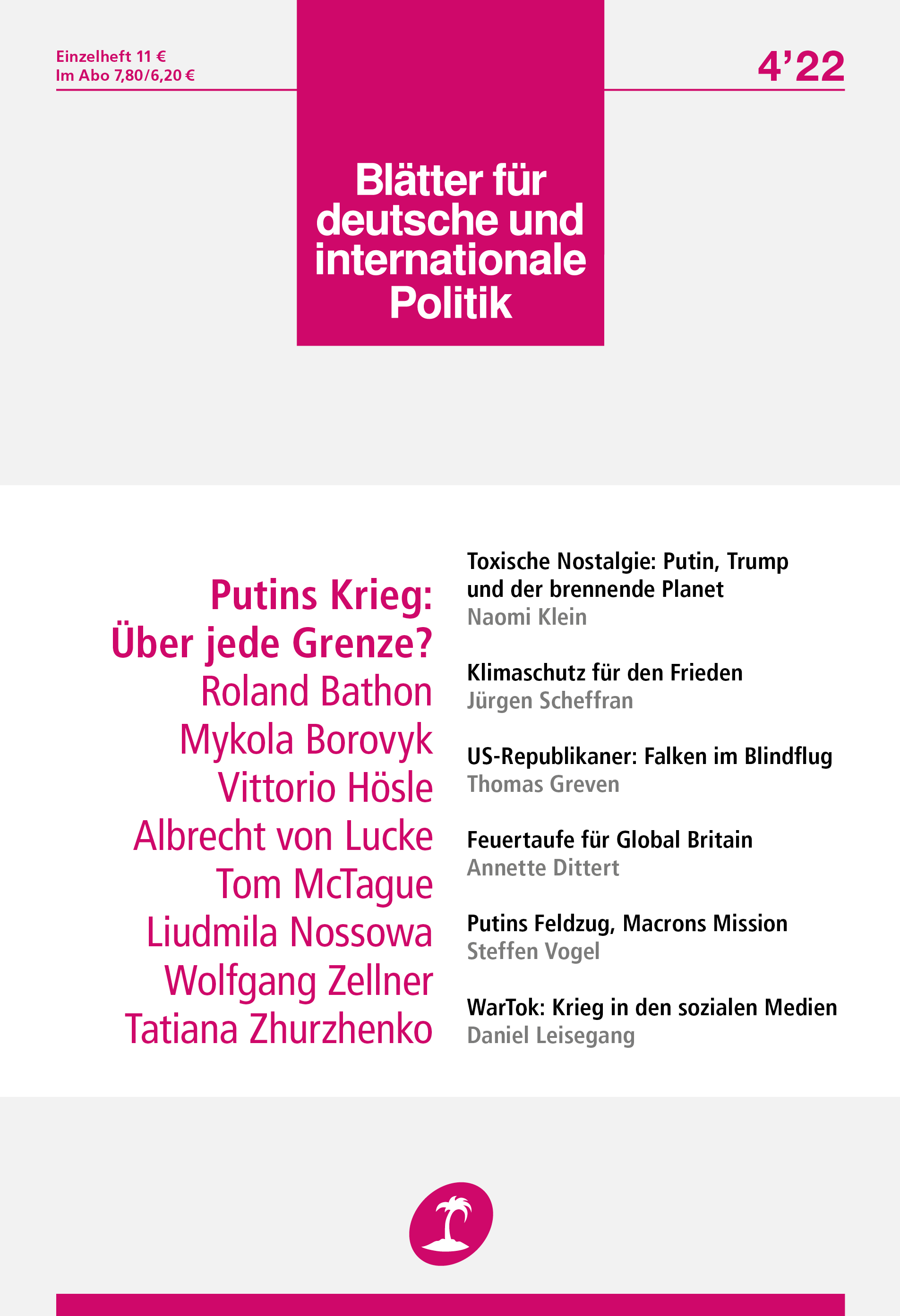Bild: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky bei seiner Rede vor dem französischen Parlament in Kyiv/Ukraine, 23.3.2022 (IMAGO / ZUMA Wire)
Für den Februar dieses Jahres hatte ich eine Forschungsreise in die Ukraine geplant. Ich bin an einem interdisziplinären Projekt zu den Herausforderungen für die liberale Werteordnung beteiligt und untersuche deren Implikationen für die Grenzen und Grenzregionen der Ukraine. Ziel meiner Reise war Charkiw, die zweitgrößte Stadt des Landes, 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Ich wollte auch Interviews in kleineren Grenzstädten der Region durchführen. Eine Covid-Welle in der Ukraine vereitelte den Plan, und ich hoffte, ihn im Frühjahr verwirklichen zu können.
Stattdessen sitze ich nun schon in der vierten Woche vor meinem Computer und verfolge den Krieg, den Putins Russland gegen die Ukraine entfesselt hat und der unendliches Leid über Millionen ukrainischer Familien bringt. Charkiw, ein blühendes Zentrum kulturellen und akademischen Lebens, eine Großstadt, deren Bevölkerung mehrheitlich russisch spricht, mein Geburtsort und die Heimat mehrerer Generationen meiner Familie, gleicht zunehmend Aleppo und ist nun halb leer. Allein per Bahn haben bis zum 8. März 600 000 Bewohner die Stadt verlassen.
Während ich nicht aufhören kann, die schrecklichen Bilder anzuschauen, die die Geschichten meiner Großmutter aus dem Charkiw des Zweiten Weltkriegs wiederaufleben lassen, versuchen mich Charkiwer Freunde und Kollegen aus Lwiw, Krakau, Joensuu, Berlin oder irgendwelchen Dörfern nahe der ukrainisch-ungarischen Grenze zu erreichen.