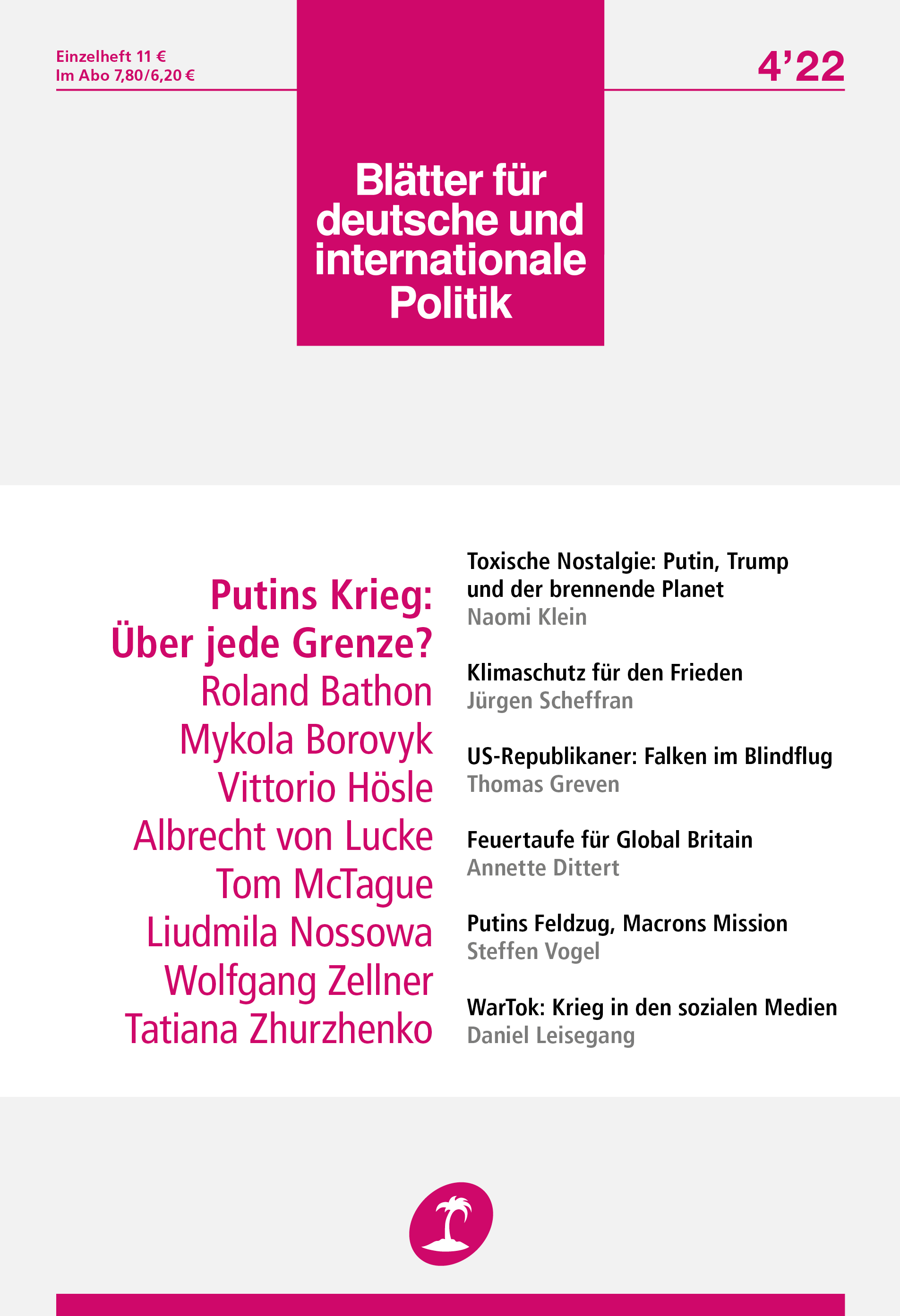Bild: Straßenszene nach einem Selbstmord-Autobombenanschlag an der El-Gab-Kreuzung in der Nähe des Präsidentenpalastes in Mogadischu / Somalia, 25.9.2021 (IMAGO / Xinhua)
2021 sollten in Somalia Parlaments- und Präsidentschaftswahlen stattfinden. Bis heute ist der Prozess nicht abgeschlossen. Im Südsudan waren schon 2015 Wahlen geplant, die inzwischen auf 2023 verschoben wurden. Gleichzeitig gelten beide Länder seit langem als von politischer Instabilität, Gewalt und humanitären Krisen geprägt. Ebenso lange versuchen verschiedene internationale Akteure, unter anderem aus Deutschland, von außen Frieden und Stabilität herzustellen. Doch diese Interventionen verstetigen und verstärken nicht selten Gewalt und Instabilität – was vielen der Akteure durchaus bewusst ist. Das Scheitern der internationalen Stabilisierungs- und Sicherheitspolitik im Südsudan und in Somalia sollte dazu führen, diese Politik grundsätzlich zu überdenken.[1]
Somalia: Wahltag ist Zahltag
Die Konfliktdynamik in Somalia ist seit Ende der 1960er Jahre in globalisierte kriegerische Systeme eingebunden. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 rückte das vornehmlich muslimische Somalia wieder ins Blickfeld der europäischen und US-amerikanischen Außenpolitik. Die USA und ihre Verbündeten kooperierten mit lokalen Kriegsherren, zunächst, um islamische Terrorverdächtige und Extremisten in Südsomalia gefangen zu nehmen oder zu eliminieren, und später, um die von großen Teilen der Bevölkerung anerkannten sogenannten Islamischen Gerichtshöfe zu vertreiben, aus denen ab 2007 Al Shabaab („Die Jugend“) hervorging.