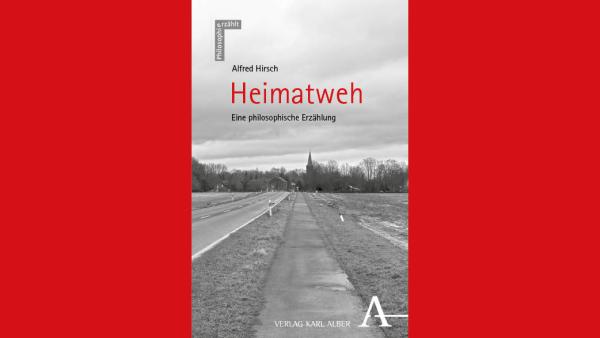Bild: Hanser
Die globale Erwärmung, wachsende Dürrezonen, schmelzende Gletscher, Überschwemmungen und der Anstieg des Meeresspiegels, all das steht als drohendes Menetekel am Horizont unserer Gegenwart. Wir sind indes nicht die erste Generation, die sich fundamentalen Veränderungen der natürlichen Umweltbedingungen ausgesetzt sah. Daran erinnert der Autor Philipp Blom in seinem jüngsten Buch. Blom beschreibt den frühneuzeitlichen Klimawandel und verbindet damit eine überraschende These. Demnach verdankt sich die Entstehung unserer modernen Welt einer umfassenden Anpassungsleistung der damaligen Zeitgenossen an die klimatischen Veränderungen.
Seine Darstellung reichert Blom mit ein drucksvollen Zeitzeugenberichten an. Wie Menschen den Verlust der Berechenbarkeit ihrer natürlichen Umwelt erleben, erfahren wir zum Beispiel von Daniel Schaller. Er wurde 1550 in Stendal geboren und ist dort als Pastor an der Marienkirche 1630 auch gestorben – eine für die damalige Epoche bemerkenswert lange Lebensspanne. Doch es waren, glaubt man Schallers Aufzeichnungen, keine guten Jahre: „Die Sonne, Mond und andere Sterne leuchten, scheinen und wirken nicht mehr so kräftig als zuvor. Es ist mehr kein rechter beständiger Sonnenschein, kein steter Winter und Sommer. Die Früchte und Gewächse auf Erden werden nicht mehr so reif, sind nicht mehr so gesund als wie sie wohl ehezeit gewesen.