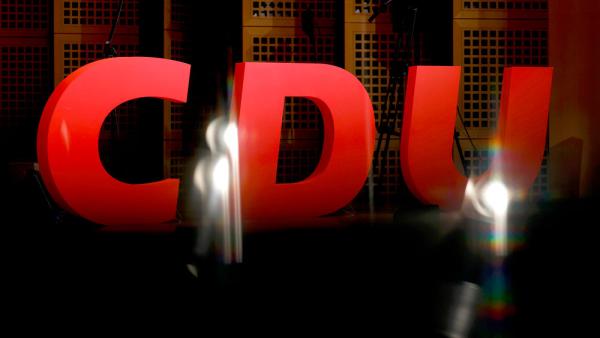Warum bei Sibylle Tönnies einiges durcheinandergeht
Dem Historiker stellen sich intellektuelle Debatten als eine Art Choreographie der Umorientierung oder (bestenfalls) des Umdenkens dar. Das Hin und Her von Argumenten und der Positionswechsel von Personen lassen veränderte Problemlagen und sich neu verbindende Koalitionen erkennen. Solche Debatten sind keine herrschaftsfreien Diskurse. Sie werden meist asymmetrisch geführt; d.h. der eine Teil findet in der Regel größere mediale Akzeptanz oder gar machtvollen institutionellen Rückhalt.
So haben die Vorstellungen der einen Seite in der Regel eine größere Verbreitung und einen stärkeren "Nachdruck" als die der anderen. Intellektuelle Debatten kann man "pushen", aber nicht erfinden. Sie ziehen nur dann Aufmerksamkeit an sich, wenn sie in ihre Zeit "passen"; was aber nicht heißen muß, daß sie ihre Zeit begrifflich verarbeiten. Besonders aufschlußreich ist es, wenn dem Verlauf einer Debatte unter Berufung auf ein aktuelles Ereignis von historischer Dimension eine andere Richtung gegeben werden kann, wenn dadurch die Möglichkeit besteht, die eigene Definitions- und Zurechnungsmacht zu stärken und die Gegenseite mit dem Verdacht des moralisch Verwerflichen zu überziehen. Das ist bei der Frage, was man nun von den 68ern und ihrem Verhältnis zur Bundesrepublik halten soll, der Fall.