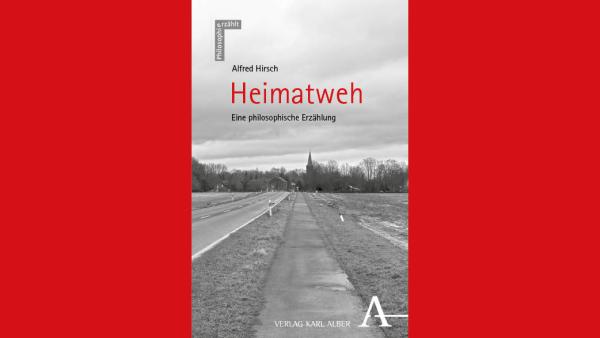Über Hitlers willige Vollstrecker als Gegenstück zur historischen Erklärung
Von einem Buch und seiner Wirkung soll die Rede sein, nicht mehr von der Legende über ein Buch, vom angeblichen Vorwurf der Kollektivschuld und der Behauptung eines unabänderlichen Nationalcharakters - auch nicht von dem, lieber Daniel Goldhagen, was wir einander vor wenigen Wochen in New York versprochen haben: daß es doch endlich einmal zur Diskussion der Differenzen kommen möge. Die Rede sei von dem Erfolg eines Buches in Deutschland, und der ist ja nicht nur bemerkenswert, sondern auch merkwürdig.
So albern es natürlich ist, ihn auf, wie zuweilen geschehen, den Charme seines Verfassers zurückzuführen (womit ich den allerdings auch nicht in Abrede stellen möchte), so gehört wenigstens zu einem B e s t s e l l e r doch mehr als bloße Qualität. Ein Bestseller ist ein Angebot, das eine bestehende Nachfrage befriedigt - worin bestand die? Als "Schindlers Liste" ein Erfolg wurde, wollten die Kritiker dieses Films den als ein angenommenes Exkulpationsangebot verstehen. Sie hatten aber unrecht. Nicht der endlich einmal gefundene "gute Deutsche" war das, was diejenigen, die den Film sahen, beschäftigte, sondern das Thema der individuellen Verantwortung anders gesagt, das der individuellen Freiheit.
Als Daniel Goldhagens Buch ein Erfolg wurde, wurde es zuweilen in Nachbarschaft oder Nachfolge dieses Films gesehen, und manchmal war das als Einwand gemeint.