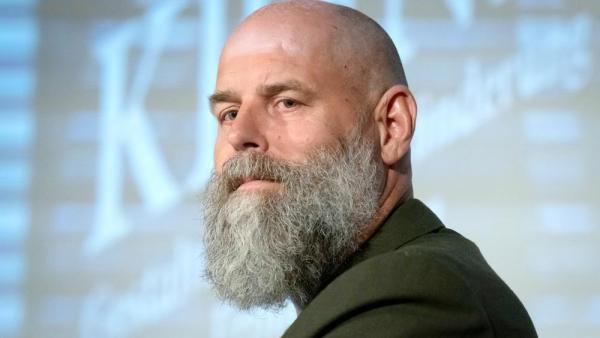Der Film beginnt mit einem einfachen Schwarzweiß-Titel, der darauf hinweist, daß es sich um eine Channel-four-Produktion handele. Das erinnerte mich an eine Karikatur, die ein Kino mit einer Riesenleinwand zeigt, auf der in der Mitte ein ganz kleines Bild zu sehen war, worauf ein Zuschauer zum anderen sagt: "Oh, it's another channel-four-film" .
Channel four, das steht nicht nur für ein kleines, womöglich unbuntes Bild, sondern auch für Dokumentarismus, public tv, nichtkommerzielles Fernsehen, seriöse Information statt Action und überwältigende Bild und Toneffekte. So beginnt auch Michael Winterbottoms Film Welcome to Sarajewo. Schwarzweiße Bilder im Normalformat, anscheinend Reportageaufnahmen von den Straßenkämpfen in Sarajevo, die beim Zuschauer Medienerfahrungen aufgreifen - um sie zu hinterfragen, zu deuten, weiterzuführen? Dann aber wechselt der Stil: Langsam färbt sich das Bild, um schließlich nach links und rechts auseinanderzufahren. Der Ausschnitt vergrößert sich aufs Cinemascope-Format. Mit diesem Übergang wird eine Grenze markiert und überschritten, und dies in der Folge mehrfach. Immer wieder werden TV-Bilder eingeschnitten, man erkennt sie an der streifigen Fernsehqualität, aber es bleibt oft unklar, ob auch sie nachinszeniert sind.
Das Vorgehen der Grenzüberschreitung wird systematisch eingesetzt: Einmal, als Einheimische die Reporter entdecken, wie sie Verstümmelte und Verreckende aufnehmen, auf sie zulaufen und am weiterdrehen hindern, hört die Fernsehkamera auf zu laufen, aber der Film geht weiter. In hochauflösender Bildqualität sehen wir die Fortsetzung der Szene, nun aufgenommen von der unsichtbaren, fest stehenden, kunstvoll schwenkenden oder fahrenden Kamera des Spielfilmerzählers. Sie fängt ein, was die Reporter gerne zeigen würden, den wirklichen Tod live, die Treffer der Bomben in Häuser und der Gewehrkugeln in Menschen "on the air". Mit allen technischen Effektmöglichkeiten wird der Angriff von Heckenschützen auf eine Hochzeitsgesellschaft, der aus dem Hinterhalt verübte Mord an einem jungen Bosnier in seiner Wohnung nachinszeniert.
Aber auch offensichtliche Dokumentaraufnahmen (sogenanntes Fremdmaterial) werden der Aufbereitung zu Breitwand und Stereoton unterzogen und nachsynchronisiert: Schüsse und Bombeneinschläge kommen in voller Lautstärke, assimilieren sich scheinbar den Megabässen der Rockmusik an: wumm wumm. Genau wie die Geräusche des zur Atmo aufbereiteten Kriegs ist die Rock- (oder Techno- oder was immer-) Musik aus dem Off pausenlos aufdringlich stampfend präsent.
Dagegen haben Worte, Seufzer, Schreie selten eine Chance, der Soundtrack gehört den Mördern und denen, die sich in makabre Witze, Bars und Schönheitswettbewerbe flüchten, um den allgegenwärtigen Tod zu verdrängen. Aber das Absurde wird nicht angeprangert, sondern hat die Haltung des Erzählers selbst schon infiziert: Wenn im Vorspann die Namen der Mitwirkenden Buchstaben für Buchstaben auftauchen, ist dies synchron mit Maschinengewehrsalven unterlegt.
Der Film hat auch einen Plot. Der Journalist Michael Henderson rettet ein Kind aus dem Inferno und nimmt es in sein Haus mit englischem Garten auf. Zuvor muß er in Sarajevo noch die Mutter ausfindig machen, um ihr Einverständnis für eine Adoption zu erhalten. So naiv wie diese Rührgeschichte ist auch den Umgang mit den Themen, die der Film eigentlich in den Mittelpunkt stellen will: der umsinnige Krieg in Jugoslawien, die aus Hilflosigkeit zynische Medienberichterstattung, lächerliche Propagandaauftritte westlicher Politiker. Letztlich erweist sich der Erzähler als ebenso überfordert wie seine Protagonisten, und wenn er sich auch mit grellen Blutbildern dagegen wehrt, so entgeht er doch nicht den Gesetzen des Hollywood-Infantilismus, der in jedem Krieg nur ein Spiel zwischen den Guten und den Bösen sieht. Und wenn auch Zigtausende guter Männer, Frauen und Kinder umkommen (die bösen werden nicht gezählt), so wird doch eins gerettet, und alles ist gut.