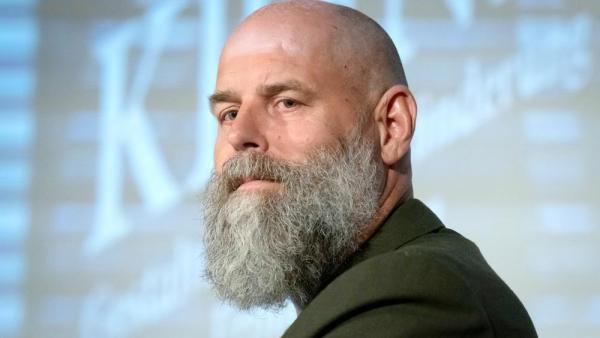"Beim Fernsehprogramm", sagt Inge Meysel, "geht's mir wie mit meinen Zähnen: Die dritten sind die besten." Das Dritte des WDR ist jedenfalls an der Spitze der Avantgarde. Zum zweiten Mal schon gab es am 6./7. September Feuersteins Nacht. Von 20.15 Uhr bis um 8 Uhr am nächsten Morgen war der Kölner Severins Kirchplatz in eine große Studioanlage verwandelt worden. Von einer Dachwohnung aus organisiert Herbert Feuerstein, Harald Schmidts ehemaliger Watschenmann, durch die verschiedensten Kommunikationssysteme mit einer unsichtbaren Regie und der Außenwelt verbunden, eine Folge von Programmpunkten, die eine Mischung von Fernseh-Alltag und Alltags-Fernsehen genannt werden könnte. Denn die zwölfstündige Mammutsendung ist geprägt von dem Widerspruch, einerseits unspektakulären Alltag, andererseits doch Unterhaltung bieten zu wollen.
Der Ablauf der Nacht hat daher auch die typische Magazin-Struktur eines normalen Programmschemas: Alle Stunde gibt es die Zeitansage (gesprochen von einem Queen Elizabeth-Double), dazu in bunter Folge: Vortrag von zugefaxten Gute-Nacht-Gedichten, von Theaterszenen und Liedern, Schaltungen zu ARD-Korrespondenten in aller Welt, eine Serie über die Abenteuer des Hundes Billy, Gespräche mit Promis (Uta Ranke-Heinemann, Willy Millowitsch) etc. Herbert Feuerstein, der in seiner Wohnung von einem Kameramann ständig im Bild behalten wird, ist Moderator, Ansager und Regisseur von ca. 200 Programmnummern, dies jedoch betont amateurhaft und pannengeplagt. Im Lauf der Zeit gewöhnt man sich an die vage Zeitstruktur, sie imitiert (und karikiert) die beiden wesentlichen Prinzipien des Fernsehprogramms: Wiederholung und Variation. Der undramatische, aber doch narrative Charakter des Ablaufs erscheint wie die Verlängerung der Handlung einer daily soap ins Alltagsleben. Man unterhält sich mit Freunden, schaut, was vor der Haustür vor sich geht, beschäftigt sich mit seinem Hund, kocht sich was zu Abend, geht ins Bett, steht wieder auf und sieht, zwischendurch, immer wieder fern.
Partner und Nachbarn werden zu Nebendarstellern: Anke, das junge Mädchen von nebenan, das nach jedem Umziehen attraktiver aussieht, Götz Alsmann, der Kollege, der unten auf dem Platz die Moderation (wenigsten für die halbe Nacht) macht, Biolek, der Koch-Freund, Eva Herrmann, die verkörperte ARD sowie das versammelte Rundfunkorchester. Feuerstein schwärmt "Oh ist das schön - herrlich - Tagesschau - wir sind alle Freunde, eine einzige große Familie. Bei den Privaten gibt's nur Haß, Neid, Totschlag, und sonstwas. Hier, gibt's auch Haß, Neid, Totschlag und sonstwas, aber zusätzlich lieben wir uns eben."
In dieses noch Fernseh-Normalität limitierende Programmkonzept paßt nicht mehr jene Szene zwischen 4 und 5 Uhr morgens, in der Feuerstein sich für ein kurzes Nickerchen ins Bett legt. Da wird weder die Übertragung unterbrochen, noch ingendein Lückenfüller eingespielt. Wir sehen eine Stunde lang den schlafenden Feuerstein von der unbeweglichen "Überwachungskamera" (Einblendung) aufgenommen - und es erscheint trotzdem wichtig, daß wir präsent bleiben, bis der Wecker klingelt. Der Apparat ordnet sich den Schlafbedürfnissen des Menschen unter, und das wird gezeigt.
Nicht nur hier gibt die Sendung Allmachtsphantasien und Autoritätsansprüche der Anstalt gezielt dem Schmunzeln und dem Zweifel preis. "Sehr sehr schwierig. Ich kann mit solchen Gesprächen gar nicht umgehen, ich weiß auch nicht wieso", sagt Feuerstein nach einem mißglückten Interview mit "Steffi" in einem Puff. Das Grübeln bei Nacht könne man vertreiben durch den Glauben, sagt Pfarrer Fliege, aber Atheist Feuerstein ist nicht überzeugt, und wir auch nicht: Feuersteins Nacht ist in jedem Fall besser, auch wenn man vor Langeweile vorübergehend einschläft, denn das gehört hier dazu. Und überwacht werden wir nur von uns selbst.