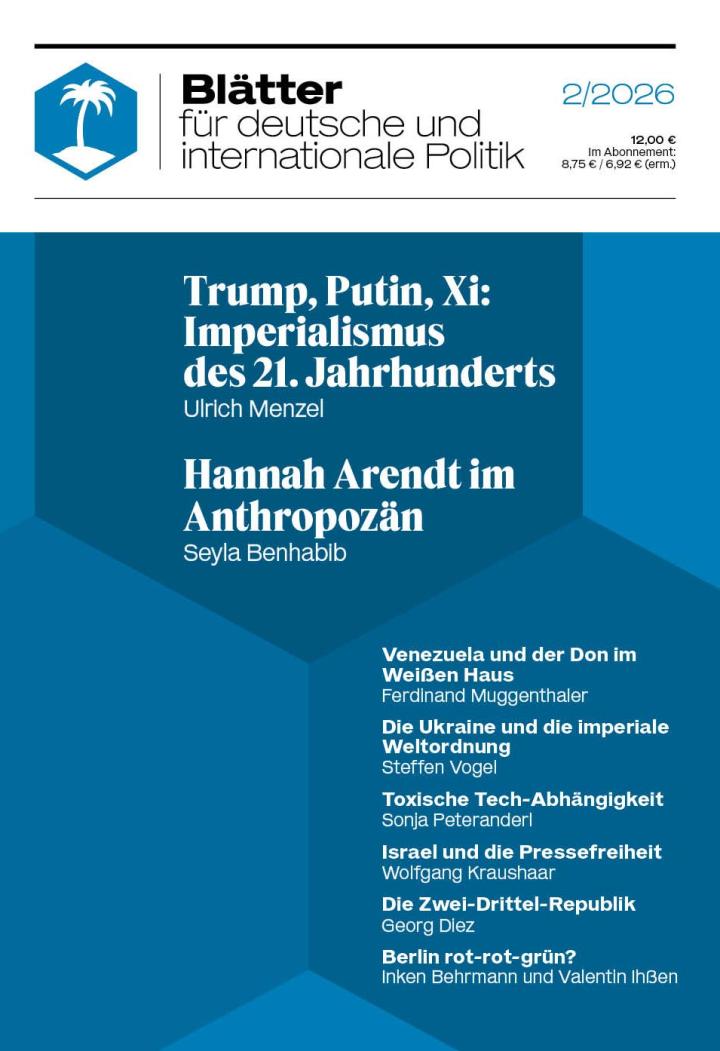Das Verbot der Wiederaufarbeitung zum 1. Januar 2000 war eines der ehrgeizigen Ziele des grünen Bundesumweltministers Jürgen Trittin. Vor einem Jahr wurde er nach heftiger Intervention der Stromkonzerne von Bundeskanzler Gerhard Schröder ausgebremst. Seitdem wird beim Atomausstieg weiter auf den Konsens gesetzt. Im Zentrum der Auseinandersetzung standen in der Folgezeit die Laufzeiten der 19 bundesdeutschen Atommeiler. Bis Ende des Monats solle ein kompromissfähiges Papier ausgehandelt werden, vereinbarten die vier großen Atomstromer Veba, Viag, RWE und EnBW mit Bundeskanzler Gerhard Schröder am 4. Februar. Den grün-grünen Konflikt organisierte einzig der niedersächsische Landesverband. Auf einem Sonderparteitag am 6. Februar 2000 in Celle erhob man Forderungen, die von der Konsensstrategie abweichen: statt des Bestandsschutzes für den atomaren Kraftwerkspark dafür steht die Formel 30+3 (dreißig Jahre Laufzeit und drei Jahre Übergangsfrist für die ältesten Meiler bis zu deren Abschaltung) - wurde die Stillegung von mindestens drei AKWs noch in dieser Legislaturperiode gefordert. Und weiter: die Stillegung der Kraftwerke dürfe nicht zu Zugeständnissen im Bereich der nuklearen Entsorgung führen. Bauern aus Lüchow-Dannenberg waren mit ihren Traktoren nach Celle gefahren, um gegen den Atomkurs von Rot-Grün zu protestieren. Aber bildet die Bewegung noch mehr als die Kulisse für parteipolitische Winkelzüge? Auffällig ist jedenfalls, wie wenig entwickelt die Reflexion über die eigene Rolle seit dem Regierungsantritt des Schröderkabinetts ist. Hinterher weiß man es natürlich immer besser. Und zu den Besserwissern gehört notorisch auch die Anti-AKW-Bewegung. "Konsens ist Nonsens" lautet ihre Parole schon von jeher. Das galt 1992/93, nachdem die RWE- und Veba-Chefs Friedhelm Gieske und Klaus Piltz Gespräche zwischen der Energiewirtschaft und Parteienvertretern mit dem Ziel eines "parteiübergreifenden Kernenergiekonsenses" vorschlugen. Der Versuch, zu dem auch Gewerkschaften und Umweltverbände geladen waren, wurde schließlich ergebnislos abgebrochen.
Rot-grüne Signale
Nun wollen es die Nachfolger von Kohl, Merkel & Co besser machen. Aber dass der Konsens, würde er denn zwischen Rot-Grün und der Branche zu Stande kommen, kein gesellschaftlicher wäre, den Streit um die Atomkraft keineswegs beigelegen und befrieden könnte, das ist heute nur einigen grünen Spitzenpolitiker/innen nicht ganz klar. Die nordrhein-westfälische Umweltministerin Bärbel Höhn oder die Fraktionschefin Kerstin Müller argumentieren, wenn das Atomausstiegsgesetz beschlossen würde, verebbten die Anti-Castor-Blockaden. Und der Bundesumweltminister glaubt sogar, ein Moratorium für den Endlagerbau in Gorleben würde den Widerstand im Wendland moderieren. So feiert die Nonsens-Parole im Widerstand fröhlich Urstände und wird durch rot-grünes Lavieren unterfüttert. Eine historisch-vergleichende Betrachtung unterbleibt, weil im Alltagsgeschehen das rotgrünes Regierungshandeln eine ablehnende Stellungnahme nach der anderen herausfordert. Beispielhaft dazu passt die Aufregung um die Aufhebung des Castortransportestopps durch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) eine Woche vor der vierten Konsensrunde am 4. Februar. Ein klares politisches Signal. Jürgen Trittin stand bei der Branche, die ihm vor einem Jahr bei der Debatte um das WAA-Verbot einer Verstopfungsstrategie bezichtigte, im Wort.
Nun verzichtet die Regierung auf den Atomgesetzvollzug. Hängt der Betrieb eines AKW unter RotGrün nicht mehr von dem Nachweis einer gesicherten Entsorgung ab? Wer hat es zu verantworten, dass bei Castortransporten Grenzwerte überschritten wurden (Stichwort "Kontaminationsskandal")? Wer hat den Nachweis zu erbringen, dass Castoren Extrembelastungen standhalten? Es wird doch hoffentlich noch die Nuklearindustrie sein! Wir haben mittlerweile einen grünen Präsidenten des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) und einen grünen Umweltminister, und was passiert? Sie nehmen die Castorhersteller gegenüber den Kritikern in Schutz. Noch in der Opposition argumentierten auch Grüne wie die Öko-Institute und die Anti-AKW-Bewegung, verwiesen auf konzeptionelle Mängel des Castorbehälters, fehlende Sicherheitsnachweise wie fehlende Falltests mit Originalbehältern. Als Anfang Januar in der ARD-Sendung "Plusminus" der Nachweis erbracht wurde, dass die Castorbehälter am Rechner geprüft wurden, reagierte ein Sprecher der Trittin-Administration mit dem Satz, das alles sei "hahnebüchener Unsinn". Wenn - wie noch im Koalitionsvertrag - richtig festgestellt wird, dass das Entsorgungskonzept der Kohl-Ära als gescheitert anzusehen ist, wenn sogar in interministeriellen Arbeitspapieren der Nachweis geführt wird, dass die Wiederaufarbeitung nicht dem Gebot der schadlosen Verwertung entspricht und natürlich auch kein Beitrag zur "geordneten" Beseitigung des Atommülls ist, dann gehört sie verboten und/oder als Entsorgungsnachweis nicht anerkannt. Nicht dass Bürgerinitiativen mit den geforderten Sicherheitsnachweisen oder dem Verbot der Wiederaufarbeitung zufrieden zu stellen wären. Beides beseitigt den angefallenen Atommüll noch lange nicht, würde aber den Blick frei machen für Lösungsansätze. Ein zügiger Atomausstieg könnte am ehesten den Weg ebnen für die Beteiligung auch der Anti-AKW-Experten an der Atommüllentsorgung, und allein ein Endlager und nicht weitere Zwischenlagerstätten dürften mit der Etikette "Entsorgung" belegt werden, selbst wenn die Sorgen dann wegen der Langzeitprobleme nicht einmal wie jener Atommüll dauerhaft begraben werden könnten.
Vom "Sofortausstieg" zur Befristung
Wer wäre schon Fan des geltenden Atomrechts aus der Merkel-Zeit? Aber selbst nach den Buchstaben dieses geltenden (Un-)Rechts gäbe es Handlungsmöglichkeiten für ein Ministerium, das sich der Sicherheit der Menschen vor der Strahlung und nicht der Sicherung der Profite von Reaktorbetreibern verschriebe. Sand im Getriebe zu sein - zuviel verlangt für eine Regierung? Die Anti-AKW-Bewegung war es schon immer, allerdings auf anderen Handlungsebenen. Das zu verkennen wäre ein gewaltiger Fehler. Der Bewegung steht es frei, die rot-grüne Regierungspolitik zu kritisieren und die Konsensverhandlungen in Bausch und Bogen zu verwerfen, sie an radikalen Forderungen zu messen. "Sofortausstieg!" - diese Forderung ist recht und billig. Recht, weil der Reaktorbetrieb auch dann nicht zu billigen ist, wenn er befristet wird. Immer noch wird Radioaktivität in bedenklichen Mengen emittiert, immer noch besteht die Gefahr von unkalkulierbaren Störfällen mit verheerenden Folgen, immer noch wird Atommüll produziert, von dem kein Mensch ernsthaft sagen könnte, wohin damit in verantwortbarer Weise. Aber auch billig, weil man mit der Forderung Antworten auf die Frage verweigert, wie aus einem unbefristeten Reaktorbetrieb auf einen Schlag ein befristeter wird. Befristet schreibe ich aus großer Verlegenheit. Denn ich kenne niemanden, der seriös und unter Beachtung der rechtlichen und machtpolitischen Verhältnisse dargelegt hätte, was "sofort" eigentlich bedeutet. Die rot-grüne Regierung huldigt dem Primat der Ökonomie.
In der Frage des Atomausstiegs heißt das: Ausstieg ja - aber er darf nichts kosten. Die Entschädigungsfreiheit ist das Prinzip, und da können wir lange auf "Schnitte" warten. Das Versagen der Grünen in dieser historischen Konstellation (denn wer weiß, ob es jemals wieder eine Regierung gibt, die das Thema Atomausstieg auf die Tagesordnung setzt?) beantwortet die Anti-AKW-Bewegung mit Gejammer und Schuldzuweisungen. Sicher, die Grünen müssen beim Wort genommen, ihr Versagen benannt werden. Aber wo bleibt die Rückbesinnung auf die eigene Kraft und die eigene gesellschaftliche "Aufgabe"? Es geht nicht um Verbalradikalität à la "Sofortausstieg", sondern um die Authenzität der Forderungen, die sich paaren muss mit einem Bündel an Fähigkeiten: Kongresse zum Strahlenschutz, energiepolitische Ratschläge, Symposien zum Demonstrationsrecht, Fachtagungen zu Endlagerkriterien, Pressekonferenzen, das alles und noch viel mehr ist ebenso wichtig wie die Teilnahme an Erörterungsterminen zum Bau dezentraler Zwischenlager und die nächste Blockade. Handlungsfähigkeit ist also mehr als Aktionsfähigkeit, und hier gibt es in der Bewegung große Defizite. Am Ende ist allerdings immer auch die Aktionsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Nur so besorgen die außerparlamentarischen Initiativen das gesellschaftliche Klima, das - in diesem Fall - Rot-Grün dazu zwingt, sich mit dem Atomausstieg zu befassen. In Ahaus und Gorleben/Arendsee bereiten sich die Bürgerinitiativen auf den nächsten Transport vor, im Wendland mobilisiert die Bürgerinitiative auch gegen den Betriebsbeginn der Pilot-Konditionierungsanlage in Gorleben - einer Atommüllfabrik, die überflüssig wäre, würde das Endlager Gorleben nicht realisiert. Die bundesweit organisierte Aktionsgruppe "X-tausendmal-quer" will künftig an den AKW-Standorten die Atommülltonnen blockieren, die Entsorgung der Kraftwerke "verstopfen" und auf diesem Wege deren Stilllegung erzwingen.
Gefährliche Kontinuitäten
So richtig es ist, mit Blockadeaktionen direkt an den AKW nicht zu warten, bis ein Castor aus La Hague nach Gorleben rollt oder in Ahaus eintrifft, so größenwahnsinnig und naiv wäre es anzunehmen, durch direkte Aktionen könnten wir direkt (Ausstiegs-)Wirkung erzielen. Selbst gern erinnerte "Paradebeispiele" stellen sich bei näherem Hinsehen etwas anders dar. Zwar erklärte der einstige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU) die Aufgabe der WAA-Pläne in Gorleben mit den Worten, die WAA sei technisch zwar machbar, politisch aber nicht durchsetzbar, doch es war ein ganzes Bündel taktischer, ökonomischer und parteipolitischer Überlegungen, die in diesen Satz mündeten. Vor allem sollte die Bevölkerung im aufmüpfigen Wendland glauben, die Planungen zum Bau des nuklearen Entsorgungszentrums würden aufgegeben. Der Konflikt sollte entschärft, die Bauern beruhigt werden. Beispiele für direkte Einflussnahme sind also selten, für indirekte und nachhaltige Wirkungen finden sich jedoch zahlreiche. Vor allem gab es immer dann Erfolge, wenn die Investionsbereitschaft der Nuklearindustrie tangiert wurde. Der Konsensverlust in Staat und Gesellschaft habe in Deutschland seit 1988 Kernenergieinvestitionen in Höhe von 15 Mrd. DM zunichte gemacht, beklagte Roland Farnung, Vorstandsvorsitzender der RWE in seinem Jahresbericht 1995. Das Erfolgsrezept auch der "Anti-Castor-Bewegung" lag bisher darin, dass mit jedem Transport der politische und reale Preis für die Transportsicherung in die Höhe getrieben wurde. Niemand würde zwar auf eine Summe wetten, die den Staat oder die Atomwirtschaft zum Einlenken, also zum Verzicht auf Transporte bewegen könnte. Aber die Summe aller bisher angefallenen und absehbarer Kosten hat Gewicht.
Die Anti-Atom-Bewegung hat eine Wächterfunktion, sie gibt immer wieder Anstoß zur Ausstiegsdebatte - und gibt keine Ruhe, ganz gleich, was regierungsoffiziell beschlossen wird. Das ist ihre Stärke. Beharrlichkeit, aber auch Unberechenbarkeit. Dass es Ruhe geben könnte an der Atomfront, das dürften nicht einmal die grünen Spitzenpolitiker/innen glauben. Dass mit einem Ausstiegsbeschluss, der soviel wert ist, wie das Papier, auf dem er gedruckt wird, sich der Protest gegen Castortransporte befrieden liesse, reden sie sich und Journalisten ein. Es gibt bei den Grünen, auch bei der SPD, in den Gewerkschaften und in Kirchenkreisen viele Menschen, die für den Ausstieg ernsthaft zu streiten bereit sind. Somit liegt nahe, dass bei kommenden Castortransporten - und das ist seit Mitte der 90er Jahre wie im Moment die hervorragende Chance - Regierung und Wirtschaft das Konsensgeschäft verdorben wird. Ein Konsens, der eben kein gesellschaftlicher ist, "trägt" vielleicht nur bis zum nächsten Transportereignis. Die Bündelung von Botschaften und Forderungen und die Übersetzung von "Castor stopp" als "Atomkraft stopp" hat - noch - nichts an Kraft verloren. Vorerst wird die Argumentation für massenhafte Querstellerei nicht schwerer fallen als unter der Kohl/Merkel-Ära, denn Rot-Grün hat nichts erreicht. Was aber, wenn Konturen einer Ausstiegspolitik erkennbar werden? Wenn es ein, zwei stillgelegte AKW bis zum Ende der jetzigen Legislaturpenode gibt? Absehbar ist, dass die Ungleichzeitigkeit der Ereignisse die Anti-AKW-Bewegung erschüttern könnte, wenn keine Selbstreflexion stattfindet. Was passiert, wenn in Ansätzen der Atomausstieg realisiert würde, wenn die Atommüllentsorgung neu geordnet würde? Wie würde die Bewegung auf das Ende der Wiederaufarbeitung reagieren, wenn aber noch Kokillen mit hochradioaktiven verglasten Abfällen nach Deutschland zurückgenommen werden müssen? Welche Probleme stellt der Rückbau von Atomanlagen, wohin mit dem Strahlenmüll, der aus dem Abriss eines AKW resultiert? Es wird entscheidend darauf ankommen, wer im Atomkonflikt die Definitionsmacht erobert, wer also bestimmt, was der "Atomausstieg" ist.
Wenn es Rot-Grün gelingt, die Wahrung des Bestandsschutzes als Ausstieg zu verkaufen, wenn der außerparlamentarische Protest als primär "fundamentalistisch" oder als "Veteran/innenbewegung" verspottet wird (zahlreiche Beispiele dafür lieferten im letzten Jahr die "Süddeutsche Zeitung' der "Spiegel" und selbst die "taz"), wenn von der (Un-)Sicherheits- bzw. Risikodebatte nichts bleibt und die Akteure des Protests in erster Linie sich selbst, die Experten und Kerne, und nicht mehr "die Massen" bewegen, droht die Atomisierung der Bewegung. Dass es bislang nur klare, bruchlos an die Vergangenheit sich anschließende Positionen in der Anti-AKW-Bewegung gab, belegt zum einen, dass die Regierung in Sachen Atomausstieg nicht für greifbare Ergebnisse gesorgt hat. Es belegt aber auch die Wagenburgmentalität der Bewegung, die ihre Identität und Einheitlichkeit riskiert, gäbe es erkennbare Veränderungen.