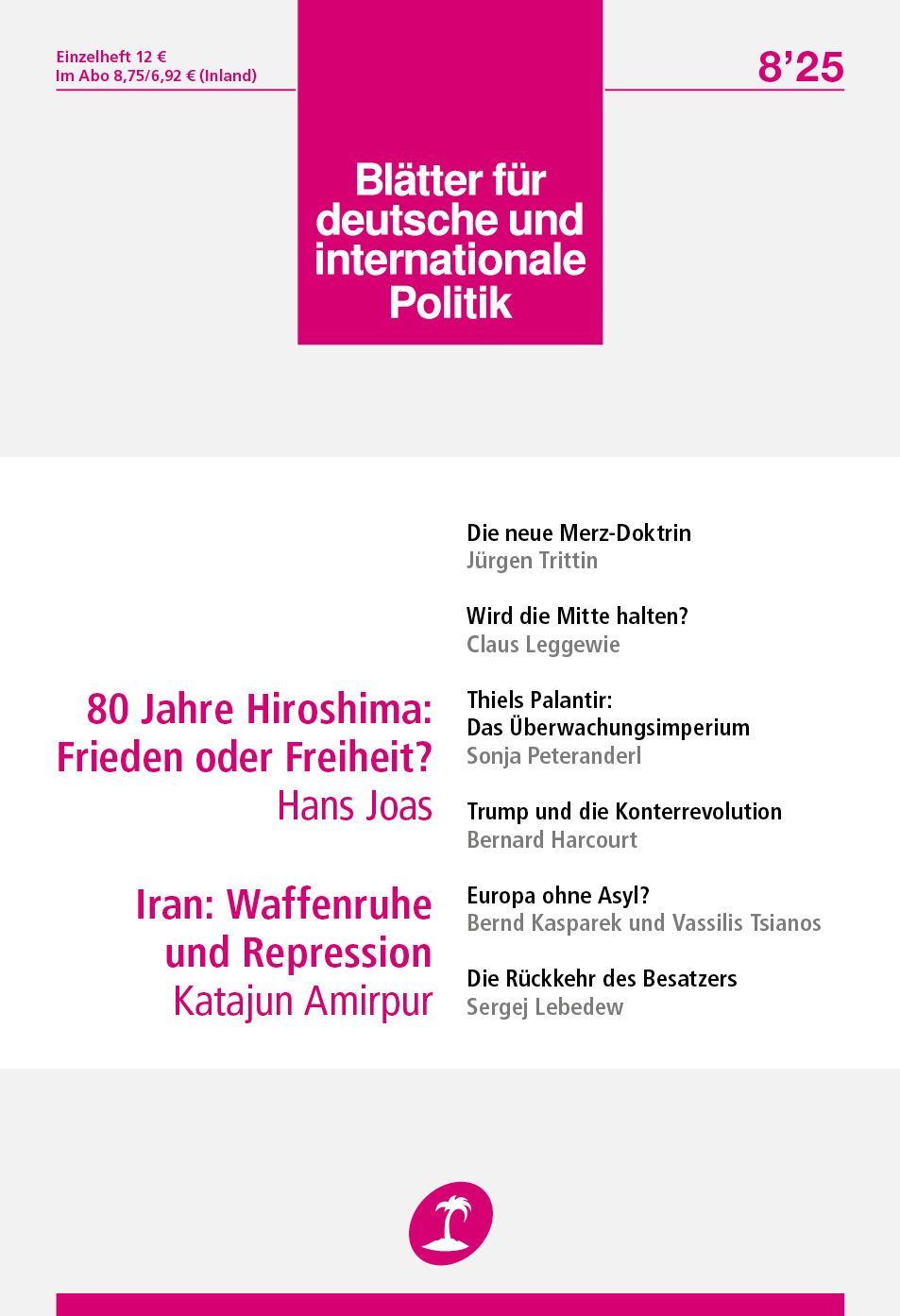80 Jahre Hiroshima und die mögliche Auslöschung der Menschheit

Bild: Eine Atomwolke über Hiroshima, Japan, die entstand, als die US-Streitkräfte eine Atombombe auf die Stadt abwarfen, 6.8.1945 (IMAGO / CPA Media)
Denn eines hat sie erreicht, die Bombe: ein Kampf der Menschheit ist es nun. Was Religionen und Philosophien, was Imperien und Revolutionen nicht zustande gebracht haben: uns wirklich zu einer Menschheit zu machen – ihr ist es geglückt. Was alle treffen kann, das betrifft uns alle. Das stürzende Dach wird unser Dach. Als morituri sind wir nun wir. Zum ersten Male wirklich.“[1] So schrieb der Philosoph Günther Anders 1956 in seinem wegweisenden Buch „Die Antiquiertheit des Menschen“, das mehr als jedes andere vergleichbare Werk dem Gedanken Ausdruck verlieh, dass neben „Auschwitz“ und „Gulag“ ein drittes Symbol für die Menschheitsverbrechen des zwanzigsten Jahrhunderts stehen müsse, nämlich „Hiroshima“, der Abwurf der ersten Atombombe am 6. August 1945.
Die bei Anders zugrundeliegende Einschätzung war und ist höchst kontrovers, und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist die Rechtfertigung des Einsatzes der neuen Art von Bomben durch die USA im Krieg gegen Japan 1945 umstritten, zum anderen stellt sich die Frage, ob denn die Idee der Menschenrechte durch eine solche kriegerische Handlung überhaupt tangiert sei. Wer die moralische Rechtfertigungsfähigkeit infrage stellt, dem wird sogar entgegengehalten, dass der Einsatz der Bombe die japanische Kapitulation herbeigezwungen und damit den Krieg verkürzt und andere mögliche Opfer verschont habe. Vehement wird in den USA meist bestritten, dass die Entscheidung von Präsident Truman und das Handeln der Führungsmacht des Westens mit den Verbrechen von Faschismus, Nationalsozialismus und Stalinismus auf eine moralische Stufe gestellt werden dürfe. Der bloße Versuch dazu wird, besonders wenn er von Deutschen oder Japanern kommt, leicht als bewusste oder unbewusste Schuldentlastungsstrategie abgewiesen.
Gegen diese pauschalen Rechtfertigungen wird wiederum eingewandt, dass die abschreckende und kriegsverkürzende Wirkung der Bombe auch durch einen demonstrativen Einsatz abseits besiedelter Gebiete oder in nur dünn besiedelten Gegenden anstelle des Abwurfs über Großstädten hätte erreicht werden können und dass bei einem moralisch gebotenen Interesse an der Senkung der Opferzahlen Vorsorge für die medizinische Behandlung von hunderttausenden verstrahlter, aber nicht verstorbener Opfer hätte getroffen werden müssen. Stattdessen wurden nach der Okkupation Verstrahlungen geleugnet, Behandlungen verweigert und Informationen zensiert.[2]
Die Bombe und die Menschenrechte
Was das Verständnis der Menschenrechte angeht, berührt die hier aufgeworfene Frage deren Kern. Die moralische Grundintuition der Universalität der Menschenwürde führt ja keineswegs nur zur Garantie individueller Freiheitsrechte. Schon die Allgemeine Erklärung von 1948 legte in mehreren Artikeln auch soziale und wirtschaftliche Rechte nahe, so ein Recht auf soziale Sicherheit, auf Arbeit und Schutz vor Arbeitslosigkeit, Erholung, Freizeit, Bildung und Wohlfahrt im Sinne von Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztlicher Versorgung und notwendiger sozialer Leistungen etwa im Alter. Bei allen derartigen Bemühungen im Rahmen der Vereinten Nationen sind diese Artikel, obwohl einigen der Verfasser der Erklärung sehr viel an ihnen lag, im Lauf der Zeit im allgemeinen Bewusstsein eher in den Hintergrund geraten. Es lag ihnen der Gedanke zugrunde, dass der Genuss der Freiheitsrechte die schiere Sicherung der Existenz voraussetzt. Man könnte dann aber sagen, dass dies a fortiori auch für die Sicherung der Existenz von Zivilisten gegen Angriffe auf ihr Leben im Krieg gilt und in dieser Hinsicht noch mehr als alle Angriffe mit konventionellen Waffen der Einsatz von Nuklearwaffen gegen Zivilisten eo ipso ein Verbrechen gegen die Menschenrechte darstellt.
Weder die empirischen noch die normativen Fragen sind in diesem Zusammenhang erschöpfend zu behandeln. Es kann hier nur um einen einzigen Gesichtspunkt gehen, nämlich den, ob die Ausblendung dieser Fragen zu einer Vereinseitigung des Menschenrechtsdiskurses geführt hat, die dringend überwunden werden muss. Hat die Existenz dieser historisch neuen Art von Waffen unerhörter Zerstörungskraft die Situation des moralischen Universalismus fundamental verändert? Ist diese Veränderung, wenn sie denn gegeben ist, in den Diskurs über die Menschenrechte eingedrungen?
Blickt man unter diesem Gesichtspunkt zunächst auf die zeitgenössische Verarbeitung des Atombombenabwurfs auf japanische Großstädte, dann überrascht das geringe Echo im philosophischen und theologischen Diskurs der Zeit. Nicht die Vertreter dieser sinndeutenden Fächer bestimmten die Debatten, sondern die Physiker.[3] Getrieben von der Erforschung ihres eigenen Gewissens, der Frage nämlich, ob die Verwicklung ihrer Forschungen in das Projekt der Atombombe zu ihrer moralischen Mitverantwortung für die Opfer des ersten Einsatzes dieser Waffe geführt habe, entwickelten sich weitreichende Debatten über die Rolle naturwissenschaftlicher Forschung sowie Initiativen zur Verhinderung einer Weiterverbreitung dieser Waffen und eines erneuten Einsatzes. Am bekanntesten von allen diesen Initiativen dürfte das Manifest sein, das der berühmteste aller lebenden Physiker, Albert Einstein, kurz vor seinem Tod unterzeichnete und das von einem der angesehensten Philosophen der Zeit, Bertrand Russell, 1955 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Die entscheidende Stoßrichtung dieser Initiative war es, zu verdeutlichen, dass in einem neuen nuklearen Krieg – wenn beide Seiten über diese Waffen verfügten –, „keine Seite darauf hoffen kann, als Sieger hervorzugehen, und dass im Falle solch eines Krieges die echte Gefahr besteht, dass Staub und Regen radioaktiver Wolken die Menschheit vernichten“. In seiner Autobiographie zitierte Russell später daraus weiter, „dass sich weder die Öffentlichkeit noch die Regierungen der Welt dieser Gefahr zur Genüge bewusst“ seien. Eine bloße vertragliche Einigung über den Nichteinsatz von Atomwaffen sei zwar spannungsmindernd, böte aber letztlich keine Gewähr, dass diese Waffen nicht doch laufend produziert und, abweichend von den Verträgen, vielleicht doch eingesetzt würden. „Für die Menschheit ist die Vermeidung des Krieges die einzige Hoffnung.“[4] In der Sicht der Unterzeichner des Manifests stellte also die neue Bombe tatsächlich einen epochalen Einschnitt dar. Anders als vorher müsse der Krieg nun um jeden Preis vermieden werden, da die Eskalation zum Nuklearkrieg das Risiko der totalen Vernichtung der Menschheit durch sie selbst enthalte und damit zum Schlimmsten, was unter dem Gesichtspunkt eines Menschheitsethos überhaupt vorstellbar sei. Durch die Existenz der Nuklearwaffen muss demnach der moralische Universalismus endgültig zu einem unbedingten Friedensgebot entwickelt werden.
Die Sorge vor einer solchen Eskalation erreichte im Kalten Krieg Anfang der 1960er Jahre ihren Höhepunkt, nämlich in der weltpolitischen Krise um den Mauerbau in Berlin 1961 und insbesondere in der Kubakrise von 1962. Danach und trotz der militärischen Intervention des Warschauer Pakts in der Tschechoslowakei im Jahr 1968 und trotz des Vietnamkriegs trat die Sorge immer mehr in den Hintergrund. Sie nahm am Beginn der 1980er Jahre im Zusammenhang mit der sogenannten Nachrüstung erneut zu und löste eine weltweite Friedensbewegung aus. Mit dem Ende des Kalten Krieges schien die Gefahr an der Front der konkurrierenden Imperien gebannt. An anderen Fronten blieb sie bestehen, erreichte jedoch bisher nie die Intensität des Kalten Kriegs.
Bei allen Verdiensten Russells und seiner Zusammenarbeit mit engagierten Physikern lässt sich freilich nicht behaupten, er habe selbst einen philosophischen Versuch zur Deutung der neuen welthistorischen Lage unternommen. Nicht die einzigen, aber doch die am tiefsten eindringenden denkerischen Versuche dazu wurden von zwei deutschen Philosophen vorgelegt, nämlich von Karl Jaspers und Günther Anders.
Jaspers ließ keinen Zweifel daran, dass für ihn durch die Atombombe „eine schlechthin neue Situation“ geschaffen worden sei. „Entweder wird die gesamte Menschheit physisch zugrunde gehen, oder der Mensch wird sich in seinem sittlich-politischen Zustand wandeln. Diese doppelt irreal anmutende Alternative versucht mein Buch zur Klarheit zu bringen.“[5] Die einzige Alternative zum Ausbruch eines Atomkrieges, der von nun an für immer das Risiko der Selbstauslöschung der Menschheit beinhalte, sah Jaspers in der „Konstituierung eines Weltfriedenszustandes ohne Atombombe“, wobei er diesen auch „mit dem neuen, wirtschaftlich auf die Atomenergie gegründeten Leben“[6] verbunden sehen wollte.
Sein Buch holte weit aus, um sowohl die Diagnose der Gegenwart als auch die Prinzipien eines künftigen Weltfriedens umfassend zu durchdenken. Schon in dem Buch „Vom Ursprung und Ziel der Geschichte“, das der Idee der „Achsenzeit“ und damit auch der Frage nach der Globalgeschichte des moralischen Universalismus zum Durchbruch verhalf, hatte Jaspers 1949 die Grundlinien seiner Idee einer künftigen „planetarischen“ Ordnung skizziert.[7] Noch ohne hauptsächlichen Bezug auf die epochale Veränderung durch die Existenz von Nuklearwaffen sprach er dort von der „großen planetarischen Not, die zur Verständigung drängt“, einer Machtsituation, in der die Entscheidung zwischen konkurrierenden Ansprüchen nicht mehr durch Gewalt getroffen werden könne „und über beiden die Idee einer solidarischen Menschheit“[8] stehe. Er analogisierte insofern die Gegenwart sogar mit der Achsenzeit, als ihm die Zeit der Entstehung der archaischen Staaten und der entsprechenden Imperien zu Ende zu gehen schien und sich in der Gegenwart etwas völlig Neues, der „Erdstaat“, abzuzeichnen beginne. Für den Weg zu diesem und seine innere Verfassung aber gebe es genau zwei Möglichkeiten, nämlich entweder ein „Weltimperium“ oder eine vertragsbasierte „Weltordnung“. In einer der beiden Richtungen müsse die Gegenwart sich entwickeln, und Jaspers ließ keinen Zweifel daran, welche Zukunftsvision er für erstrebenswert hielt. Das „Weltimperium“ ist für ihn ein Alptraum: „das ist der Weltfriede durch eine einzige Gewalt, die von einem Orte der Erde her alle bezwingt. Es hält sich aufrecht durch Gewalt. Sie formiert durch Totalplanung und Terror die nivellierten Massen“,[9] zwingt ihnen eine einheitliche Weltanschauung auf und reguliert alle geistige Tätigkeit. Die „Weltordnung“ dagegen „ist die Einheit ohne Einheitsgewalt außer der, die im Verhandeln durch gemeinsamen Beschluss hervorgeht“[10], Änderungen nur auf gesetzlichem Wege zulässt und Minderheiten schützt. Jaspers dachte an einen weltumspannenden Föderalismus, der allerdings auch die „Aufhebung der absoluten Souveränität“ und damit des früheren Staatsbegriffs „zugunsten der Menschheit“ beinhalte.[11]
Das Pathos von Jaspers’ Buch war zunächst kein politisches, wie es scheinen könnte, sondern ein ethisches. Er sprach mit seiner Philosophie vorrangig den Einzelnen an und betrachtete die historische Zeitenwende durch die Existenz von Nuklearwaffen als viel zu ernst und umfassend, als dass die Auseinandersetzung mit ihr den Politikern, Naturwissenschaftlern oder gar den Militärexperten überlassen werden dürfe. Jeder Einzelne sei nun moralisch herausgefordert. Dies geschah übrigens keineswegs in einer Situation, in der niemand außer einsamen Sehern oder verantwortungsethischen Physikern zum Engagement bereit gewesen wäre. Jaspers’ Buch erschien vielmehr im Jahr 1958, in dem in Deutschland der Kampf gegen die Atombewaffnung der Bundeswehr über Arbeitsniederlegungen und Schweigemärsche zu einer „regelrechten Volksbewegung“ anschwoll.[12] Die Öffentlichkeit war also zu diesem Zeitpunkt keineswegs gelähmt oder völlig einig. Aber unbegründet war Jaspers’ Furcht, nicht alle hätten die neue Lage begriffen oder seien willens, sich in ihr neu zu orientieren, keineswegs. Jaspers zog eine Parallele zur Todesverdrängung in der Lebensführung der Individuen, in der auch das sichere Wissen über das eigene Ende oft keineswegs in alle existentiellen Entscheidungen einfließe. Er ethisierte zudem die Frage des Wissens, das heißt, er behandelte das bewusste oder unbewusste Desinteresse an den Fragen, die alle angehen, nicht als moralisch neutral. Ebenso bezog er die Einsicht in die Fehlbarkeit des Menschen in seine Überlegungen insofern ein, als ihm ein blindes Vertrauen in die letztlich rationale Entscheidungsfindung von Politikern und Militärs als sachlich falsch und moralisch unzulässig erschien. Damit aber sei es gerade die Philosophie in ihrem Bezug zum Einzelnen, die zum öffentlichen Wirken aufgerufen sei: „Täglich muss es gesagt, begründet, hinausgerufen werden. Die Sache darf nicht zur Ruhe kommen, weder in der Öffentlichkeit noch in der Seele jedes Einzelnen.“[13]
Frieden oder Freiheit: Der Kampf um das Primat
Handeln im Sinne einer durch die neue Lage erforderlichen prinzipiell neuen Politik müssten aber keineswegs nur die jeweils Einzelnen. Insofern stellte Jaspers sehr wohl die Frage, wer hier der geeignete kollektive Akteur sein könne. Die naheliegende Idee, in den Vereinten Nationen diesen Akteur auf globaler Ebene zu sehen, schloss Jaspers als Möglichkeit kategorisch aus. Die UNO habe weder die Machtmittel zur Etablierung des Weltfriedens noch in ihrer gegenwärtigen Gestalt auch nur den wirklichen Willen dazu.
Wer aber kam dann infrage? An dieser Stelle trennten sich die Wege moralisch-universalistischer Denker in jener Zeit. Für Jaspers war die Entscheidung klar. Realistische Hoffnung konnte nur in diejenigen Mächte gesetzt werden, die in ihren eigenen Ländern und deren Zusammenwirken schon die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und vertraglich gesicherten, verrechtlichten internationalen Beziehungen verwirklicht hätten. Das waren für ihn die westeuropäischen Staaten, die den Prozess der europäischen Einigung begonnen hatten und auf diesem Weg fortfahren müssten, und die nordamerikanischen Staaten, die in diesen Einigungsprozess aufs engste einzubeziehen seien. Zu beiden Pfeilern eines transatlantischen Bündnisses hatte Jaspers durchaus kein unkritisches Verhältnis. So forderte er die europäischen Kolonialmächte dazu auf, endlich den Kolonien wirklich das zu gewähren, was diese anstrebten und was den normativen Prinzipien des Westens doch einzig entsprach: ihre vollständige Unabhängigkeit. So distanzierte er sich auch vom aggressivsten Flügel der amerikanischen Außenpolitiker, dem nicht nur an der Eindämmung des Kommunismus, sondern an dessen direkter Zurückdrängung gelegen war. Insgesamt aber lief Jaspers’ Analyse der neuen Weltsituation auf eine so einschränkungslose Unterstützung des westlichen Militärbündnisses hinaus, dass schon Zeitgenossen wie etwa die bedeutenden katholischen Philosophen Richard Schaeffler und Robert Spaemann in Jaspers’ Buch ein klares „Bekenntnis zur Nato“ bzw. „die geläufige Kombination von Nato und moralischer Aufrüstung“ sahen.[14]
Zu diesem in seiner Uneingeschränktheit angesichts von Jaspers’ Prämissen durchaus überraschenden Bekenntnis kam es auch deshalb, weil Jaspers die Menschheit nicht nur vor der Entscheidung übers Überleben sah, sondern vor allem auch vor der Entscheidung über die individuelle und die politische Freiheit. Ein Leben in Freiheit war in seiner Sicht die einzige dem Begriff des Menschen entsprechende Existenzform. Der Kalte Krieg zwischen West und Ost war damit für ihn nicht ein Ringen um die bessere oder schlechtere Einrichtung des Gemeinwesens mit den verschiedensten Abstufungen in der Verwirklichung der Ideale, sondern ein Kampf zwischen denen, die das Freiheitsideal teilten, und denen, die es prinzipiell ablehnten, ja zu seiner Bekämpfung entschlossen waren. In sein Buch baute er Elemente der Totalitarismustheorie ein, die nicht nur Faschismus und Kommunismus einander anähnelte, sondern die Welt normativ einer dichotomischen Unterscheidung unterwarf. Damit wurde der neue Zustand der Menschheit nicht nur zu einem, in dem die Selbstauslöschung der physischen Existenz der Menschheit zur realen Gefahr geworden war, sondern auch zu einem, in dem bei einem Sieg des Kommunismus die Auslöschung der menschlichen Freiheit drohe und damit zwar nicht die physische, aber die menschenwürdige Existenz an ein Ende komme. Diese Gefahr schien Jaspers so stark gegeben, dass sein Buch als eindeutiges Plädoyer für die nukleare Aufrüstung des Westens und zugleich für dessen immer weitere konventionelle Aufrüstung gelesen werden muss. Mehr sogar als die westlichen Politiker seiner Zeit mahnte er dazu, im Interesse der Freiheitssicherung auch ein „unvermeidliches Sinken des Lebensstandards“[15] hinzunehmen. Die eigentliche Zuspitzung durch Jaspers aber lag dort, wo er sich und die Leser mit der Frage konfrontierte, ob denn für die Verteidigung der Freiheit auch das Risiko des Endes der Menschheit eingegangen werden solle.[16]
Spürbar schreckte Jaspers selbst vor dieser letzten Zuspitzung zurück. Vielleicht würde ein Nuklearkrieg ja doch nicht den Untergang der gesamten Menschheit bedeuten: „Vielleicht würde doch ein Rest bleiben. Von den Orten her, an denen noch Leben ist, begänne von neuem, was wir uns konkret nicht vorstellen können. In Jahrzehnten oder Jahrhunderten würde die Reinigung der Erdoberfläche von der erzeugten Radioaktivität erfolgen und sie wieder zugänglich machen.“[17] Auch auf der anderen Seite der Gleichung seien die Annahmen nicht völlig gesichert. „Der Totalitarismus kann sich wandeln und von innen her selbst zerstören. Das Menschendasein kann von neuem die Freiheit und seine Möglichkeiten ergreifen.“[18] Bei all dieser Ungesichertheit müssten aber in konkreten Situationen eindeutige Entscheidungen getroffen werden. Jaspers formulierte sehr vorsichtig, wofür er votiert –, aber bei aller Vorsicht wird deutlich, was er denkt und sagen will. In der gesamten bisherigen Geschichte hätten alle, „die aufbauende Geschichte machten, die Freiheit mehr als das Leben“ geschätzt.[19] Wenn dies heute wirklich anders sein sollte – Jaspers formulierte in der Frageform –, dann wäre die überlebende Menschheit nicht mehr eine, die dem philosophischen Begriff des Menschen entspräche.[20]
Das alte Denken – in Kategorien von Freund und Feind
Von einem unbedingten Imperativ der Vermeidung eines Nuklearkriegs kann damit keine Rede mehr sein. So unvergleichbar in Ton und Inhalt Mao Zedong und Jaspers sind – die generelle Gewaltorientierung und der zynische Ton des einen, die strenge Orientierung auf Rechtlichkeit und Skrupulosität des anderen –, muss man doch eine Entsprechung feststellen.[21] Die Sache der Weltrevolution einerseits, das Anliegen der Freiheitssicherung andererseits scheinen das Risiko einer Auslöschung der Menschheit oder doch zumindest einer weitgehenden Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen zu rechtfertigen. Jaspers, der so stark auf das Ideal einer „neuen Politik“ gesetzt hat, das heißt einer Politik, die nicht nur Machtkampf ist, sondern auf echter Kommunikation und ernsthaftem Verständnis beruht, fiel letztlich dem typischen Schema der „alten Politik“ zum Opfer: Er schematisierte die Welt in Freund und Feind. Die innenpolitischen Gegner seines Aufrüstungsplädoyers beschuldigte er mangelnder Kenntnis dessen, was es heißt, unter „totalitären“ Bedingungen zu leben, oder moralischer Inkonsequenz. Den großen äußeren Feind Sowjetunion – Jaspers sprach fast durchgehend von „Russland“ – qualifizierte er so sehr mit polemischen ethnischkulturellen Stereotypen ab, dass ihm heute in dieser Hinsicht sogar eine „rassistische“ Haltung vorgeworfen wird.[22] Beides kann im Rückblick nicht verteidigt werden und erschreckt besonders bei einem Denker von Jaspers’ Format. Es kann eine Warnung darstellen vor ähnlichen Tendenzen in einem neuen Kalten Krieg.
Anders versus Jaspers
Schon zwei Jahre vor Jaspers’ Buch hatte der andere genannte deutsche Philosoph, Günther Anders, seine Gedanken „Über die Bombe und die Wurzeln unserer Apokalypse-Blindheit“ publiziert.[23] In großer, durch den Zwang ins Exil noch gewachsener Distanz zur akademischen Philosophie ging er nicht systematisch vor wie Jaspers, sondern umkreiste in immer neuen essayistischen und aphoristischen Anläufen sein Thema so, dass schon in der literarischen Form die enorme Erschütterung durch die neue historische Lage spürbar werden sollte. Der Leser sollte nicht moralisch zum Öffnen seiner Augen ermahnt werden, sondern die Augen sollten ihm schockhaft geöffnet, seine Blindheit auch gegen seinen Willen überwunden werden. Die Moralphilosophie müsse der epochalen Veränderung Rechnung tragen, durch die eine bisherige stillschweigende Voraussetzung, „dass es Menschen geben werde und solle“[24], nun infrage gestellt sei. Es sei nicht mehr sicher, dass es in der Zukunft eine Menschheit geben werde, und es ließe sich sogar fragen, ob es diese geben solle oder ob es moralische Gesichtspunkte geben könne, die höher stünden als die Fortexistenz der Menschheit. Was bisher höchstens „von einer Handvoll verzweifelter Nihilisten“[25] überhaupt in den Blick genommen worden wäre, sei jetzt zur unabweisbaren Frage geworden. Wenn die Philosophie bisher in ihrer existenziellen Dimension um die Sterblichkeit jedes Einzelnen gekreist sei, müsse sie sich jetzt neu orientieren im Zeichen der Einsicht: „Die Menschheit als ganze ist tötbar.“[26] Damit werde aber auch den sterblichen Individuen jeder Trost genommen, der in der Existenz von Nachkommen, der Hoffnung auf bleibenden Ruhm oder immerhin dem Gefühl liegen könne, einen Beitrag zum Ganzen geleistet zu haben. Wenn die Menschheit verschwinden werde, sei auch im Rückblick alles vergeblich gewesen. Ohne die Weiterexistenz der Menschheit werde es sie und alle einzelnen Erinnernden in ihr gewissermaßen nicht gegeben haben: „Kein Volk, keinen Menschen, keine Sprache, keinen Gedanken, keine Liebe, keinen Kampf, keinen Schmerz, keine Hoffnung, keinen Trost, kein Opfer, kein Bild, kein Lied, […] sodass das Gewesene sogar nicht einmal mehr Gewesenes sein würde – denn worin sollte sich denn, was nur gewesen ist, von niemals Gewesenem unterscheiden, wenn es niemanden gibt, der des Gewesenen gedächte?“[27] Die Bombe sei nicht angemessen verstanden, wenn sie weiterhin als Mittel gedacht werde, weil ihr Einsatz doch jede weitere Setzung von Zwecken und Verwendung von Mitteln verhindern werde.[28] Anders lehnte auch die Rede vom „Selbstmord der Menschheit“ ab, weil die unbedachte Verwendung des Menschheitsbegriffs hier eine Diffusion der moralischen Verantwortung darstelle. Dies tat er aber durchaus nicht, weil er umgekehrt einzelne Politiker, Militärs oder Physiker brandmarken wollte. Im Gegenteil ging es ihm um die gigantische Schwierigkeit der Zurechnung von Verantwortung in der neuen Lage – einer Verantwortung, die nicht nur die potentiellen Mörder, sondern auch die potentiellen Opfer – Anders spricht von den „morituri“[29] – hätten, weil jeder, der nicht genug zur Verhinderung der Katastrophe beitrage, sich schuldig mache.
Fortschrittsglaube und Apokalypse-Blindheit
Die Aufgabe, der sich Anders zu stellen versuchte, war damit selbst gigantisch. Er musste untersuchen, wie es sein konnte, dass so viele Zeitgenossen sich weigerten, den Tatsachen ins Auge zu sehen, und er musste Ideen entwickeln, was dagegen zu tun sei. Die Unangemessenheit unseres Vorstellungsvermögens angesichts der Reichweite der technischen Möglichkeiten veranschaulichte er anhand eines Interviews mit einem der Piloten, die die Bomben über Japan abgeworfen hatten. Gefragt, woran er bei seinem Fluge gedacht habe, soll er mit dem Verweis auf die noch nicht ganz abbezahlte Rechnung für seinen Kühlschrank zu Hause geantwortet haben.[30] In dieser „entsetzlichen Harmlosigkeit des Entsetzlichen“[31] sah Anders eine Parallele zu den Angestellten in den Vernichtungslagern des Dritten Reichs, die auch in völliger Abspaltung von ihrer Berufstätigkeit gute Familienväter sein konnten. Nur die Ausbildung „moralischer Phantasie“ durch neu zu konzipierende „Exerzitien“ helfe hier – in der Selbst- und Fremdbeobachtung. Anders nahm die Auseinandersetzung mit der Welt, in der die Atombombe entwickelt werden konnte, zum Ausgangspunkt einer weitreichenden Kulturphilosophie der Technik. Diese kann hier nicht weiterverfolgt werden. Sein Denken gipfelte in einer religionsphilosophischen Deutung des Fortschrittsglaubens und seines Endes im Zeichen der Bombe. In der christlichen Tradition sei „jede eschatologische Hoffnung“ – auf das kommende Reich Gottes – „automatisch von apokalyptischer Angst ergänzt worden“.[32]
Der Fortschrittsglaube habe aber die apokalyptische Seite ausgelöscht. Mit der geschichtlichen Zukunft, so könnte man sagen, war damit nur noch Hoffnung und nicht mehr Angst verbunden. Durch die Bombe, nimmt man sie ernst, könne nun aber eine Situation entstehen, in der unter säkularen Denkvoraussetzungen die umgekehrte Gefahr eintrete: nur noch Angst vor der Zukunft, keine Hoffnung mehr angesichts der unbestreitbaren Gefahren.
Auf Jaspers’ Buch hat Anders mit Ingrimm reagiert. Das ist insbesondere seiner Rede „Über Verantwortung heute“ zu entnehmen, die er Anfang 1959 auf einem Studentenkongress gegen Aufrüstung gehalten hat.[33] Er lehnte das, was er das „Zwei-Höllen-Axiom“ von Jaspers nannte –, die Entscheidung zwischen der Auslöschung der Menschheit und dem Ende aller menschlichen Freiheit –, als „indiskutabel“ ab. Nur am Rande argumentierte er dabei insofern empirisch, als er Jaspers eine maßlose Übertreibung der Gefahr einer russischen Invasion in Europa vorwarf, verbunden mit einer peinlichen Ignoranz gegenüber der Tatsache, dass umgekehrt Russland im zwanzigsten Jahrhundert immer wieder vom Westen attackiert worden sei. Über die empirischen Fragen müsse man tatsachenorientiert streiten. Ganz klar schien Anders aber, dass es philosophisch unzulänglich sei, die Wandelbarkeit der Sowjetunion zu verneinen oder gar zu übersehen, „dass die Gefahr durch ein Wandelbares der Gefahr einer Auslöschung des Menschengeschlechts“ nicht gleichgesetzt werden dürfe.[34] Man könne Jaspers gewiss nicht vorwerfen, die Gefahren eines Atomkriegs kleingeredet oder die Argumente gegen seine Position gar nicht erwähnt zu haben. Aber seine Zuspitzung im Sinne einer Entscheidung zwischen „Überleben“ und „Überleben in Freiheit“ sei dennoch verfehlt. Das gelte zunächst einmal deshalb, weil Jaspers nicht in aller Schärfe auch die Defizite des Westens in seine Analyse aufzunehmen bereit gewesen sei. Immerhin war die Bombe schließlich vom „Westen“ eingesetzt worden. Hätte die Sowjetunion sie eingesetzt, wären die Abwürfe mit Sicherheit als „typische Dokumente totalitärer Skrupellosigkeit“[35] behandelt worden. Auch hätten sich die USA (in der McCarthy-Zeit), als sie noch weitgehend über das atomare Monopol verfügten, durchaus in eine totalitäre Richtung entwickelt. Aber es ging Anders nicht um totalitäre Tendenzen in einem nuklear hochgerüsteten westlichen Land, sondern um die Erpressungsmöglichkeiten, die in der Verfügung über die nukleare Drohung lägen. In diesem Sinne vernichte nicht nur der Totalitarismus die Freiheit, sondern auch die atomare Bewaffnung die Freiheit derer, die nicht über solche Waffen verfügten.
Ganz unbefriedigend fand Anders den Aufruf zur moralischen Selbstveränderung in Jaspers’ Buch. Er warf Jaspers vor, „in vornehmster Reserve“ zu bleiben gegenüber allen von unten kommenden kollektiven Protestformen, „Solidarisierungsaktionen, die, wenn von Millionen unternommen, das Gesicht der Weltlage verändern würden“. „Denn nicht nur vor der Tat endet sein Buch; nicht nur vor dem Aufruf zur Tat; sondern sogar vor der Billigung eines solchen Aufrufs.“[36] Scharf wies er Jaspers’ Kritik an denen zurück, die sich nicht einschränkungslos auf die Seite des „Westens“ stellten. Den Kampfbegriff des „Neutralismus“, den Jaspers dafür verwendete, bezog Anders verändert auf all diejenigen, die „weder den Krieg wünschen noch dazu bereit sind, die für die Sicherung des Friedens im Atomzeitalter unerlässlichen Schritte zu wagen“.[37] Jaspers’ Abwertung des Ziels schierer Existenzerhaltung konterte Anders damit, eine noch größere Schande als die Einengung auf das pure Leben sei es, wenn man zu vornehm dafür sei, dieses Ziel im Sinne aller zu seinem eigenen zu machen.
Notwendiges Denken – des größten denkbaren Risikos
Jaspers wiederum hat auf Anders’ eigene Analysen und Kritik an ihm nie öffentlich reagiert. Den zentralen Punkt – die Inkaufnahme des Endes der Menschheit für den Sieg gegen den Totalitarismus – hat er aber in späteren Publikationen nicht wiederholt. Es ist unklar, ob wir darin ein stillschweigendes Abrücken von seiner These zu sehen haben. Ausdrücklich nahm er seine relativ positive Einschätzung des maoistischen China später, unter dem Eindruck der „Kulturrevolution“, zurück. Politisch zog er daraus allerdings die Konsequenz, nun die Vernichtung der chinesischen Möglichkeiten zur Produktion nuklearer Bomben durch ein Militärbündnis von USA und Sowjetunion zu empfehlen.[38] Die Geschichte ist über solche Ideen hinweggegangen.
Hier ist kein abschließendes Wort zu diesen beiden zentralen denkerischen Versuchen der Auseinandersetzung mit der „Atombombe“ zu sprechen. Es müsste indes deutlich geworden sein: Beide Denker erkannten klar, dass eine menschenrechtsorientierte – heute heißt es oft „werteorientierte“ – Außenpolitik in einer Welt, in der eine nukleare Konfrontation und damit das Ende der Menschheit droht, sich dieses Risikos bewusst sein müsse. Jaspers war bereit, das Opfer der Existenz der Menschheit für die Verteidigung der Freiheit zu fordern; Anders wies hingegen mit empirischen und philosophischen Argumenten diese Forderung und ihr moralisches Pathos zurück. Unter dem Gesichtspunkt des moralischen Universalismus ist das, was Anders als Apokalypse-Blindheit bezeichnet hat, jedenfalls nicht zu rechtfertigen.
Beide Philosophen haben damit jedoch eines gemeinsam: Sie sind all denen überlegen, die bis heute das größte denkbare Risiko gar nicht in den Blick zu nehmen bereit sind.
Der Beitrag basiert auf dem jüngsten Buch des Autors, „Universalismus. Weltherrschaft und Menschheitsethos“, das soeben im Suhrkamp Verlag erschienen ist.
[1] Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution, München 1956, S. 308.
[2] Als Überblick über historiographische und moralische Debatten in den USA nenne ich nur Robert Jay Lifton und Greg Mitchell, Hiroshima in America. Fifty Years of Denial, New York 1995.
[3] Kurzer Überblick über die umfangreiche Literatur bei Susanne Quitmann und Thomas Clausen, Zwischen Forschung und Friedenspolitik. Zur intellektuellen Verarbeitung des Atombombenabwurfs, in: „Zeitgeschichte – online“, April 2017.
[4] Bertrand Russell, Autobiographie III, 1944-1967, Frankfurt a. M. 1974, S. 139.
[5] Karl Jaspers, Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. Politisches Bewußtsein in unserer Zeit, München 1958, S. 5.
[6] Ebd.
[7] Karl Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte (1949), München 1966, S. 242-266.
[8] Ebd., S. 245.
[9] Ebd., S. 246.
[10] Ebd.
[11] Ebd., S. 247.
[12] Dazu und für die Kritik an Jaspers überhaupt: Bernd Weidmann, Lieber tot als rot. Jaspers und das Problem der Atombombe, in: Oliver Immel und Harald Stelzer (Hg.), Welt und Philosophie. Politik-, kultur- und sozialphilosophische Beiträge zum Denken von Karl Jaspers, Innsbruck 2011, S. 99-123.
[13] Jaspers, Die Atombombe und die Zukunft des Menschen, a.a.O., S. 474.
[14] Richard Schaeffler, Philosophische Überlieferung und politische Gegenwart in der Sicht von Karl Jaspers, in: „Philosophische Rundschau“, 7/1959, S. 81-109 und S. 260-293, hier S. 279; Robert Spaemann, Zur philosophisch-theologischen Diskussion um die Atombombe, in: „Hochland“, 51 (1959), S. 201-216, hier S. 214.
[15] Jaspers, Die Atombombe und die Zukunft des Menschen, S. 144.
[16] Ebd., S. 227-235.
[17] Ebd., S. 230.
[18] Ebd.
[19] Ebd.
[20] Ebd., S. 231.
[21] Weidmann weist zu Recht auf das erstaunlich positive Mao-Bild bei Jaspers hin, das mit seiner hohen Einschätzung der achsenzeitlichen Traditionen Chinas zusammenhängt: Weidmann, a.a.O., S. 119 f.; Karl Jaspers, Die Atombombe und die Zukunft des Menschen, S. 170-173.
[22] Zu Jaspers’ Ablehnung der Versuche deutscher Physiker, die Aufrüstungspolitik zu verhindern: Schaeffler, Philosophische Überlieferung und politische Gegenwart in der Sicht von Karl Jaspers, a.a.O., S. 284-288; Ulrich Bartosch, „Also ein typisch deutscher Unfug“ – Karl Jaspers in Distanz und Nähe zur Göttinger Erklärung, in: Reinhard Schulz u.a. (Hg.), „Wahrheit ist, was uns verbindet“: Karl Jaspers’ Kunst zu philosophieren, Göttingen 2009, S. 425-439; ebenfalls sehr kritisch: Judith N. Shklar, Review Jaspers, The Future of Mankind, in: „Political Science Quarterly“, 76 (1961), S. 437-439; zu Jaspers als in vieler Hinsicht typischem Intellektuellen dieser Zeit: Carmen Lea Dege, Another Cold War Liberalism? Coming to Terms with Karl Jaspers’s Political Thought, in: Hans Joas und Matthias Bormuth (Hg.), The Anthem Companion to Karl Jaspers, London 2025, S. 133-161.
[23] Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, S. 233-324.
[24] Ebd., S. 238.
[25] Ebd.
[26] Ebd., S. 242.
[27] Ebd., S. 244 f.
[28] Ebd., S. 249.
[29] Ebd., S. 255.
[30] Ebd., S. 268.
[31] Ebd., S. 272.
[32] Ebd., S. 277.
[33] Günther Anders, „Über Verantwortung heute“, in: ders., Die atomare Drohung. Radikale Überlegungen, München 1981, S. 24-54, zu Jaspers S. 40-51.
[34] Zitate ebd., S. 41.
[35] Ebd., S. 43.
[36] Ebd., S. 46
[37] Ebd., S. 48.
[38] Mit Dank an Bernd Weidmann für diesen und weitere Hinweise. Zu China vgl. Karl Jaspers, Wohin treibt die Bundesrepublik?, München 1966, S. 210-212 und S. 223-232; ders., Antwort. Zur Kritik meiner Schrift „Wohin treibt die Bundesrepublik?“, München 1967, S. 21-28.