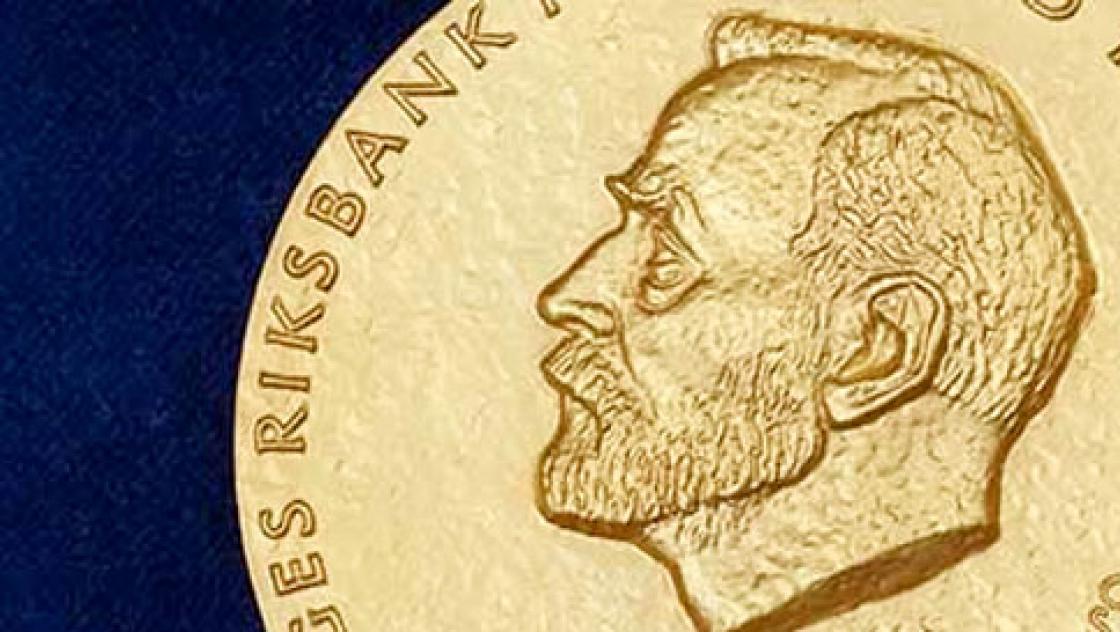Vom Stockholmer Nobelpreiskomitee war man ja bereits einiges gewohnt – unter anderem, dass bisher nur eine einzige Frau mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet wurde, nämlich Elinor Ostrom im Jahr 2009 für ihre Forschungen zu gemeinschaftlichem Eigentum (Allmende). Doch die Entscheidung dieses Jahres schlug dem Fass vollends den Boden aus: Erstmals wurden zwei Ökonomen geehrt, deren Theorien – über das Funktionieren bzw. Nicht-Funktionieren von Finanzmärkten – nicht aufeinander aufbauen, sondern im Gegenteil: sich fundamental widersprechen.
Eugene F. Fama hat die „Effizienzmarkthypothese“ entwickelt. Diese geht davon aus, dass rational handelnde Akteure zu effizienten Märkten führen. Irrationales Handeln, etwa durch Herdenverhalten, wird dabei ausgeblendet. Wenn alle Informationen eingepreist sind, gibt es laut Fama keine Krisenanfälligkeit der Finanzmärkte. Es gilt die Devise: „Der Markt kann langfristig nicht geschlagen werden“ – nicht einmal mit Insidergeschäften. Eine Annahme, die spätestens durch die jüngste Finanzmarktkrise dramatisch widerlegt wurde.
Robert J. Shiller hat die These sich selbst stabilisierender Finanzmärkte hingegen stets scharf attackiert. In seinem Hauptwerk „Irrational Expectation“ von 2003 stehen irrationales Verhalten und irrationale Erwartungen im Mittelpunkt. Zusammen mit seinem Kollegen George Ackerlof entwickelte er die von John Maynard Keynes erstmals betonte Sicht der animal spirits weiter. Demnach lassen sich, was die Funktionsweise von Finanzmärkten anbelangt, im fundamentalen Widerspruch zu Fama nicht einmal mehr mathematische Wahrscheinlichkeiten abbilden.
Kurzum: Während Robert J. Shiller bereits die Krise der „New Economy“ von 2000 wie auch die Immobilien- und Finanzmarktkrise von 2007/2008 genau prognostizieren konnte, hätte es nach Eugene F. Fama diese Krisen gar nicht geben dürfen. Shiller zu Fama im O-Ton: „Das Scheitern des Modells der Effizienzmarkthypothese ist so dramatisch, dass es unmöglich erscheint, dieses Scheitern solchen Dingen wie Datenfehlern, Problemen des Preisindex oder Änderungen im Steuerrecht zuzuschreiben.“
Tatsächlich haben Dotcom- und Finanzmarktkrise eindeutig bewiesen, dass das Modell von Fama nichts mit der Realität zu tun hat. Die Preisverleihung an Fama ist daher nicht nur eine Provokation, sondern eine folgenschwere Dummheit: Anstatt die für die Bewältigung der aktuellen Finanzmarktkrise hoch relevante Theorie von Shiller voranzutreiben, wird auch die analytisch widerlegte und empirisch gescheiterte Theorie von Fama geehrt. Dieser völlig falsch verstandene Wissenschaftspluralismus stärkt die Kräfte, die eine Regulierung der Finanzmärkte ablehnen.
Doch anstatt diesen absurden Vorgang gebührend anzuprangern, wurden alle drei Nobelpreisträger – neben Fama und Shiller auch noch Lars Hansen – von den deutschen Medien fast einhellig gelobt, ohne jede differenzierte Würdigung der konträren Ansätze. Was die Artikel dominierte, war allein die offizielle Rechtfertigung des Nobelpreiskomitees. Kein Wunder: Die meisten Agenturen und Medien haben den Einheitsbrei aus Stockholm einfach übernommen. Was für ein Armutszeugnis für den deutschen „Qualitätsjournalismus“.