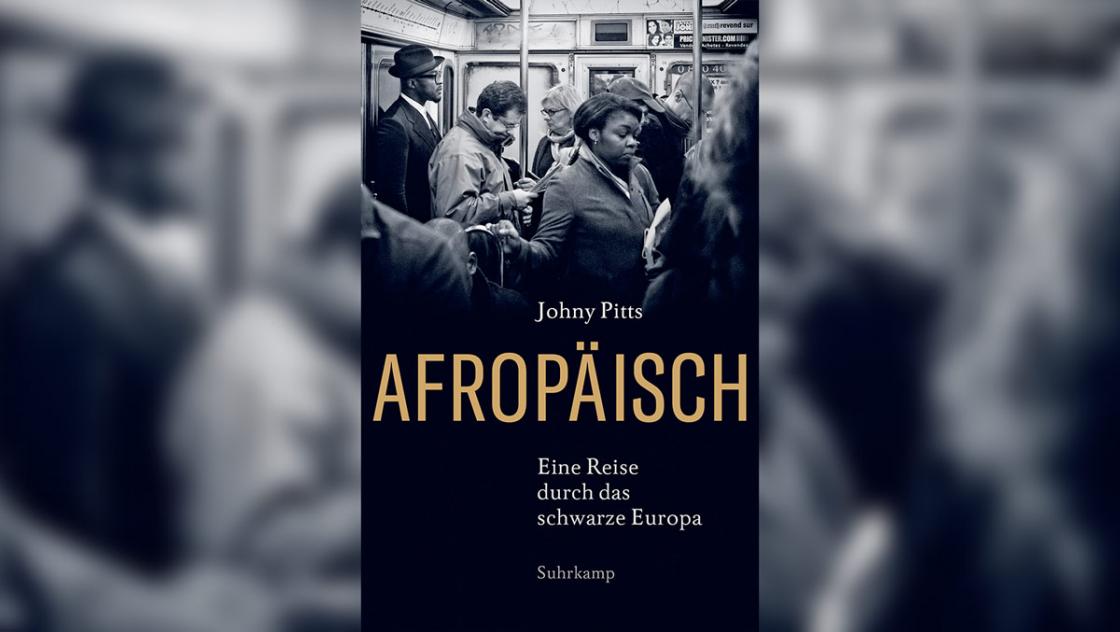
Bild: Suhrkamp Verlag
In jeder schweren Krise Europas taucht sie zuverlässig wieder auf: die Frage nach der europäischen Identität. Auch als zuletzt über den gewaltigen Rettungsfonds diskutiert wurde, mit dem die EU die ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie abfedern will, folgte unweigerlich der Einwand, der Zusammenhalt unter Europas Bürgern reiche nicht, um milliardenschwere Finanztransfers zu akzeptieren. Dafür, so die Euroskeptiker, denken und fühlen die Europäer noch viel zu national, und das mit gutem Recht. Genau umgekehrt argumentieren die EU-Freunde: Gehe es nach den Bürgern, wäre längst mehr Zusammenarbeit möglich, lediglich die oftmals national bornierten Regierungschefs träten auf die Bremse. Zumindest mit Blick auf den Recovery Fund, für den Umfragen in Deutschland große Zustimmung verzeichnen, scheint sich das zu bestätigen.
Wer nach einem frischen Zugang zu dieser bisweilen ritualisiert wirkenden Debatte sucht, kommt am neuen Buch von Johny Pitts nicht vorbei. Das gilt umso mehr, als der junge britische Journalist nicht versucht, eine europäische Identität im großen historischen Draufblick zu bestimmen. Er will auch keine ideelle Legitimation für politische Strategien zur Erweiterung – und erst recht nicht zur Abwicklung – der EU liefern. Als Sohn eines afroamerikanischen Vaters aus New York und einer weißen Mutter aus der nordenglischen Arbeiterklasse interessiert Pitts vielmehr, ob es für Schwarze einen positiven Platz in Europa gibt, jenseits einer Geschichte von Sklaverei und Kolonialismus und jenseits einer immer noch von strukturellem Rassismus geplagten Gegenwart. Mit diesem Fokus nähert sich Pitts in „Afropäisch“ der Frage, was die europäische Kultur, was den Zusammenhalt der Europäer in all ihrer Verschiedenheit ausmacht.
Dies beschäftigt Pitts, weil er Europa als seine Heimat begreift, wenn auch als eine, derer er sich nicht völlig sicher sein kann: „Mein Streit mit dem Kontinent ist der Streit eines Liebenden. Ich bin ausgiebig auf der ganzen Welt gereist, auch nach Westafrika, wo mein Schwarzsein seine Wurzeln hat, und nach Brooklyn, zum Treibhaus jener schwarzen Kultur, die mich unendlich inspiriert hat und wo mein Vater geboren wurde. Dennoch fühle ich mich nirgends so zuhause wie in Europa.“ „Afropäisch“ ist Pitts‘ Versuch, diese Zugehörigkeit so zu fassen zu bekommen, „dass schwarz zu sein in Europa nicht mehr unbedingt bedeutet, ein Immigrant zu sein“. Es geht ihm um eine „komplizierte, integrierte Form des Schwarzseins in Europa, die sich nicht auf Stereotype festnageln lässt und sich zugleich weigert, ihre braune Haut und Pluralität zu verleugnen.“ Was Pitts dabei auszeichnet, ist sein überaus reflektierter Zugang: Er erliegt nicht der Versuchung, mit afropäisch ein neues Theorie-Label zu promoten und so den heftig geführten Distinktionskämpfen der Gegenwart neues Futter zu geben. Zudem weiß Pitts, der in einem sogenannten Problemviertel von Sheffield aufgewachsen ist, nur zu gut, dass der Begriff afropäisch ursprünglich aus der Mode und dem Pop kommt und somit falsche Assoziationen wecken kann: Die meisten Schwarzen in Europa führen nicht das Leben der Reichen und Schönen.
Um der gelebten afropäischen Realität näherzukommen, hat Pitts fünf Monate lang Europa bereist, von Moskau bis Lissabon. Ohne institutionelle Förderung im Rücken stieg er in günstigen Hostels ab, nutzte Interrail und Fernbusse und beschränkte sich auf Herbst und Winter, weil er sich von der sommerlichen Leichtigkeit nicht täuschen lassen wollte. Dabei traf er Sozialarbeiter und Aktivistinnen, Musikerinnen und Literaten, suchte aber auch immer wieder die zufällige Begegnung mit ganz normalen schwarzen Europäern, vom Pariser Straßenverkäufer über den Berliner Imbissbesitzer bis zur Stockholmer Studentin. Entstanden ist so eine spannend zu lesende Mischung aus beinahe literarischem Reisebericht und politisch-historischem Essay.
Widersprüchliche schwarze Erfahrungen
Pitts legt dabei vielfältige und widersprüchliche schwarze Erfahrungen offen. Er beleuchtet einerseits, wo Schwarze diesen Kontinent aktiv geprägt haben, wo sie nicht Opfer sind. Das gilt etwa für gefeierte Literaten wie den russischen Nationaldichter Alexander Puschkin oder den anhaltend populären Alexandre Dumas, die beide afrikanische Sklaven unter ihren Vorfahren hatten. Ergänzen könnte man Anton Wilhelm Amo, der aus dem heutigen Ghana stammte, 1734 in Wittenberg promovierte – und als der erste deutsche Philosoph afrikanischer Herkunft gilt. Gebrochener ist das Beispiel der „Harlem Hellfighters“, einem Regiment afroamerikanischer und puertoricanischer Soldaten aus New York. Sie wurden im Ersten Weltkrieg an der Westfront für ihre Tapferkeit berühmt und vom französischen Staat ausgezeichnet. Die Teilnahme an der Siegesparade auf den Champs-Élysées 1919 verweigerte ihnen die US-Armee zwar aus rassistischen Motiven, aber Spuren hinterließen die Hellfighters in Paris dennoch: Sie brachten den Jazz nach Frankreich. „Es ist ermutigend, sich [...] in die europäische Geschichte eingeschrieben zu ‚sehen‘, weil man als schwarzer Mensch an einer europäischen Schule [...] kaum etwas über historische Figuren erfährt, mit denen man sich identifizieren könnte“, schreibt Pitts. Denn „während der amerikanische Traum die Bürgerrechtsbewegung in seine eigene Mythologie integriert hat, sind unsere Helden nicht offen in das Narrativ der europäischen Geschichte und Identität eingebettet.“
Andererseits gewinnt Pitts aus seinen Begegnungen oft ein deutlich tristeres Bild. Er berichtet dabei weniger von offen rassistischer Aggression als vielmehr von verschiedenen Formen der Ausgrenzung: Das beginnt damit, dass weiße Europäer noch allzu oft Schwarze gar nicht erst als gleichberechtigte Mitbürger wahrnehmen, und es endet mit räumlicher Verdrängung. Eine bezeichnende Szene erlebt Pitts etwa in der Pariser Banlieue: Er besucht eine Gedenkveranstaltung in Clichy-sous-Bois für zwei Jugendliche, die dort 2005 auf der Flucht vor der Polizei tödlich verunglückten; heftige Krawalle in ganz Frankreich folgten, Politiker gelobten mehr Engagement für die Vorstädte. Das Erinnern jedoch findet ohne die Anwohner statt: Die weiße Politprominenz fährt vor, spricht von der Bühne gesetzte Worte zu den wartenden weißen Journalisten, während die schwarzen und arabischstämmigen Jugendlichen aus dem Viertel als Zaungäste wortwörtlich am Rande stehen.
Ausgerechnet im eigentlich egalitären Schweden beobachtet Pitts, wie forcierte soziale Spaltung zur räumlichen Trennung führt: Ab den 1990er Jahren untergrub der neoliberale Kurs konservativer Regierungen die traditionell integrative Gesellschaftspolitik des Landes und veränderte damit auch die soziale Mischung in den Städten. So kauften in Stockholm wohlhabende Weiße die soeben privatisierten Wohnungen in der Innenstadt, die oft ärmeren Schwarzen blieben in Vororten wie Rinkeby zurück – und dort zunehmend unter sich.
Zuweilen drängt sich bei der Lektüre der Eindruck auf, dass Pitts ein Europa bereist, das seiner stolzen Werte müde geworden ist, sei es die Tradition von Aufklärung und Menschenrechten, sei es der Internationalismus. Dennoch ist sein Buch alles andere als ein Abgesang auf Europa. Vielmehr unternimmt Pitts den Versuch, der Ignoranz und Ausgrenzung eine selbstbewusste Aneignung Europas entgegenzusetzen – unter dem bewusst sehr breiten Banner des Afropäischen. Dabei wendet er sich gegen identitäre Abgrenzung, ihm geht es um die Begegnung – und auch um die Reibung – von Traditionen, um den „Afropäer als Erzähler grenzüberschreitender, hybrider Geschichten und Vertreter komplizierter kultureller Allianzen“.
Damit benennt Pitts zugleich den Kern der europäischen Kultur, die sich immer schon durch Vermischung und die Übernahme äußerer Einflüsse ausgezeichnet hat. Er rekurriert aber auch wiederholt auf die widersprüchliche Geschichte dieses Kontinents, zu der Emanzipationsbewegungen ebenso gehören wie Völkermorde. Angesichts dieses historischen Erbes kann eine europäische Identität – oder besser: eine Verbundenheit der europäischen Bürger – nur wachsen, wenn die unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven als Teil der großen Geschichte Europas anerkannt werden. Auch das lehrt uns dieses bereichernde Buch von Johny Pitts.
Johny Pitts, Afropäisch. Eine Reise durch das schwarze Europa. Aus dem Englischen von Helmut Dierlamm, Suhrkamp, Berlin 2020, 461 S., 26 Euro









