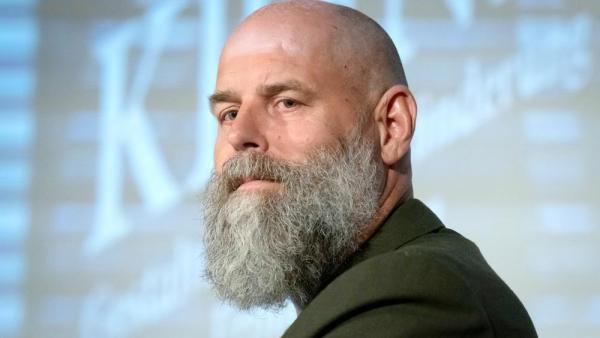Warum biologische Realitäten existieren, aber längst nicht alles sind
Die Geschlechterordnung unserer Gesellschaft gerät zunehmend ins Wanken. Das zeigen allein schon die Debatten der letzten Wochen: Mit einem gemeinsamen Coming-Out gehen 185 queere Schauspieler*innen an die Öffentlichkeit. Kurz darauf erklärt das Oberlandesgericht Celle, es halte das deutsche Abstammungsrecht für verfassungswidrig, da es nicht gestattet, die Ehepartnerin einer Mutter als Elternteil anzuerkennen. Unterdessen sorgt die gendersensible Schreibweise erneut für Aufregung. Bei den Auseinandersetzungen um diese Fragen handelt es sich keineswegs nur um ideologische „Identitätspolitik“, wie oftmals abfällig behauptet wird. Vielmehr sind sie der Versuch, die symbolische Ordnung der Geschlechter an die realen gesellschaftlichen und reproduktionstechnologischen Entwicklungen anzupassen. Dabei geht es nicht zuletzt um die Frage: Ist Geschlecht eine biologische Realität oder konstruiert? Und was bedeutet das für aktuelle politische Debatten?
Die konstruktivistische Philosophie hat gezeigt, dass es unmöglich ist, biologische Realitäten sprachlich objektiv abzubilden, sondern dass mit jeder Beschreibung bereits bestimmte Narrative und symbolische Ordnungen verbunden sind. Das heißt aber nicht, dass die geschlechtliche Unterscheidung in „weiblich“ und „männlich“ völlig aus der Luft gegriffen wäre.[1] Tatsächlich existieren menschliche Körper in zwei deutlich voneinander unterscheidbaren Varianten: Der „typisch weibliche“ Mensch hat zwei X-Chromosomen, funktionierende Eierstöcke, die eine weibliche Pubertät sicherstellen, Eileiter, die zu einer Gebärmutter führen, sowie eine Klitoris, deren sichtbarer Teil bei der Geburt kürzer als einen Zentimeter ist. Der „typisch männliche“ Mensch hingegen hat XY-Chromosomen, Hoden, die Sperma produzieren, das über den Samenleiter zur Harnröhre transportiert und außerhalb des Körpers ejakuliert werden kann, sowie einen Penis, der bei der Geburt mindestens 2,5 Zentimeter lang ist. 98,3 Prozent aller Neugeborenen fallen laut einer wissenschaftlichen Metastudie exakt in eine dieser beiden Gruppen.[2] Wollte man den reproduktiven Variantenreichtum menschlicher Körper in einem Bild darstellen, sähe dies also nicht aus wie eine Skala, sondern eher wie eine Langhantel: zwei große Kreise an den Enden, die von einer dünnen Stange von insgesamt nur 1,7 Prozent aller Menschen verbunden werden.
Aber sind 1,7 Prozent nun viel oder wenig? Das kommt auf die Perspektive an. Nach wissenschaftlichen Maßstäben handelt es sich um eine durchaus signifikante Größenordnung – man stelle sich nur vor, ein Medikament hätte in 1,7 Prozent aller Fälle schwere Nebenwirkungen! Auch in absoluten Zahlen sind 1,7 Prozent viel: Es bedeutet beispielsweise, dass in Deutschland gut 1,4 Millionen Menschen leben, deren biologische Geschlechtszugehörigkeit nicht eindeutig ist. Aus politischer Perspektive stellen 1,7 Prozent aber eine kleine Minderheit dar. Zumal diese Gruppe nicht annähernd homogen ist.
Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Gründe, warum Körper von der strengen zweigeschlechtlichen Norm abweichen können. Bei Menschen mit Uterus und XX-Chromosomen kann eine Hormonstörung, das sogenannte Androgenitale Syndrom, zu einem „vermännlichten“ Aussehen führen, etwa einer vergrößerten Klitoris oder sichtbarem Bartwuchs. Andersherum gibt es Menschen mit XY-Chromosomen, deren Erscheinungsbild und äußerliche Genitalien trotzdem eindeutig „weiblich“ sind. Grund dafür ist das Androgen-Insensitivitäts-Syndrom (AIS), bei dem der Embryo nicht auf die Hormone anspricht, die für die Ausbildung von Penis und Hodensack zuständig sind. Neben den Hormonen können auch Chromosomen für Abweichungen verantwortlich sein, wie X0- oder XXY-Chromosomensätze, die häufig ebenfalls zu körperlichen Besonderheiten führen. Und schließlich gibt es Fälle, in denen reproduktive Organe ganz oder teilweise fehlen, wie etwa beim MKRH-Syndrom, bei dem trotz XX-Chromosomen keine Gebärmutter ausgebildet wird. Ungefähr eine von 5000 Frauen ist davon betroffen, bei der Geburt wird dies in der Regel aber nicht erkannt, sondern erst, wenn die Menstruation ausbleibt. Eine Einordnung all dieser Menschen als „sexuell dimorph“ mag aus wissenschaftlicher Perspektive hilfreich sein, zumal manchmal auch eine medizinische Behandlung notwendig sein kann. Sozial und politisch ist diese Kategorie aber fragwürdig. Man kann diese Menschen nicht pauschal als „intersexuell“ kategorisieren, da die meisten sich selbst als „normal“ männlich oder weiblich verstehen. Ein leichter Bartwuchs stellt ja nicht das Frausein einer Person in Frage und ein verkürzter Penis nicht das Mannsein. Auch Transgeschlechtlichkeit und Intersexualität sind nicht dasselbe: Trans-Personen haben eine andere Geschlechtsidentität, als ihnen aufgrund des Aussehens der Genitalien zugewiesen wurde, aber ihre Körper können in aller Regel eindeutig einer der beiden reproduktiven Varianten zugeordnet werden. Zwar weisen beide Phänomene über die binäre Geschlechterordnung hinaus, aber aus verschiedenen Gründen.
Es gibt allerdings auch Fälle von sogenanntem Hermaphrodismus verus, also Menschen, die tatsächlich die reproduktiven Organe beider Geschlechter haben: Sie werden mit Eierstöcken und Hoden, mit Gebärmutter und Prostata, mit Vagina und Penis geboren, und manche ihrer Zellen enthalten XX-Chromosomen, andere XY-Chromosomen. Solche „echten Hermaphroditen“ können sowohl Kinder gebären als auch Samengeber für die Schwangerschaft anderer sein – wenn ihnen nicht die reproduktiven Organe operativ entfernt wurden, was leider in der Vergangenheit häufig auch ohne medizinische Indikation geschehen ist. Echte Hermaphroditen sind jedoch selten, ihr Anteil an der Bevölkerung bewegt sich zwischen 1:20 000 bis 1:100 000.
Geschlechterdifferenz als kulturelles Organisationsprinzip
Dass Menschen im Großen und Ganzen in zwei geschlechtlichen biologischen Varianten existieren, bedeutet allerdings nicht, dass es auch zwei soziale Kategorien für „Frauen“ und „Männer“ geben muss. Die Soziologin Oyèrónké Oyèwùmí hat dies am Beispiel der präkolonialen Kultur der Yoruba in Nigeria untersucht: Dort war nicht das Geschlecht, sondern das Alter das wichtigste Kriterium für die soziale Beschreibung von Menschen. Es gab zwar ein Wort für „Menschen mit Gebärmutter in der Lebensphase des Kindergebärens“ (obinrin), doch es bezeichnete nicht das Wesen dieser Personen, sondern lediglich eine bestimmte Funktion, die auch nur in diesem Zusammenhang von Interesse war.[3] Andere Gesellschaften kennen mehr als zwei Geschlechter, etwa die Hijras in Südasien oder die Two-Spirits in den indigenen Gemeinschaften Nordamerikas, oder haben institutionelle Verfahren zur geschlechtlichen Transition, wie das „Einschwören“ von Jungfrauen in Albanien, die trotz „weiblicher“ Körper als soziale Männer leben.
Ob Kulturen Menschen entlang ihrer körperlichen reproduktiven Varianten in unterschiedliche Kategorien einteilen oder nicht und welche soziale Bedeutung diese Kategorisierung dann jeweils hat, ist also keine wissenschaftliche Frage, die sich „aus der Natur der Sache“ von selbst ergibt, sondern eine politische Entscheidung bzw. das Ergebnis kultureller Praktiken. In der traditionell westlichen, heteronormativen Geschlechterordnung werden Menschen direkt nach der Geburt entlang ihrer prognostizierten Gebärfähigkeit in „Männer“ und „Frauen“ eingeteilt, wobei die als „Frauen“ kategorisierten Menschen in der Regel rechtlich, sozial und materiell benachteiligt werden. Die Bedeutung der Worte „männlich“ und „weiblich“, „Frau“ und „Mann“ beinhaltet dabei sehr viel mehr als nur die Information über das angenommene biologische Geschlecht. Die Geschlechterdifferenz fungiert vielmehr als kulturelles Organisationsprinzip. Denn zusätzlich zur Information darüber, ob jemand zur menschlichen Variante 1 oder Variante 2 gehört, transportieren die Begriffe „weiblich“ und „männlich“ Wertungen und Zuschreibungen, die weit darüber hinausgehen: Rollenerwartungen, rechtliche Möglichkeiten, Privilegien, Normen und vieles mehr.
Kaum etwas von dem, was in Texten, Filmen oder Alltagsgesprächen gemeint ist, wenn von „Frauen“ und „Männern“ die Rede ist, hat etwas mit biologischer Reproduktion zu tun. Nur deshalb konnten Neugeborene mit uneindeutigen Genitalien bis vor wenigen Jahrzehnten noch chirurgisch „vereindeutigt“ werden – obwohl ja völlig klar ist, dass einem Baby, dem man den für zu kurz gehaltenen Penis amputiert, um es anschließend „als Mädchen“ aufzuziehen, keine Gebärmutter wächst. Nur so ist es möglich, dass nicht nur Menschen, sondern auch Kleidung, Gefühle, in letzter Zeit sogar Bratwürste oder Kugelschreiber als „männlich“ oder „weiblich“ bezeichnet werden können. Wo aber die Darstellung von Geschlecht das Eigentliche ist, da wird die Geschlechterdifferenz zu einem kulturellen Zeichen ohne Substanz, zu einem „Konstrukt ohne biologisches Fundament“,[4] wie es die Queertheorie dann logisch zu Ende gedacht hat.
Es ist aber nicht nur so, dass Begriffe wie „männlich“ und „weiblich“ keine Auskunft über die reproduktive Differenz geben, also darüber, ob ein Mensch schwanger werden kann oder nicht, sie erschweren im Gegenteil sogar oft das Verständnis der biologischen Vorgänge. Denn sie helfen dabei, soziale Geschlechterklischees auf biologische Prozesse zu projizieren. Bei Säugetieren haben die Weibchen beim „Kinderproduzieren“ einen offensichtlich größeren und aktiveren Anteil, denn ausschließlich sie werden schwanger und gebären. Trotzdem hat Aristoteles schon im 4. Jahrhundert v. Chr. in einer erstaunlichen Umkehrung der Realität die Reproduktion als ein Geschehen erzählt, bei der den Männchen der aktive, den Weibchen hingegen der passive Part zukommt. Zwar gab es in der Antike durchaus auch andere Narrative, aber die aristotelische Erzählung prägt bis heute die Art und Weise, wie über Fortpflanzung gesprochen wird. So wird beispielsweise das männliche Ejakulat fälschlicherweise als „Sperma“ bezeichnet (das griechische Wort für „Samen“), obwohl es keineswegs „Samen“ enthält, aus dem etwas wachsen könnte. Ein Keim, aus dem menschliches Leben entstehen kann, bildet sich erst, wenn ein im Ejakulat enthaltener Samenfaden von einer Eizelle aufgenommen worden ist. Es entspricht daher auch nicht den biologischen Tatsachen, wenn gesagt wird: „Ein Mann zeugt ein Kind.“ Embryonen entstehen nur aus den Keimzellen zweier biologisch gegengeschlechtlicher Menschen. Selbst Formulierungen wie „befruchtete Eizelle“ folgen dieser ideologisch motivierten aristotelischen Imagination von männlicher Aktivität und weiblicher Passivität, indem sie das „weibliche Sperma“, nämlich die Eizelle, zu einer bloß wartenden Empfängerin umdeuten.
Ein weiterer wichtiger Faktor, der für die geschlechterhierarchische Erzählung wesentlich ist, ist das Entwerten und Unsichtbarmachen der Schwangeren. Obwohl das Zur-Reife-Bringen eines Embryos und die Geburt eines Kindes ein ganz erhebliches Maß an Aktivität verlangen, existiert für diese Tätigkeit im Deutschen nicht mal ein Wort. Wir können das „Gestieren“ (um einen romanischen Begriff zu entlehnen) gar nicht als Tätigkeit benennen, sondern lediglich als passiven Zustand – „schwanger sein“ – beschreiben. Eine Schwangerschaft gilt nicht als kulturelle Aktivität, sondern als „natürlicher“, vorpolitischer Prozess, mit dem nichts Schöpferisches verbunden ist. Folgerichtig kann der Embryo auch ganz ohne schwangeren Körper imaginiert werden; das entsprechende Bildnis findet sich in den Zeichnungen von Leonardo da Vinci ebenso wie in moderner Anti-Abtreibungs-Propaganda. Die Existenz von Embryonen außerhalb eines lebendigen Körpers ist zwar eine biologische Unmöglichkeit, doch um Biologie geht es eben nicht, sondern um Fiktion. Was erzählt wird, ist eine Phantasiegeschichte von dem Mann-Menschen, der seinen Samen in den Körper einer untergeordneten Uterusbesitzerin hineinpflanzt wie in einen Nährboden und der „natürlich“ später auch das Produkt, das Kind, als sein Eigentum beanspruchen kann. Sowohl in der Debatte um Leihmutterschaft wie in den Argumentationen der Väterrechtsbewegung wird die bleibende Kraft dieses Narrativs eindrücklich sichtbar.
Der biologische Vorgang der Reproduktion ist also bis in die Begrifflichkeiten hinein überlagert und vermischt mit symbolischen Zuschreibungen und Vorstellungen von Geschlecht. Die Wörter „Mann“ und „Frau“ sind keine bloßen Zeichen, mit denen die reproduktive Differenz beschrieben wird, sondern sie tragen bereits eine symbolische Ordnung in sich – das eine lässt sich nicht ohne das andere denken. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass in dem Moment, wo sich die soziale Geschlechterordnung ändert – nämlich von patriarchaler Hierarchie zum Ideal der Geschlechtergleichheit – auch die Biologie plötzlich anders erzählt wird: Dann liefern sich beispielsweise nicht mehr die männlichen Spermien einen Wettlauf um die zu erobernde Eizelle, sondern die Eizelle gibt den Ausschlag dafür, welchen Samenfaden sie einlässt.
Die reproduktive Differenz als politischer Faktor
Trotz der untrennbaren Vermischung von natürlichen Tatsachen und symbolischer Ordnung ist es aber unmöglich, nicht über die reproduktive Differenz zu sprechen. Denn dass nur gut die Hälfte aller Menschen einen Uterus hat, also schwanger werden kann, während gleichzeitig alle Menschen durch Schwangerschaften auf diese Welt kommen, bringt Konflikte mit sich – auch unabhängig von patriarchalen Geschlechterhierarchien. Denn nicht nur in binärgeschlechtlich organisierten Kulturen, sondern prinzipiell in allen menschlichen Gesellschaften stellen sich Fragen wie: Unter welchen Umständen können/sollen/dürfen Menschen mit Uterus schwanger werden? Bekommen sie eine Entschädigung für die damit verbundenen Unannehmlichkeiten und Gefahren? Wie wird ihr materielles Auskommen sichergestellt für die Zeit, in der sie in ihren Erwerbsmöglichkeiten eingeschränkt sind? Wer garantiert und finanziert die medizinische Versorgung während Schwangerschaft und Geburt? In welcher Höhe und in welcher Qualität? Wer entscheidet über diese Fragen – alle Betroffenen oder alle Menschen, also auch die, die gar nicht schwanger werden können? Gibt es bei ungewollten Schwangerschaften die Möglichkeit zur Abtreibung? Wie ist das rechtliche Verhältnis zwischen einer Person, die geboren hat, zum Neugeborenen? Ist sie für die Versorgung zuständig? Ist sie zur Versorgung berechtigt? Bekommt sie Hilfe? Von wem? Können andere ihr das Kind gegen ihren Willen wegnehmen oder anderweitig Ansprüche darauf erheben?
Dass Diskussionen um Geschlechteridentitäten und die damit verbundene symbolische Ordnung gerade heute aufbrechen, liegt nicht nur daran, dass die Emanzipationsbewegungen des 20. Jahrhunderts die traditionellen patriarchalen Konzepte in Frage gestellt haben. Auch in Bezug auf die Prozesse der Reproduktion hat es Veränderungen gegeben, die neue Narrative erfordern. In traditioneller heteronormativer Logik gibt es legitime Kinder ausschließlich in monogamen, heterosexuellen Paarbeziehungen. Die reproduktive Differenz war also ins Innere von „Familien“ eingeschlossen, mithin ins Private, und die Politik musste sich nicht damit beschäftigen. Doch dieses Arrangement kann nicht mehr funktionieren, wenn Ehen selbstverständlich geschieden werden können, wenn Frauen individuelle Rechte haben, wenn Menschen mit reproduktiv ähnlicher körperlicher Ausstattung heiraten können oder wenn Menschen polyamore Familien gründen. Genauso wenig lassen sich in der alten binären Geschlechterlogik ethische Fragen entscheiden, die sich aus neuen Technologien ergeben wie In-vitro-Fertilisation, Eizellen-Verkauf, Leihmutterschaft oder Gebärmuttertransplantationen.
Als Erstes wurde dabei die traditionelle Rolle des Vaters in Frage gestellt. Kulturhistorisch war Vaterschaft vor allem ein soziales Verhältnis, einfach deshalb, weil die biologische Vaterschaft gar nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte.[5] Zwar hat sich Vaterschaft schon immer auch als materiell-natürlich behauptet, aber biologisch war nur die Mutterschaft „sicher“, nämlich durch das Gebären erwiesen. Seit einigen Jahrzehnten kehrt sich dieses Verhältnis zunehmend um: Seit 1927 gibt es das (wenn auch nur bedingt verlässliche) Blutgruppensystem zur Vaterschaftsfeststellung, seit 1984 die recht sichere DNA-Analyse. Bei In-vitro-Fertilisation, also der technologisch unterstützten Zeugung eines Embryos außerhalb des menschlichen Körpers, ist ohnehin bekannt, in wessen Körper der verwendete Samenfaden produziert wurde. Unsicher hingegen ist inzwischen zuweilen die Mutterschaft geworden: Denn ein In-vitro gezeugtes Kind kann zwei „biologische“ Mütter haben – die Person, von der die Eizelle stammt, und die Person, die es im Uterus zur Reife bringt. Elternschaft lässt sich also nicht mehr so einfach „binär“ als Sache von „Vater und Mutter“ beschreiben. Konsequenterweise hat sich die juristische Definition von Vaterschaft in Deutschland nach und nach von sozialen zu biologischen Faktoren verschoben: Mit Ausnahme des mit der Mutter verheirateten Ehemanns, der bereits eine stabile Beziehung zu dem Kind aufgebaut hat, gelten immer die Männer, die den Spermafaden zur Zeugung beigesteuert haben, als Väter des Kindes, wenn sie das wünschen – auch wenn diese Kinder bereits in anderen stabilen Familienstrukturen leben wie in lesbischen oder in unverheirateten heterosexuellen Partnerschaften. Dass die soziale Beziehung der beiden zeugenden Erwachsenen im Vergleich zur Biologie heute als zweitrangig gilt, ist für Frauen allerdings nicht unbedingt erfreulich. Denn sie stehen nun bei einer ungeplanten Schwangerschaft vor der Wahl, entweder mit dem betreffenden Mann geteilte Elternschaft praktizieren zu müssen – oder aber abzutreiben. Im Zuge des Gleichstellungsdiskurses hat sich zudem die Unterscheidung in „Väter“ und „Mütter“ häufig in ein geschlechtsneutrales Sprechen von „Eltern“ gewandelt – was aber manchmal zur Folge hat, dass Schwangerschaften nun erst recht unsichtbar werden, weil sie dem Gleichheitsnarrativ entgegenstehen.
Die symbolische Geschlechterordnung hinkt den Entwicklungen hinterher
In vielerlei Hinsicht ist jedenfalls politischer Handlungsbedarf rund um die Frage entstanden, wie Menschen außerhalb von heteronormativen Familienstrukturen Eltern werden können. Das berührt nicht nur biologische, sondern auch soziale und juristische Aspekte. Menschen mit Uterus können ja immer selbstbestimmt schwanger werden, denn Ejakulat lässt sich auch ohne Geschlechtsverkehr in eine Vagina einführen, und an Männern, die ihr Sperma dafür zur Verfügung stellen, herrscht kein Mangel. Hindernisse bei der Familiengründung entstehen für weibliche Singles oder lesbische Paare vor allem durch Gesetze, die ihre Lebensform nicht absichern oder schützen. Anders sieht es bei Paaren oder Singles aus, die selbst nicht schwanger werden können, also alleinstehenden Männern oder schwulen Paaren. Sie sind, wenn sie Eltern werden wollen, darauf angewiesen, dass andere an ihrer Stelle schwanger werden und gebären und ihnen das Kind nach der Geburt zur Elternschaft übergeben.
Angesichts des rasanten Tempos, mit dem reproduktionstechnologische Möglichkeiten fortentwickelt werden, hinken politische wie ethische Debatten hier weit hinterher. Gesetzgeber gewähren beispielsweise meist den Zugang zu Reproduktionstechnologie nur Menschen, die dem alten heteronormativen Muster entsprechen, während homosexuelle Paare oder Alleinstehende ausgeschlossen sind. Entsprechend erschließt Reproduktionstechnologie bislang kaum neue soziale Möglichkeiten, sondern wird eher eingesetzt, um die „Natürlichkeit“ heteronormativer Familienmodelle zu simulieren. Während es früher „normal“ war, dass ungewollt kinderlose heterosexuelle Paare kinderlos blieben, steht heute sofort die Frage im Raum, warum sie keine reproduktionstechnologische Unterstützung in Anspruch nehmen.
Gegen die normierende Einschränkung der reproduktionstechnologischen Möglichkeiten regt sich jedoch zunehmend Widerstand. Immer mehr Menschen suchen nach Möglichkeiten, wie sie die Verfahren nutzen können, um weitere Familienformen zu erproben. In den USA, Kanada, Skandinavien und Israel haben homosexuelle Paare bereits den Zugang zur Reproduktionstechnologie für sich erstritten. Bei Poly-Elternschaft (mit mehr als zwei Elternteilen) oder Co-Parenting (Elternschaft von Menschen, die kein Paar sind), Leihmutterschaftsarrangements aller Art, Single-Elternschaft, Schwangerschaften jenseits der Menopause und vieles mehr laufen die Diskussionen noch.
Wenn aber die heteronormative lebenslange monogame Ehe als einzig legitimer Ort für die Geburt von Kindern ihre Dominanz verliert, reicht die simple Unterscheidung zwischen „Frauen“ und „Männern“ zur Diskussion über diese Themen schlicht nicht mehr aus. Die möglichen Rollen und Beziehungen rund um die Themen Sex, Gender, Familie, Reproduktion sind zu komplex. Vor allem innerhalb von Trans- und/oder queeren Communitys haben sich daher seit einigen Jahren die Begrifflichkeiten der Geschlechterdiskurse vervielfältigt – was im Mainstream zuweilen auf Ablehnung stößt.
Die Würde der Menschen, die schwanger werden können
Solche Debatten bewegen sich allerdings immer auf dem Feld der Politik und nicht auf dem Feld der Naturwissenschaft: Es gibt keine „richtige“ Geschlechterordnung, die sich aus der reproduktiven Differenz in der menschlichen Biologie herleiten ließe, sondern im Prinzip steht es menschlichen Gesellschaften frei, sich alle nur denkbaren Geschichten darüber zu erzählen. Der Natur ist es egal, wie die Beziehungen zwischen Menschen, die schwanger werden können, und Menschen, die nicht schwanger werden können, gestaltet werden. Es ist also auch eine politische und ethische Positionierung, wenn ich an dieser Stelle vorschlage, bei den anstehenden Debatten die Würde und die Freiheit von Menschen, die schwanger werden können, in den Mittelpunkt zu stellen.
„Feminismus ist die radikale Vorstellung, dass Frauen Menschen sind“, lautet ein feministischer Slogan. Dass „Frauen“ schwanger werden können, bedeutet nichts anderes, als dass Menschen schwanger werden können. Nur eben nicht alle. Was also würde sich ändern, wenn wir das Schwangerwerdenkönnen nicht als Besonderheit von „Frauen“ wahrnehmen, sondern als menschliche Normalität? Wenn wir in Schwangeren nicht „Dienstleisterinnen“ sehen – sei es für andere (etwa Ehemänner und Leihmutterschafts-Kund*innen) oder die Gesellschaft –, sondern Individuen mit dem Recht auf körperliche Selbstbestimmung, politische Subjekte, „normale Menschen“ eben? Welche Konsequenzen hätte dies für die Gesetzgebung, die Kultur, die Ökonomie? Solche Debatten anzustoßen und zu führen, bedeutet keineswegs, sich vom politischen Subjekt „Frauen“ zu lösen. Die gegebene Realität ist ohne diese Kategorie weder zu verstehen, noch ist es wünschenswert, sich von der Kategorie „Frau“ loszusagen, zumal Feminismus und die Frauenbewegung das Frausein immer mehr aus seiner patriarchalen Umklammerung lösen.[6] Vielmehr geht es darum, das, was man bislang für „speziell weibliche“ Erfahrungen gehalten hat, als allgemein menschliche Erfahrung zu erfassen.
Die feministische Philosophin Luce Irigaray hat den Zustand des Schwangerseins als „Zwei in eins“ bezeichnet[7] und damit vorgeschlagen, Schwangere und Embryo weder als zwei getrennte Individuen zu betrachten noch als einen einzigen Körper, sondern als Paradigma für ein neues Menschenbild, für neue Vorstellungen von Freiheit. In dieser Richtung weiter zu denken, ist unsere Aufgabe in einer Zeit, in der die symbolische Ordnung der Heteronormativität und des Patriarchats an Autorität verloren hat – und daher nicht mehr in der Lage ist, die politischen Fragen, die sich aus der reproduktiven Differenz ergeben, zu regeln.
[1] Der Beitrag entstand in Anlehnung an das Buch der Autorin, Schwangerwerdenkönnen. Essay über Körper, Geschlecht und Politik, Roßdorf 2019.
[2] Melanie Blackless u.a., „How Sexually Dimorphic Are We?” in: „American Journal of Human Biology“, 12/2000, S. 151-165.
[3] Oyèrónké∙ Oyèwùmí, The Invention of Women: Making an African Sense of Western Gender Discourses, Minneapolis, 1997.
[4] Vgl. János Erkens, Der Autor und Queertheoretiker Paul B. Preciado nahm Testosteron – doch nicht, um ein Mann zu werden, www.missy-magazine.de, 26.5.2016.
[5] Vgl. dazu ausführlich Christina von Braun, Blutsbande. Verwandtschaft als Kulturgeschichte, Berlin 2019.
[6] Vgl. dazu Antje Schrupp, Das Privileg, eine Frau zu sein, www.zeit.de, 2.4.2021.
[7] Luce Irigaray, Speculum, Paris 1974, S. 297.