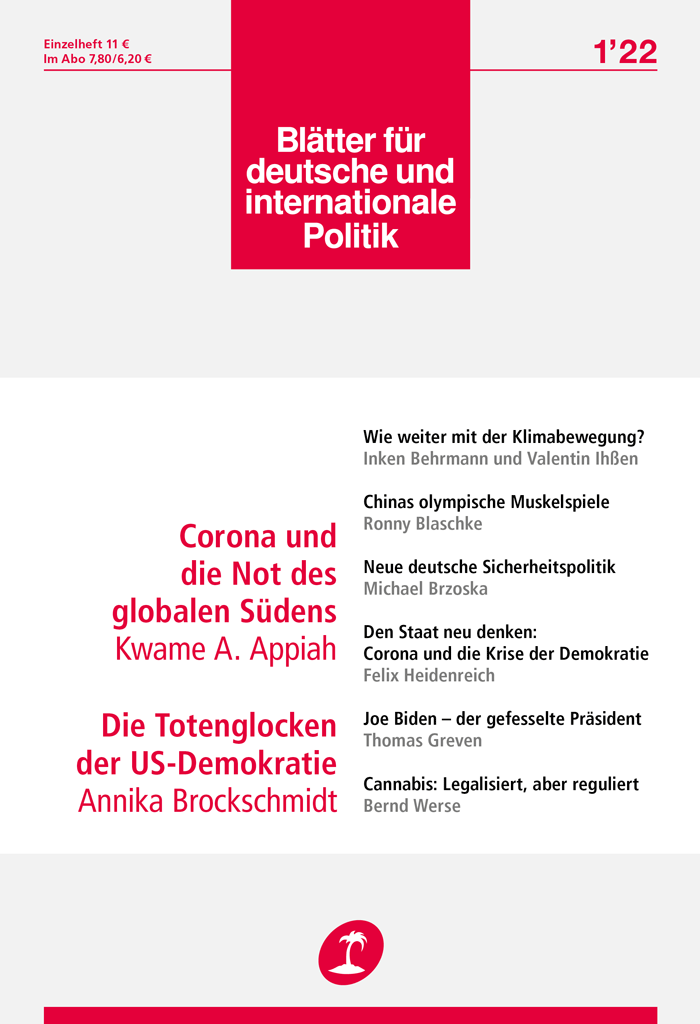Bild: Ein Arbeiter wäscht sich die Hände auf einer Straße in Katar (IMAGO / ITAR-TASS)
In gut elf Monaten ist es so weit: Am 21. November beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Doch während in Deutschland darüber diskutiert wird, ob Hansi Flick ein besserer Bundestrainer als Joachim Löw sein wird, ist das Turnier selbst längst zum Politikum geworden. Denn die WM wird in einem Land ausgetragen, das den Tod tausender Arbeitsmigrant*innen in Kauf genommen hat, um mit prunkvollen Stadien zu beeindrucken und so sein außenpolitisches Ansehen aufzubessern. Systematisch versucht Katar, sich mit Hilfe des Profifußballs auf globaler Ebene als progressiv zu inszenieren und die wirtschaftlichen Beziehungen zu Ländern wie Deutschland auszubauen. Der Golfstaat nutzt die WM gezielt, um Sportswashing zu betreiben, also mit Hilfe des Turniers sein Image reinzuwaschen. Das aber konterkariert das oft zitierte Diktum des Weltfußballverbandes Fifa und des Deutschen Fußballbundes (DFB), wonach der Fußball unpolitisch sei.
Bereits die Vergabe der WM an Katar war ein Fehler. Zeitig kursierten Korruptionsvorwürfe, wonach drei südamerikanische Funktionäre Geld für ihre an Katar vergebenen Stimmen erhalten haben sollen.[1] Trotzdem zog die Fifa eine Neuvergabe nie ernsthaft in Erwägung. Nun lässt sich entgegnen, dass auch bei der Vergabe der WM 2018 an Russland Bestechungsgelder geflossen sein sollen, dennoch sind die Fälle nicht vergleichbar: Im Gegensatz zu Russland ist Katar keine Fußballnation, und dem Land geht es auch nicht um den Sport – sondern darum, ein durchkommerzialisiertes Werbe-Event abzuhalten. Zu diesem Zweck hat Katar in den vergangenen Jahren mit viel Aufwand erst einmal ein konkurrenzfähiges Nationalteam zusammenstellen müssen. Weil die Sportförderung im Land lange Zeit gering ausfiel und es wenig wettbewerbsfähige Athleten gibt, versucht Katar die Defizite durch Einbürgerungen zu kaschieren. Nicht alle Profifußballer, die für Katar auflaufen, erhalten allerdings die volle Staatsbürgerschaft. Das Emirat stand deshalb in der Kritik, vor allem nachdem das Nationalteam 2019 überraschend den Asien-Cup gewann.
Moderne Sklaverei
Ein weitaus gravierenderes Problem zeigt sich allerdings abseits der sportlichen Ebene: Seit Katar den Zuschlag für die WM erhalten hat, legte der Golfstaat ein ehrgeiziges Infrastrukturprogramm auf. Es stampfte nicht nur einen neuen Flughafen und ein ganzes U-Bahn-Netz aus dem Boden, sondern auch gleich neun neue Stadien. Ob die Arenen nach der WM weiter genutzt werden, ist in einem Land, in dem Fußball keine große Rolle spielt, äußerst fraglich. Darüber kann auch die Nachhaltigkeitsstrategie der Fifa für diese WM nicht hinwegtäuschen, selbst wenn es Katar gelingen sollte, die Stromversorgung mit Hilfe von Sonnenenergie zu garantieren. Vielmehr handelt es sich dabei um Greenwashing, das von den unmenschlichen Bedingungen, unter denen die Stadien entstanden sind, ablenken soll.
Denn die Last des Infrastrukturprogramms tragen vor allem Arbeitsmigrant*innen, die zumeist aus südasiatischen Ländern wie Nepal, Bangladesch und Sri Lanka stammen. Im Golfstaat müssen sie unter katastrophalen Bedingungen leben: Laut Amnesty International sind die Arbeiter*innen extremer Hitze ausgesetzt und in kargen Massenunterkünften untergebracht. Vielen stünden nicht einmal genügend Lebensmittel zur Verfügung. Der Internationale Gewerkschaftsbund warnte bereits 2014 davor, dass bis zum WM-Start tausende Arbeitskräfte ums Leben kommen würden, wenn Katar nicht grundlegend etwas an deren Situation ändere.[2] Diese Befürchtung hat sich mittlerweile bewahrheitet: Dem „Guardian“ zufolge starben seit der WM-Vergabe mindestens 6500 Arbeitsmigrant*innen.[3] Diese Zahl basiert auf Anfragen an die Regierungen der Herkunftsländer, in denen aber Daten aus Kenia und den Philippinen fehlen, so dass die Dunkelziffer noch höher ausfallen dürfte. Inwieweit die Todesfälle auf Unfälle beim Bau der Stadien oder auf die prekären Lebensverhältnisse zurückzuführen sind, ist unklar. Allerdings ist es naheliegend, dass der Großteil der Toten in Verbindung mit den Bauprojekten steht, denn schließlich sind mindestens 20 000 Arbeiter*innen nur zu diesem Zweck nach Katar gekommen.[4] Doch das Emirat hat bisher weder die Todesursachen umfassend aufgeklärt noch die Familien der Opfer entschädigt, die oftmals ihre Haupternährer*innen verloren haben, was sie in ihren Heimatländern in große Armut stürzt. Stattdessen schiebt es die Todesfälle auf „natürliche Ursachen“ oder Herzinfarkte. Das aber ist wenig glaubwürdig, handelt es sich bei den Verstorbenen doch größtenteils um junge Männer.
In Katar machen Arbeitsmigrant*innen 95 Prozent der gesamten Erwerbsbevölkerung aus.[5] Viele von ihnen nehmen diese Jobs an, weil sie keine andere Möglichkeit haben, sich und ihre Familien zu versorgen. Ihre Ausbeutung im Emirat beruht auf dem sogenannten Kafala-System, das die Arbeitsmigration in vielen arabischen Ländern regelt. Innerhalb dieses „Bürgschaftssystems“ werden Arbeitskräfte im Baugewerbe von privaten Agenturen angeworben und an Arbeitgeber im Golfstaat vermittelt, die für ihre Einreise „bürgen“. Daraus entsteht ein Abhängigkeitsverhältnis, das nur als moderne Sklaverei bezeichnet werden kann: Die Arbeiter*innen werden gezwungen, ihrem „Bürgen“ bei der Einreise ihre Ausweisdokumente auszuhändigen, und dürfen ohne deren Einverständnis weder den Arbeitgeber wechseln noch das Land verlassen. Ihr Aufenthaltsstatus und die Arbeitserlaubnis hängen also vom Wohlwollen einzelner Personen ab.
Unzureichende Reformen
Nach breiter internationaler Kritik hat Katar inzwischen einige Reformen initiiert. So erließ das Emirat 2017 ein Gesetz, das die Arbeitszeit regelt, und führte einen Mindestlohn ein, der umgerechnet bei rund 232 Euro plus Verpflegung liegt. Darüber hinaus schaffte es die sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung („No Objection Certificate“) ab, so dass Arbeiter*innen mittlerweile nicht mehr auf die Zustimmung ihres Arbeitgebers angewiesen sind, wenn sie das Land verlassen oder den Arbeitgeber wechseln wollen. Diese Reformen klingen erst einmal vielversprechend, so dass sogar die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) befand, das Kafala-System sei im Land vollständig abgeschafft worden.[6] Der Jubel kam jedoch zu früh.
Das geht jedenfalls aus einem neuen Bericht von Amnesty International hervor. Demnach hat Katar die Reformen allenfalls lückenhaft umgesetzt. So werden Löhne weiterhin häufig zu spät oder gar nicht ausgezahlt, wogegen sich Arbeitnehmer*innen kaum wehren können, da ihnen der Zugang zur Justiz weitgehend versperrt bleibt. Außerdem ist es ihnen immer noch untersagt, sich in Gewerkschaften zu organisieren. Selbst Ausreisegenehmigungen und Unbedenklichkeitsbescheinigungen wurden faktisch nicht abgeschafft, sondern durch ein intransparentes Verfahren ersetzt. Amnesty kritisiert zudem, dass die 6500 Todesfälle nach wie vor nicht umfassend aufgeklärt wurden, obwohl es eindeutige Belege für einen Zusammenhang mit den unsicheren Arbeitsbedingungen auf den Baustellen gibt. Katar hat seither zwar einige Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, allerdings reichen diese bei Weitem nicht aus, um die Arbeiter*innen beispielsweise vor den extremen klimatischen Bedingungen zu schützen.[7]
In der Kritik steht dabei nicht nur die katarische Regierung, die es bis heute versäumt hat, umfassende Reformen zum Schutz der Arbeitskräfte zu initiieren. Vielmehr trägt auch die Fifa eine erhebliche Verantwortung für die menschenunwürdigen Zustände, indem sie die WM an ein Land vergeben hat, das nicht über die nötige Infrastruktur verfügte, um ein solches Turnier auszurichten. Denn die Todesfälle auf den Baustellen sind keine einfachen Unfälle, sie sind die logische Konsequenz des Kafala-Systems.
Boykott als letzter Ausweg?
Angesichts dessen werden Boykottaufrufe weltweit immer lauter. Bereits im Frühjahr 2020 hatten mehrere norwegische Erstliga-Klubs sich für einen solchen Schritt ausgesprochen, konnten jedoch ihren Verband nicht überzeugen. Das niederländische Unternehmen Hendriks Graszoden hat mit Verweis auf die Menschenrechtslage in Katar erklärt, keinen Rollrasen für die dortigen Stadien zu liefern. Und auch in Deutschland gibt es mittlerweile die Initiative #BoykottKatar2022, die den DFB dazu auffordert, nicht an der WM teilzunehmen und zur Menschenrechtslage vor Ort klar Position zu beziehen. Bayern-Fans haben bei einem Bundesligaspiel gegen die Partnerschaft mit Katar protestiert und Profis wie Nationaltorhüter Manuel Neuer sollen Hintergründe zur Menschenrechtssituation eingefordert haben.
Die katarische Regierung weiß um die Widerstände und versucht vehement, jede Form des Protests zu verhindern. Im Mai 2020 ließen katarische Behörden sogar den kenianischen Arbeitsrechtsaktivisten Malcolm Bidali entführen. Unter Pseudonym hatte er auf Twitter auf Verstöße gegen Arbeitsrechte aufmerksam gemacht und von seinen Erfahrungen als Arbeitsmigrant berichtet. Daraufhin wurde er einen Monat lang in Isolationshaft gehalten und durfte das Land erst verlassen, als er eine Geldstrafe von umgerechnet 5800 Euro gezahlt hatte. Zudem wurden sein Telefon beschlagnahmt und seine Social-Media-Konten gesperrt. Katars Behauptung, die Situation der Arbeiter*innen verbessern zu wollen, erscheint in diesem Licht noch unglaubwürdiger. Und es drängt sich die Frage auf, inwiefern es während der WM vor Ort möglich sein wird, kritisch über das Turnier zu berichten.
Auch mit Blick auf die Rechte von LGBTIQ* wird deutlich, wie Katar die WM ausnutzt, um sein internationales Standing zu verbessern. So verkündete WM-Geschäftsführer Nasser Al-Khater, dass Regenbogenfahnen in den Stadien „respektiert“ würden. Zuvor hatte es von Seiten queerer Netzwerke und Organisationen wie dem Gay Football Supporters Network viel Kritik an Katar gegeben. Denn Homosexualität wird im Golfstaat nach wie vor kriminalisiert und bestraft. Queeren Menschen droht Haft, theoretisch könnte sogar die Todesstrafe verhängt werden. Dies wird von staatlichen Vertreter*innen wie Hassan Al-Thawadi, dem Leiter des WM-Bewerbungsteams, auch verteidigt. Welche Implikationen das für das Turnier hat, wurde jüngst in einem Interview mit dem australischen Fußballer Josh Cavallo deutlich. Er ist weltweit der erste aktive Erstligaprofi, der öffentlich erklärt hat, schwul zu sein. Einer Nominierung für das australische Nationalteam sieht er mit gemischten Gefühlen entgegen – weil er Angst hat, zur WM nach Katar zu reisen.[8] Nicht jeder Spieler und jeder Fan kann sich in Katar sicher fühlen. Darüber können auch Regenbogenfahnen in den Stadien nicht hinwegtäuschen.
Die Fifa mag sich also Werte wie Toleranz und Offenheit auf die Fahne schreiben, schließt aber faktisch systematisch bestimmte Menschen von der WM aus, wenn sie diese in einem autokratischen Regime wie Katar ausrichtet. Auch Fußballer wie Manuel Neuer, die bei der Europameisterschaft 2021 noch mit einer Regenbogenbinde am Arm aufliefen, müssen sich fragen, wie glaubwürdig solche Gesten sind, wenn sie sich nicht öffentlich zur Lage in Katar äußern. Umso wichtiger ist es, nicht auf die Inszenierung Katars hereinzufallen. Stattdessen sollte sich die Sportwelt mit den Arbeitsmigrant*innen und den Organisationen, die sich für die Abschaffung des Kafala-Systems stark machen, solidarisieren.
Gerade Fußballnationen wie die Bundesrepublik stehen dabei in besonderer Verantwortung. Denn vor allem der deutsche Profifußball und der Golfstaat sind längst eng verwoben. Das zeigte sich etwa 2019, als Gerüchte darüber kursierten, dass Qatar Airways als Sponsor des DFB im Gespräch sei. Bereits seit 2018 ist die Fluglinie aus dem Emirat Hauptsponsor des erfolgreichsten deutschen Fußballklubs, FC Bayern München, was immer wieder zu Fanprotesten führt. Die deutsche Nationalmannschaft absolvierte Trainingslager in Katar und nahm dort 2020 an der Klub-WM teil. Da hilft es wenig, dass die Nationalelf im März 2020 beim WM-Qualifikationsspiel gegen Island in Trikots mit dem Schriftzug „Human Rights“ auflief, um so ein Zeichen gegen die Arbeitsbedingungen in Katar zu senden. Denn nur wenige Tage später trug der Großteil der Mannschaft wieder Bayern-Trikots – auf denen „Qatar Airways“ prangt.
Auch wirtschaftlich ist der deutsche Markt für die Fifa bedeutsam: Bei der WM 2014 lag die durchschnittliche Fernsehzuschauerzahl hierzulande bei gut 12,3 Millionen, das Finale sahen sogar knapp 35 Millionen Menschen.[9] Angesichts dessen wäre es erstrebenswert, wenn die Nationalmannschaft ihren Einfluss nutzen und sich gegen eine WM-Teilnahme entscheiden würde. Aber zugleich darf der Boykott keine Entscheidung sein, die auf dem Rücken einzelner Spieler ausgetragen wird. Sie müsste eine politische sein, die von höheren Instanzen wie dem DFB und von der breiten Öffentlichkeit getragen wird. Erst dann würde es sich zukünftig weder für die Fifa noch für Sponsoren lohnen, den Fußball für die Belange von Autokraten einzuspannen.
[1] Vgl. Neue Bestechungsvorwürfe um WM-Vergaben, www.zdf.de, 7.4.2020.
[2] Kevin P. Hoffmann, Gewerkschaften befürchten 4000 tote Arbeiter, www.tagesspiegel.de, 17.3.2014.
[3] Pete Pattisson, Revealed: 6,500 migrant workers have died in Qatar since World Cup awarded, www.theguardian.com, 23.02.2021.
[4] Markus N. Beeko, Fußball-WM in Katar: Flutlicht an für die Menschenrechte!, www.amnesty.de, 24.3.2021.
[5] Vgl. Katar: Kaum Fortschritte beim Schutz von Arbeitsmigranten, www.hrw.org, 24.8.2020.
[6] Vgl. Landmark labour reforms signal end of kafala system in Qatar, www.ilo.org, 16.10.2019.
[7] Inga Hofmann, Amnesty kritisiert weitere Menschenrechtsverletzungen in Katar, www.tagesspiegel.de, 16.11.2021.
[8] Vgl. Josh Cavallo: the world’s only openly gay top-tier men’s footballer, www.theguardian.com, 8.11.2021.
[9] Vgl. Ranking der Spiele mit den meisten Fernsehzuschauern bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, https://de.statista.com, 14.7.2014.