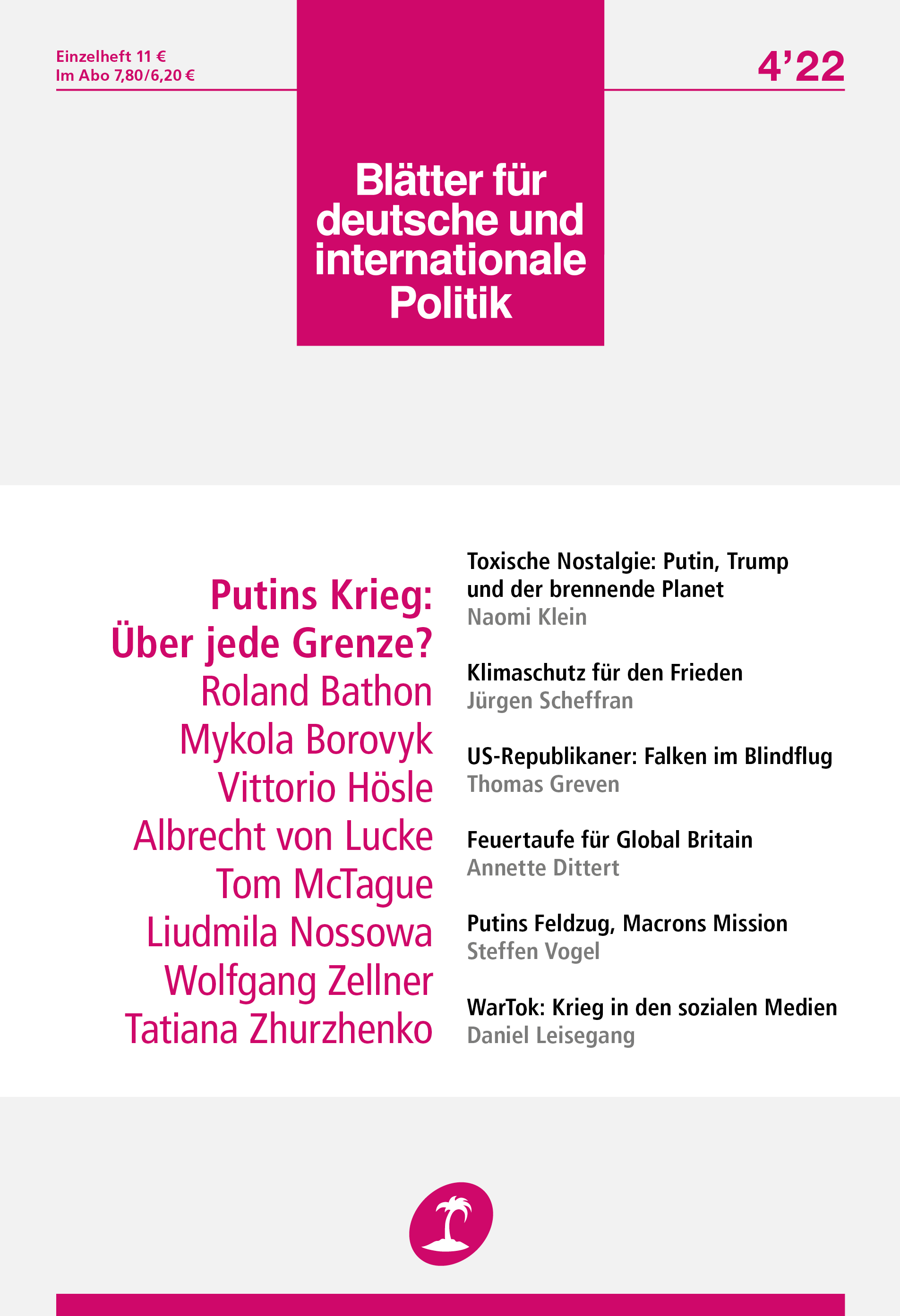Bild: Transparent gegen Gazprom im Stadion des FC Schalke 04 mit dem Schriftzug »Gemeinsam für Frieden« (IMAGO / Jan Huebner)
Es ist eines der wichtigsten Fußballspiele dieses Jahres: Am 28. Mai findet das Finale der Champions League statt, das ausgerechnet an Wladimir Putins Heimatstadt St. Petersburg vergeben worden war. In der Gazprom-Arena sollte der beste europäische Fußballklub gekürt werden. Doch nachdem Putin die Ukraine überfallen und einen brutalen Krieg losgetreten hatte, entschied der Europäische Fußballverband Uefa, das Finale nach Paris zu verlegen.
Dies ist eine bemerkenswerte Kehrtwende. Denn bis dato hatten insbesondere die großen Fußballverbände weder den engen Kontakt zum Kreml noch das Geld russischer Unternehmen und Oligarchen gescheut. Das belegen nicht zuletzt jene Fotos eindrücklich, die etwa den Präsidenten des Weltfußballverbandes Fifa, Gianni Infantino, dabei zeigen, wie er von Putin den „Orden der Freundschaft“ verliehen bekommt, oder auf denen Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), mit diesem lachend Macarons verspeist.
Nun aber müssen sich Verbände und Vereine die grundlegende Frage stellen, wie viel Einfluss sie autokratischen Herrschern künftig einräumen wollen. Aus der Not könnten sie damit eine Tugend machen: Denn den Verantwortlichen bietet sich jetzt die Chance, den Profisport kommerziell neu auszurichten – und damit dem eigenen Anspruch auf Fairplay auch jenseits des Spielfelds gerecht zu werden.
Wie sehr Putin sportliche Großereignisse für seine Zwecke instrumentalisiert, bewies er zuletzt bei den Olympischen Spielen in Peking. Noch während der Winterspiele marschierten seine Streitkräfte an der ukrainischen Grenze auf. Kaum war das olympische Feuer erloschen, überfielen sie dann das Nachbarland. Damit verstieß der russische Präsident gegen das Völkerrecht, aber auch gegen die Waffenruhe-Resolution, die Anfang Dezember von der UN-Vollversammlung beschlossen und sowohl von Russland als auch China unterzeichnet worden war. Demnach galt der Olympische Frieden bis zum Ende der Paralympischen Spiele am 13. März, rechtlich bindend war diese Resolution jedoch nicht.
Es war bei weitem nicht das erste Mal, dass Putin so vorging. Im Jahr 2008 marschierten russische Truppen in Georgien ein, derweil Putin bei den Sommerspielen von Peking auf der Tribüne saß. Sechs Jahre später bereitete er, als sein Land die Winterspiele in Sotschi ausrichtete, die völkerrechtswidrige Annexion der Krim vor. So konnte auch die Geste Putins, der in Peking wohl nicht zufällig augenscheinlich eindöste, als das ukrainische Team bei der Eröffnungsfeier einlief, nicht darüber hinwegtäuschen, dass er beim Thema Ukraine alles andere als schläfrig war. Denn offenkundig war bereits in diesem Moment längst der Plan gefasst, nach dem Event loszuschlagen.
Putins Treiben schauten sowohl das IOC als auch internationale Sportverbände wie die Uefa jahrelang tatenlos mit an; allzu gerne verwiesen sie auf die „politische Neutralität“ sportlicher Großveranstaltungen. Die Untätigkeit hatte aber vor allem wirtschaftliche Gründe: Viele der Verbände sind massiv von russischen Investitionen abhängig und scheuen ernsthafte Konsequenzen aus der Sorge heraus, dass ihnen dann der Geldhahn abgedreht wird.
Schalkes Abhängigkeit
Tatsächlich reicht Putins geopolitische Strategie weit über Olympia hinaus und bis tief in die Strukturen der europäischen Sportwelt hinein. Wie eng russisches Gas, Sport und Politik miteinander verwoben sind, zeigt besonders deutlich das europaweite Engagement des russischen Energiekonzerns Gazprom, der als Hauptsponsor bis vor kurzem auch die Trikots des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 zierte.
Die Partnerschaft brachte der damalige Aufsichtsratschef Clemens Tönnies vor rund fünfzehn Jahren auf den Weg, stolz präsentierte er damals mit seinem „Freund“ Putin das blau-weiße Trikot mit den neuen Gazprom-Logos. Rund neun Millionen Euro kassiert der Verein pro Saison dafür bis zuletzt – insbesondere für die Zweite Liga eine außergewöhnlich hohe Geldsumme. Das überaus großzügige Sponsoring kam nicht nur Schalke zugute, sondern auch Russland. Denn dank Gazprom saß bis Kriegsbeginn mit Matthias Warnig ein ehemaliger hochrangiger Stasi-Mitarbeiter und enger Vertrauter Putins im Aufsichtsrat des Vereins – der zugleich Chef der Nord Stream 2 AG ist. Bei Bundesligaspielen konnte Warnig in der VIP-Loge Kontakte in die deutsche Wirtschaft und Politik knüpfen und Werbung für die Ostseepipeline betreiben. Immerhin legte Warnig am Tag des Kriegsbeginns sein Amt bei Schalke mit sofortiger Wirkung nieder. Auch sein Name steht auf den Sanktionslisten der USA.
Russland nutzte den Fußball aber nicht nur, um politische Beziehungen aufzubauen, sondern auch, um sich selbst zu inszenieren. Sportklubs wie Schalke sollten dem Ganzen eine unpolitische Fassade verleihen und Projekten, die gerade in Europa massiv in der Kritik standen und stehen, ein neues Image verpassen. Dank der Werbepartnerschaft war Gazprom bei etlichen Heimspielen auf Werbetafeln und im Merchandise präsent. Bei den Fans kam das nicht immer gut an: Sowohl die Einsetzung des ehemaligen Stasi-Mitarbeiters als auch der Sponsoren-Deal führten zu regelmäßigen Protesten. Nach der Invasion in der Ukraine wurden rasch Forderungen laut, sich endgültig von Gazprom zu trennen. In den sozialen Medien kursierten Fotos des Trikots, das anstelle des üblichen Logos den Schriftzug „Nie wieder Krieg“ zeigten.
Schalke geriet daraufhin unter enormen Druck. Der hochverschuldete Traditionsklub ist, nachdem er aufgrund der Corona-Pandemie lange vor leeren Zuschauerrängen spielen musste, abhängiger denn je von den Geldflüssen aus Russland. Im Geschäftsjahr 2020 lagen seine Gesamtschulden bei 217 Mio. Euro. Auch deshalb hatte den Verein einst selbst die Besetzung der Krim nicht davon abgehalten, das Sponsoring fortzusetzen – im Gegenteil: Erst im vergangenen Jahr verlängerte der Vereinsvorstand die Partnerschaft mit Gazprom, die eigentlich 2022 ausgelaufen wäre, um weitere drei Jahre.
Umso mehr aber überraschte es, als Schalke noch am Tag der Invasion tatsächlich die Schriftzüge von seinen Trikots entfernte und kurz darauf auch den Vertrag mit Gazprom aufkündigte. Weniger überraschte hingegen, dass ausgerechnet der Unternehmer Clemens Tönnies umgehend finanzielle Hilfe anbot. Nach einem rassistischen Vorfall war er im Juni 2020 von seinen Ämtern bei Schalke zurückgetreten. Der Verein sei für ihn aber nach wie vor „eine Herzensangelegenheit“, betont er nun.[1] Ob Schalke auf sein Angebot eingeht, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden. Die Fans allein werden das Loch, das die Trennung von Gazprom in die Vereinskasse gerissen hat, jedenfalls nicht stopfen können, auch wenn sie bereits sämtliche Schalke-Trikots aufkauften und damit sogar kurzzeitig den Online-Shop lahmlegten.
Gazproms Motto: Sport ist käuflich
Mit der Entscheidung, sich von dem russischen Konzern zu trennen, bewies Schalke Haltung und setzte zugleich ein wichtiges Zeichen – weit über den deutschen Fußball hinaus. Denn Putin nutzt den Sport längst europaweit als geopolitisches Machtinstrument. So stieg Gazprom bereits 2010 als Hauptsponsor beim Fußballverein FK Roter Stern Belgrad ein, nur wenige Jahre später begann der Bau einer wichtigen Erdgas-Pipeline in Serbien. Unter dem Schlagwort „soziale Verantwortung“ verbucht der russische Konzern auf seiner Website außerdem Investitionen in den Fußballklub Zenit St. Petersburg sowie in die gleichnamigen Volleyball- und Basketballmannschaften. Dank der massiven Finanzspritzen ist St. Petersburg aus dem europäischen Sport heute kaum noch wegzudenken.
Für die Imagepflege wurde bereits im Jahr 2012 sogar Franz Beckenbauer angeheuert. Als Gazproms „Sportbotschafter“ sollte er die anstehenden Sportereignisse in Russland, allen voran die Winterspiele in Sotschi 2014 und die Fußball-WM 2018 bewerben. Nur zwei Jahre zuvor hatte Beckenbauer mutmaßlich für die Vergabe der WM an Russland votiert. Jegliche Vorwürfe, dass der Vertrag etwas mit der Wahl zu tun gehabt haben könnte, streitet er bis heute beharrlich ab.[2] Vage äußerte er sich auch im Hinblick auf die Bezahlung seiner Tätigkeit: Auf die Frage, wie viel er mit dem Werbedeal verdient habe, lächelte er nur und verwies auf seinen Manager, der behauptete, die genaue Summe vergessen zu haben.[3]
Seit 2012 zählt Gazprom ebenfalls zu den Hauptsponsoren der Champions League, und seit 2016 gehört der Konzern zu den wichtigsten Geldgebern der Fifa. Schätzungen zufolge soll er jährlich mindestens 40 Mio. Euro an die Uefa überwiesen haben. Mit Alexander Dyukov, dem Vorstandsvorsitzenden der Mineralölfirma Gazprom Neft, ist außerdem die russische Politik im Uefa-Exekutivkomitee vertreten. Insofern überraschte es kaum, dass das Finale der Champions-League ausgerechnet in St. Petersburg ausgetragen werden sollte. Trotz massiver Proteste von Fans und Politiker*innen, denen sich sogar das Europaparlament anschloss, hielt die Uefa zunächst an dem Austragungsort fest. Wie sehr sie dabei den Ernst der Lage ignorierte, zeigte sich eindrücklich, als sie auf Twitter einen „Fröhlichen Donnerstag“ wünschte – derweil russische Panzer bereits über die ukrainische Grenze rollten. Erst als der Druck zu groß wurde und Konsequenzen unausweichlich wurden, entschied sich die Uefa, das Finale nach Paris zu verlegen.
Mehr Fairplay, weniger Kommerz
Diese Entscheidung sollte jedoch nur der erste Schritt von weiteren tiefgreifenden Maßnahmen sein. Sowohl die Uefa als auch die Fifa haben über Jahre eindeutige Positionierungen und erst recht ernsthafte Sanktionen gescheut. Statt aber – wie von ihnen behauptet – „neutral“ zu agieren, haben die Verbände, indem sie Putin über Jahre eine Bühne für seine Selbstinszenierung boten, überaus politisch gehandelt. Selbst nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim bauten sie die Beziehungen zum Kreml stetig aus und trugen so aktiv dazu bei, Wladimir Putin als autokratischen Machthaber zu legitimieren.
Viele Athleten sind hier bereits weiter und scheuen keineswegs, Putin die rote Karte zu zeigen. So schrieb der russische Tennisspieler Andrei Rubljow unmittelbar nach der russischen Invasion während eines live übertragenen Spiels kurzerhand „Kein Krieg, bitte“ auf die Linse einer Fernsehkamera. Der Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel verkündete, den Grand-Prix in Russland zu boykottieren. Und Bayern-Star Robert Lewandowski entschied sich gemeinsam mit der polnischen Nationalmannschaft, bei den Ausscheidungsspielen der kommenden Fußball-WM nicht gegen Russland anzutreten.
Dem schlossen sich Tschechien, Schweden und Polen an, sodass die russische Nationalmannschaft plötzlich ohne Gegner dastand. Die Sportler erhöhen damit den Druck auf die Fifa massiv, die zunächst noch daran festgehalten hatte, den russischen Fußballverband auf neutralem Boden und unter neutraler Flagge starten zu lassen. Ein halbherziger Sanktionsversuch, der bereits nach dem Dopingskandal bei den Olympischen Spielen 2018 wenig Wirkung gezeigt hatte.
Als dann auch noch das IOC forderte, russische und belarussische Sportler*innen und Funktionär*innen nicht mehr an internationalen Wettbewerben teilnehmen zu lassen, zog die Fifa – einmal mehr viel zu spät – die Reißleine. Gemeinsam mit der Uefa suspendierte sie russische Klubs und Nationalmannschaften von allen internationalen Wettbewerben. Mittlerweile hat der Europäische Fußballverband auch die Zusammenarbeit mit Gazprom beendet – wohl kaum aus moralischen Gründen, sondern weil der wirtschaftliche Druck zu groß wurde. Der polnische EVP-Politiker und ehemalige Nationalspieler Thomasz Frankowski hatte sogar ins Spiel gebracht, den Sponsoren-Deal mit EU-Sanktionen zu belegen.[4]
Die Verflechtungen aufbrechen
Die Rücklagen der Champions League sollten vorerst ausreichen, um den Verlust zu kompensieren. Im Notfall könnten in den kommenden Jahren unter anderem die Prämien für die Champions League etwas schmaler ausfallen. Zur Erinnerung: Derzeit liegt die Startprämie pro Klub bei über 15 Mio. Euro, und der FC Bayern München verdiente als Gewinner 2020 sage und schreibe 130 Mio. Euro. Auch der Deutsche Fußball-Bund wird den Gürtel nun enger schnallen müssen. Schließlich war Gazprom als Hauptsponsor der EM 2024 in Deutschland vorgesehen. Zugleich aber bleibt noch ausreichend Zeit, fairere Ersatzsponsoren anzuwerben.
Was fairer genau bedeutet, sollte Thema einer breiteren gesellschaftlichen Debatte sein. Spätestens nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sollte dabei schon jetzt klar sein: Wenn der Profisport sich Werte wie Fairplay auf die Fahne schreibt, muss er sich aus der Abhängigkeit von Oligarchen befreien. Kurzfristig wird das mit erheblichen wirtschaftlichen Einbußen verbunden sein. Langfristig aber bietet es die Chance, nicht nur vor den Fans Haltung zu zeigen, sondern vor allem auch, die engen Verflechtungen von Politik, Wirtschaft und Sport endlich aufzubrechen. Gerade im Hinblick auf zukünftige Sportereignisse wie die WM in Katar erscheint ein fair finanzierter Sport, bei dem Fußballvereine nicht zuallererst als politisch instrumentalisierte Aktiengesellschaften autokratischer Regime agieren, wichtiger denn je.
[1] „Habe mich in ihm getäuscht“: Clemens Tönnies bricht mit Putin, www.handelsblatt.com, 2.3.2022.
[2] Vgl. Jürgen Dahlkamp u.a., Berater Radmann soll Beckenbauer Stimme zum Kauf angeboten haben, www.spiegel.de, 30.10.2019.
[3] Vgl. Claudia Thaler, Lassen Sie uns nicht über Politik reden!, www.spiegel.de, 2.7.2013.
[4] Vgl. Maximilian Rieger, Wie Russland seine Macht durch den Sport ausbaut, www.deutschlandfunk.de, 22.2.2022.