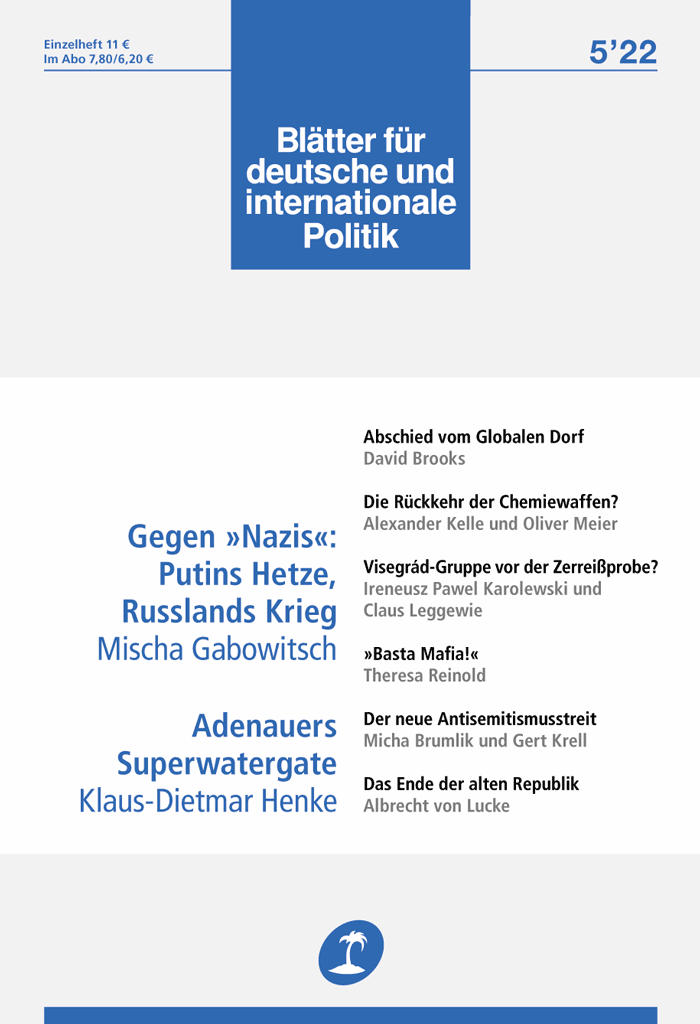Bild: Der syrische Präsident Baschar al-Assad und der russische Präsident Wladimir Putin geben sich bei einem Treffen im Kreml die Hand, 13.9.2021 (IMAGO / ITAR-TASS)
Viele müssen bei den schrecklichen Bildern aus Mariupol an das von faschistischen Bombern zerstörte Guernica denken. Und manche fühlen sich angesichts der Leichen in den Straßen von Butscha an das Massaker von Srebrenica erinnert. Für Millionen Syrerinnen und Syrer ist das bitter. Denn die Assoziation „Guernica“ hätten bereits die Bilder aus Aleppo, wenn nicht schon viel früher die aus dem tschetschenischen Grosny hervorrufen müssen: Die Menschen in Syrien heben seit zehn Jahren Massengräber aus – etwa nach dem Massaker in Daraya Ende August 2012, als Soldaten und Milizionäre des Regimes tagelang von Haus zu Haus gingen und mehr als 200 Einwohner des Ortes südwestlich von Damaskus hinrichteten. Die absichtsvolle Terrorisierung von Zivilisten durch Luftangriffe, die in der spanischen Stadt Guernica 1937 zum ersten Mal erprobt wurde, hat Wladimir Putin in Tschetschenien gelernt und in Syrien optimiert. Und das Ermorden wehrloser Bewohner eroberter Gebiete haben russische Soldaten womöglich aus Syrien übernommen. Doch anders als die Ukraine ist Syrien noch immer – oder schon wieder – ganz weit weg.
Dabei zeigt sich dort seit Jahren, welche Mittel der russische Präsident für einen Sieg einzusetzen bereit ist – selbst dann, wenn dieser Sieg nur mittelbar sein eigener ist. In Syrien hält Putin ein despotisches Regime an der Macht, und da seine längste und umfangreichste Militärintervention ab 2015 auf Einladung von Präsident Baschar al-Assad erfolgte, ist sie an sich nicht völkerrechtswidrig. In der Ukraine hingegen greift der Kreml-Chef eine demokratisch gewählte Regierung von außen an – den Regimewechsel, den er dem Westen in Damaskus zu Unrecht unterstellt, betreibt er jetzt in Kiew selbst.
Putins Methoden – die willkürliche Bombardierung von Wohnvierteln, gezielte Raketenangriffe auf zivile Infrastruktur, das Abriegeln von Stadtteilen und Aushungern ihrer Bewohner – sind in Syrien ohne Konsequenzen geblieben und gehen deshalb weiter. Anfang 2022 griffen russische Kampfjets eine Wasserpumpstation, mehrere Hühnerfarmen und ein kleines Flüchtlingslager in Idlib an.[1] Doch für Russlands syrische Opfer – in dem Fall eine Mutter und zwei Kinder – interessiert sich in Europa schon lange niemand mehr. Diese Ignoranz rächt sich nun, denn es ist die Straffreiheit für seine in Syrien begangenen Völkerrechtsverbrechen, die Putin ermutigt hat, die Ukraine in dieser Form anzugreifen.
Die Blockade des Völkerrechts
Der Krieg in Syrien ist allerdings nicht nur ein Lehrstück für Putins militärisches Vorgehen, sondern auch für seinen Umgang mit Verhandlungspartnern, internationalen Organisationen und deren humanitärer Hilfe. Seit 2011 hält Russland im Weltsicherheitsrat seine schützende Hand über den durch einen bewaffneten Aufstand bedrängten Machthaber Assad. Moskau verhinderte zwischen Oktober 2011 und Juli 2020 mit seinem Veto 16 UN-Resolutionen zu Syrien. Völkerrechtsverbrechen des syrischen Regimes können deshalb nicht an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag überwiesen werden.
Zugleich wird die milliardenschwere, zu 80 Prozent von den USA und Europa finanzierte UN-Hilfe vom Assad-Regime zum Machterhalt missbraucht. Denn Hilfsgüter müssen in Absprache mit Damaskus verteilt werden und erreichen deshalb nicht die bedürftigsten, sondern die besonders loyalen Syrer. Nur die von Extremisten kontrollierte Provinz Idlib, Zufluchtsort für Millionen Assad-Gegner, erhält noch direkte humanitäre Hilfe aus dem Ausland – über den letzten von ursprünglich vier grenzüberschreitenden Hilfskorridoren, die die UN für die Versorgung von Regionen außerhalb der Kontrolle des Regimes eingerichtet hatte.
Diese grenzüberschreitende Hilfe muss alle sechs Monate vom Weltsicherheitsrat verlängert werden, dann bettelt der Westen bei Putin darum, humanitär helfen zu dürfen. Bei der nächsten Abstimmung im Juli 2022 könnte sich der Kreml-Chef für die gegen Russland verhängten Sanktionen rächen, indem er die direkten Hilfslieferungen nach Idlib per Veto beendet.
Wann immer UN-Resolutionen von Putin nicht gänzlich verhindert werden können, weicht Moskau sie inhaltlich so auf, dass sie seine Verbündeten absichern. Bestes Beispiel dafür ist die Resolution 2254 aus dem Dezember 2015 – jenes UN-Dokument, auf das sich alle Akteure im Syrien-Konflikt bis heute berufen. Diese Resolution – das Ergebnis intensiver Gespräche zwischen Moskau und Washington, die im Oktober 2015 mit der Internationalen Syrien-Kontaktgruppe die einzig ernst gemeinte diplomatische Initiative zur Lösung des Konflikts ergreifen – fordert ein Ende der Angriffe auf Zivilisten, den ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe und die Freilassung von willkürlich verhafteten Personen. Doch es gibt eine Hintertür, die Moskau seither offenhält: den „Anti-Terror-Kampf“.
Der Text erlaubt ausdrücklich die Fortsetzung des Kampfes gegen Terrorgruppen wie den IS und die Nusra-Front und „mit ihnen verbündete Gruppen“, ihre Rückzugsgebiete sind von der Waffenruhe ausgenommen und sollen „ausgelöscht“ werden. Das ist der Freibrief, den das Assad-Regime braucht, um sämtliche oppositionelle Regionen in Homs, Ost-Aleppo, dem Umland von Damaskus, Daraa und Idlib weiter abzuriegeln, zu bombardieren und so seinen Krieg gegen Zivilisten ungestört fortzusetzen – seit September 2015 mit Putins Luftunterstützung. Nach Angaben des Moskauer Generalstabs flog die russische Luftwaffe in den ersten Jahren bis zu 42 Kampfeinsätze und 157 Angriffe pro Tag. Bis Anfang 2019 sammelten 68 000 russische Militärangehörige Kampferfahrung in Syrien – stets mit Blick auf mögliche andere Kriegsschauplätze.
Vorbild Tschetschenien
Was den Einsatz bloßer Feuerkraft angeht, folgt auch die Syrien-Intervention einem historischen Vorbild – den Tschetschenien-Kriegen der Neunzigerjahre. Ohne Rücksicht auf Zivilisten beschoss das russische Militär damals Grosny, das die Vereinten Nationen 2002 zu der am schwersten zerstörten Stadt der Welt erklärten.
15 Jahre später ermöglichen neu entwickelte Lenkraketen in Syrien die absichtsvollen Angriffe auf zivile Infrastruktur, die das Leben der Menschen vor Ort zur Hölle machen. In der Ukraine sind bislang vor allem Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen, Regierungsgebäude und Behörden dokumentiert, in Syrien nehmen die Piloten seit Jahren Krankenhäuser, Schulen und Marktplätze ins Visier. Dies belegen Berichte syrischer und internationaler Nichtregierungsorganisationen, UN-Untersuchungen sowie Medienrecherchen zu einzelnen Operationen. Der modernen Militärtechnik des Kreml haben die syrischen Rebellen – egal ob moderat, islamistisch oder dschihadistisch – nichts entgegenzusetzen, denn im Gegensatz zur ukrainischen Armee bekommen sie trotz jahrelanger Forderungen keine Flugabwehrraketen von ihren Verbündeten. Außerdem setzt Russland in Syrien – und ersten Berichten zufolge auch in der Ukraine – Brandbomben, Streumunition und Vakuumbomben ein, die in ziviler Umgebung laut Genfer Konvention verboten sind.
Die gemeinnützige Nichtregierungsorganisation Airwars, die in Syrien die Luftangriffe sämtlicher Kriegsparteien dokumentiert, geht von mindestens 23 000 Zivilisten aus, die im Zeitraum von September 2015 bis September 2021 durch russische Angriffe getötet wurden, darunter 4831 Kinder.
Desinformation und Propaganda
Um diese Form der Kriegsführung zu rechtfertigen, muss der Gegner diskreditiert und entmenschlicht werden. Offiziell bekämpft Putin deshalb in Syrien nur „Terroristen“, in der Ukraine sind seine Feinde sämtlich „Neonazis“ und „Faschisten“. Das Verbreiten von Desinformation und Propaganda hat Moskau zur wirksamen Kriegswaffe ausgebaut.
Beispielhaft dafür ist die Hetzkampagne gegen die syrische Zivilschutzorganisation Weißhelme, die Trägerin des Alternativen Nobelpreises 2016. Die Rettungskräfte, die nach ihren weißen Helmen benannt sind, suchen nach Verschütteten, arbeiten als Sanitäter und Feuerwehr. Daneben dokumentieren sie die Folgen der Luftangriffe mit Hilfe von Hand- und Helmkameras, was sie für Russland gefährlich macht – schließlich zeigen ihre Videos regelmäßig die zivilen Opfer russischer Raketeneinschläge. Seit September 2016 versuchen russische UN-Vertreter und Medien deshalb, die Weißhelme zu diffamieren. Sie verbreiten Gerüchte, Spekulationen, Halbwahrheiten und Lügen, um die von der Organisation gesammelten Beweise unglaubwürdig erscheinen zu lassen und die Weißhelme selbst zu einem legitimen Angriffsziel zu machen.
Narrative gegen die Wahrheit
Die mediale Strategie, zu einem bestimmten Ereignis so viele Narrative und Widersprüche in die Welt zu setzen, bis die Wahrheit am Ende als eine von mehreren möglichen Versionen erscheint, hat Putin in Syrien perfektioniert. Wie sie funktioniert, zeigt besonders klar der Sarin-Angriff auf Khan Sheikhoun am 4. April 2017 mit 74 Toten und Hunderten Verletzten.
In ihrem siebten Bericht kommt die gemeinsame Untersuchungskommission der Vereinten Nationen und der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) am 25. Oktober 2017 zu dem Schluss, dass die syrische Regierung für den Giftgasangriff verantwortlich ist. Alle ermittelten Fakten – Uhrzeit, Einschlagkrater, Luftangriff, Symptome der Opfer, Art des Sarins – sprechen für diese Erkenntnis, die sich auf Zeugenaussagen, Satellitenbilder, behandelnde Ärzte, Bodenproben, Blutproben der Opfer, Expertenanalyse, Videos von vor Ort und anderes stützt. Weil aber Russland die internationalen Ermittlungen als unseriös abtut und abstruse Behauptungen aufstellt, halten sich diverse andere, konstruierte Versionen des Angriffs bis heute hartnäckig.[2]
Auch in der Ukraine setzen russische Politiker und Journalisten auf Lügen und Leugnen – die Leichen in den Straßen von Butscha werden als „inszenierte Provokation des ukrainischen Regimes“ bezeichnet, der Angriff auf die Entbindungsstation in Mariupol soll mit Hilfe einer ukrainischen Bloggerin nachgestellt worden sein.[3]
Eine weitere Parallele zeigt sich beim Thema Verhandlungen. Die russische Führung gibt sich gesprächsbereit und trifft sich regelmäßig mit ukrainischen Vertretern, allerdings ändern die Kontakte nichts an den Entwicklungen am Boden. Für Syrerinnen und Syrer ein bekanntes Phänomen, hat man sich doch in Genf, Wien oder Astana immer wieder auf Waffenruhen, Deeskalationszonen und humanitäre Zugänge geeinigt, die am Ende nicht umgesetzt wurden. Verhandlungen werden folglich vorgetäuscht, um Zeit zu gewinnen und militärisch Fakten zu schaffen. Dadurch bleibt Moskau im diplomatischen Austausch mit den vermittelnden Staaten – der Türkei und Israel – und westliche Regierungen und Medien sind in ihrem naiven Glauben an eine schnelle Verhandlungslösung vom Kriegsgeschehen abgelenkt.
Der entscheidende Unterschied zwischen Syrien und der Ukraine ist der Verlauf des Krieges. Assad hatte alles, was er brauchte, um den zivilen und den bewaffneten Widerstand seiner Landsleute zu brechen und mit iranischer wie russischer Unterstützung weite Teile des Landes zurückzuerobern. Für den syrischen Machthaber hat es sich stets gelohnt weiterzukämpfen, denn er konnte den Krieg mit militärischen Mitteln für sich entscheiden – dieses Ungleichgewicht der Kräfte hat eine politische Lösung in Syrien von Anfang an verunmöglicht.
Putin dagegen hat sich in der Ukraine verkalkuliert. Seine Truppen werden nicht als Befreier von einer faschistischen Herrscherclique gefeiert, sondern als Besatzer wahrgenommen und bekämpft – und zwar von einer hochmotivierten ukrainischen Armee und einer opferbereiten Bevölkerung.
Putin läuft die Zeit davon
In der Ukraine läuft Putin deshalb die Zeit davon, während sie in Syrien für ihn arbeitet. Assad wird aller Völkerrechtsverbrechen zum Trotz wieder gesellschaftsfähig, die arabischen Nachbarn normalisieren Schritt für Schritt ihre Beziehungen zu Damaskus. Da das dortige Regime Putin in dankbarer Abhängigkeit ergeben ist, sind Russlands Interessen im Mittelmeerraum gesichert – auch über den Luftwaffenstützpunkt Hmeimin bei Latakia und die Marinebasis in Tartus. In Kiew dagegen sitzt mit Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Kommunikationsprofi, der den Krieg gegen sein Land in politisches wie militärisches Kapital umwandelt und den Westen dabei in die Pflicht nimmt. Putin steht auch unter Zeitdruck, weil er am 9. Mai, dem Ende des Zweiten Weltkriegs – des Großen Vaterländischen Krieges, wie er in Russland heißt – bei der alljährlichen Parade seine Beute präsentieren will. Am Ende könnte dies sogar die Chance auf eine Verhandlungslösung erhöhen. Denn der Kreml-Chef hat verstanden, dass er die Ukraine nicht vollständig unterwerfen und dauerhaft kontrollieren kann. Alles, was er jetzt braucht, ist ein militärisches Ergebnis, das er in der Heimat als Sieg verkaufen kann, um damit die Tausenden Gefallenen und die schmerzhaften Folgen der Sanktionen zu rechtfertigen – etwa die Eroberung des Donbas. Erst dann könnte er gesichtswahrend einem Abkommen mit der Ukraine zustimmen. Bis dahin aber wird keines seiner Gesprächsangebote wirklich ernst gemeint sein.
[1] In Idlib beginnt 2022 mit russischen Kriegsverbrechen – und die Bundesregierung schweigt, www.adoptrevolution.org, 3.1.2022, Cathrin Schaer, Russian strikes on farms in Syria could be war crimes: report, www.dw.com, 15.2.2022.
[2] Verärgert über den Bericht verhindert Russland Ende Oktober 2017 im Weltsicherheitsrat die Verlängerung der gemeinsamen Untersuchungskommission.
[3] Die schwangere Bloggerin Marianna war jedoch nicht als Schauspielerin, sondern als Patientin vor Ort und bestätigte sowohl den Angriff als auch den Tod einer Mitpatientin und deren ungeborenen Babys.