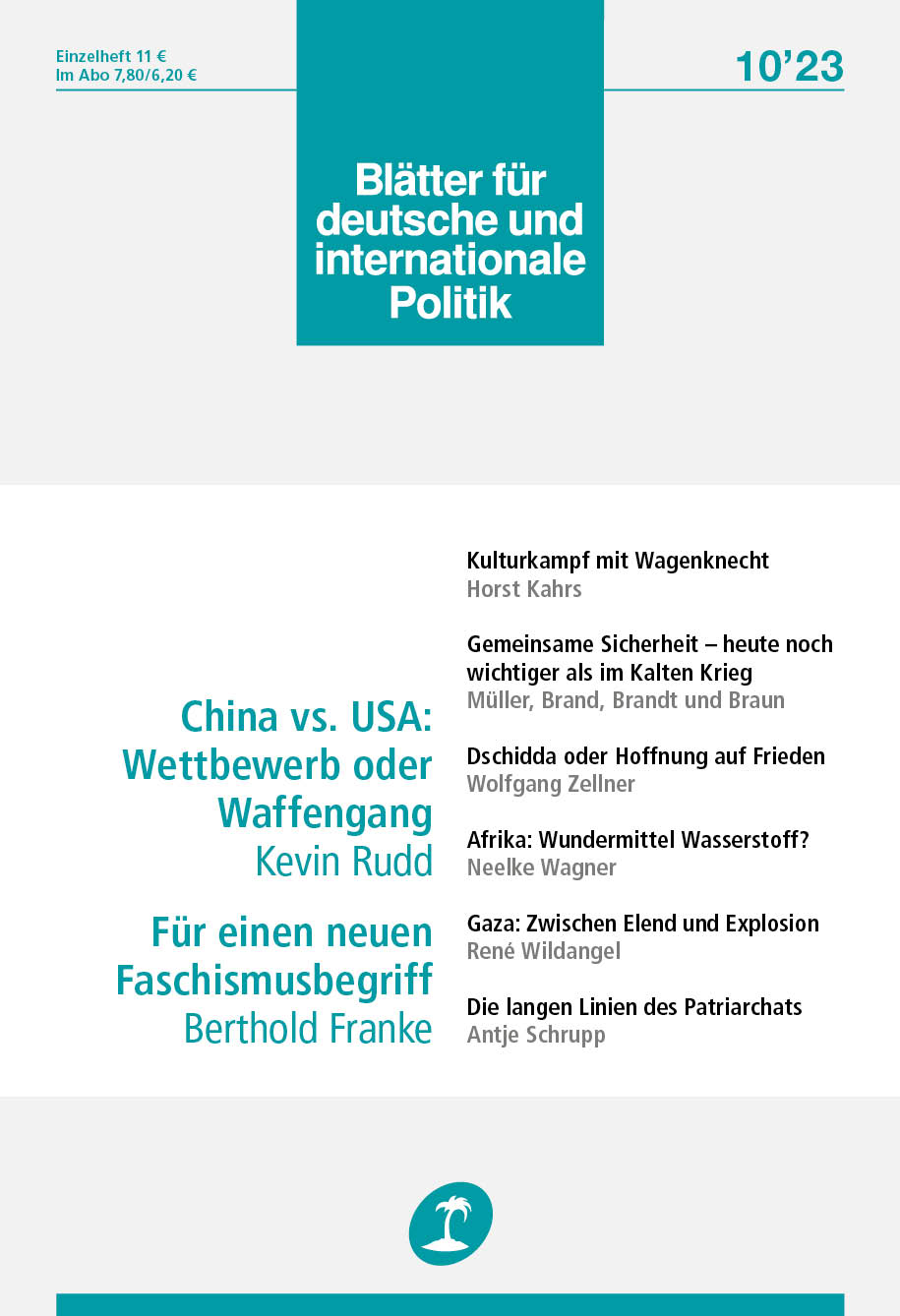Wider die Legende vom grünen Wachstum

Bild: (IMAGO / Ikon Images)
Vom 15. bis 17. Mai fand unter dem Titel „Beyond Growth. Pathways towards Sustainable Prosperity in the EU” im Europäischen Parlament in Brüssel eine historische Konferenz statt. Über 1000 Teilnehmende vor Ort sowie weitere 4000 online diskutierten mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und anderen hochrangigen Vertreter:innen der EU. Vor allem aber sprachen einige der bekanntesten internationalen Protagonist:innen der Degrowth- und Postwachstumsbewegung – und wurden vom vor allem jungen Publikum oft begeistert gefeiert. Tatsächlich war die Stimmung teils so euphorisch, dass einige die Konferenz im Nachhinein als „Woodstock for systemchangers“ bezeichneten.
In den Berichten der wirtschaftsliberalen und konservativen Medien zeigte sich hingegen, wie ablehnend sie Wachstumskritik noch immer gegenüberstehen. Mit den Worten „De-growers of the world, unite!“ polemisierte beispielsweise das britische Wirtschaftsmagazin „The Economist“ in seinem Bericht über die Konferenz. Damit schlug es in die gleiche Kerbe wie die lauter werdende Kritik, die Degrowth wahlweise zum Trojanischen Pferd des Ökosozialismus stilisiert oder das Konzept mit kapitalistischer Rezession und Austerität verwechselt. Ein guter Moment also, um Bilanz zu ziehen: Worum geht es bei der Degrowth-Debatte, was sind neuere internationale Forschungsergebnisse und inwiefern stellt Degrowth eine Antwort auf die Herausforderungen der Vielfachkrise dar?
Zunächst einmal ist festzuhalten: Die Einsicht in die Notwendigkeit für einen zunehmend als grundlegend angesehenen System Change hat sich angesichts der ökologischen Krisen in den letzten Jahren stark verbreitet. In seinem Bericht vom März stellte der Weltklimarat (IPCC) fest, dass es ein „sich schnell schließendes Zeitfenster“ gibt, um eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle zu sichern. Um dies zu erreichen und ein katastrophales, nicht reversibles „Hothouse Earth“-Szenario mit extremer Erwärmung und Meeresspiegelanstieg mit potenziell Millionen von Opfern zu verhindern, sind „schnelle und weitreichende Veränderungen in allen Sektoren und Systemen notwendig“, so der Bericht.[1] Während diese Aussagen einen wissenschaftlichen Konsens widerspiegeln, ist die Frage, wie dieser dringend benötigte „Systemwechsel“ aussehen soll, nach wie vor heftig umstritten. Das Grundversprechen der Politik ist seit fast fünf Jahrzehnten im Wesentlichen das gleiche: nachhaltiges oder grünes Wachstum. Durch Effizienzsteigerungen und den Umstieg auf erneuerbare Energien und Kreislaufwirtschaft, so das Argument, können Produktion und Profite gesteigert und die Umwelt gleichzeitig geschützt werden. Fast alle Regierungen weltweit, die die Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen erkannt haben, fördern Wirtschaftswachstum durch grüne Investitionen, eine dekarbonisierte Industriepolitik und nachhaltige Geschäftspraktiken. Es gibt jedoch zunehmend Zweifel, ob diese Strategien ausreichen, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Wie die Klimaaktivistin Greta Thunberg auf dem Klimaaktionsgipfel der Vereinten Nationen 2019 an die Politik gerichtet kritisierte: „Wir stehen am Anfang eines Massensterbens und alles, worüber ihr redet, sind Geld und das Märchen vom ewigen Wirtschaftswachstum.“ Die hegemoniale Nachhaltigkeitsidee – die eine Aussöhnung von Wachstum und ökologischer Nachhaltigkeit postuliert – wird zunehmend infrage gestellt, nicht nur in der Klimabewegung.
Das grundlegendste Problem mit den vorherrschenden Ansätzen zur Eindämmung des Klimawandels besteht darin, dass sie technologische Innovationen, neue Unternehmens- und Investitionsstrategien und marktwirtschaftliche Reformen als Win-win-Lösungen betrachten. Diese Ansätze vermeiden jedoch die notwendigen, vor allem klassenpolitischen Konflikte und sind nicht in der Lage, die schnellen Emissionssenkungen zu erreichen, die notwendig wären, um den Kollaps des Klimas aufzuhalten. Vielmehr schaffen sie oft neue soziale und ökologische Krisen, indem sie die Probleme lediglich verlagern – von Kohlenstoffemissionen zu einer Krise der biologischen Vielfalt, vom Globalen Norden zum Globalen Süden und von der Energieerzeugung zur Landzerstörung. So schaffen beispielsweise der Abbau seltener Erden für die Herstellung von Elektrofahrzeugen, die flächenintensive Produktion von Biokraftstoffen für den Flugverkehr oder die Herstellung von Wasserstoff in afrikanischen Ländern zur Versorgung der europäischen Industrie neue Umweltprobleme oder verschärfen bestehende.
Das Märchen vom emissionsfreien Wachstum
Vor allem aber ist die Studienlage zu grünem Wachstum mittlerweile immer eindeutiger: Demnach ist es nahezu unmöglich, Wachstum ausreichend schnell von den Emissionen zu entkoppeln. Global gesehen waren trotz aller Bemühungen um Klimaschutz und Jahrzehnten von Klimaverhandlungen die wenigen Phasen, in denen die weltweiten Treibhausgasemissionen absolut zurückgingen, Perioden der ökonomischen Schrumpfung – wie die Ölkrise der 1970er Jahre, der Zusammenbruch der sowjetischen und osteuropäischen Wirtschaft nach 1990, die Finanzkrise von 2008 und die durch die Coronaviruspandemie verursachte Wirtschaftskrise. Es stimmt zwar, dass einige Länder, wie auch die Bundesrepublik, bereits eine leichte Entkopplung des Wirtschaftswachstums von den Emissionen erreicht haben. In Europa zum Beispiel gingen die Treibhausgasemissionen um 34 Prozent zurück, während das BIP zwischen 1990 und 2020 relativ langsam, aber deutlich anstieg. Aber nichts anderes ist angesichts des Übergangs zu erneuerbaren Energien zu erwarten.[2] Und es ist kein Beleg für die Erfolgsgeschichte „grünen Wachstums“, für den diese Statistiken – oft aus dem Kontext gerissen – immer wieder herangezogen werden, von der „Financial Times“ bis hin zum Ungleichheitsforscher Branko Milanovic´. Denn genauere Analysen zeigen das Gegenteil: Die Reduktionen waren zu großen Teilen durch nicht wiederholbare Faktoren verursacht wie den Zusammenbruch der Industrie im Ostblock nach 1990 sowie Produktionsverlagerungen nach China. Und trotzdem waren sie mit im Durchschnitt weniger als einem Prozent pro Jahr viel zu gering und konzentrierten sich auf Phasen, in denen die Wirtschaft stagnierte oder nur sehr langsam expandierte. Um den im Pariser Abkommen festgelegten Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, sind wesentlich schnellere jährliche Emissionsminderungen erforderlich: laut Sachverständigenrat für Umweltfragen etwa elf Prozent pro Jahr für Deutschland oder sechs Prozent für die Europäische Union.[3] Andere Analysen weisen darauf hin, dass die Emissionen sogar noch stärker gesenkt werden müssen.[4]
Unter Berücksichtigung von globaler Gerechtigkeit müssen die Industrieländer zwischen 2030 und 2035 null CO2-Emissionen erreichen. Und dabei ist die historische Klimaschuld noch nicht einmal berücksichtigt. Beim aktuellen Reduktionstempo dauert es hingegen noch viele Jahrzehnte, bis die Emissionen auf null gesenkt werden – und bis dahin wird Deutschland sein verbleibendes Budget um ein Vielfaches überschreiten. Außerdem ist unklar, ob die wachsende Menge an Energie überhaupt erneuerbar hergestellt werden kann – oder ob nicht auch dies vor allem aufgrund von Speicherschwierigkeiten und endlichen Rohstoffen begrenzt ist.[5]
Die Zementierung neokolonialer Ungleichheiten
Darüber hinaus basiert grünes Wachstum gleich dreifach auf der Zementierung neokolonialer Ungleichheiten: Erstens bauen alle Szenarien für grünes Wachstum auf Negativ-Emissionstechnologien wie Bioenergy with Carbon Capture und Storage (BECCS) oder die großflächige Aufforstung – Technologien, die bisher nicht ausgereift sind und bei denen vor allem unklar ist, wie sie in den notwendigen Größenordnungen umgesetzt werden können – Größenordnungen, die potenziell riesige Landmassen im Umfang des gesamten Subkontinents Indien beanspruchen würden.
Zweitens reproduzieren alle Szenarien für grünes Wachstum extreme Niveaus von ungleichem Energieverbrauch zwischen den reichen Ländern und dem Globalen Süden – wie sich dies beispielsweise in den aktuellen Versuchen der Bundesregierung widerspiegelt, die sehr landintensive Produktion von Wasserstoff in Afrika voranzutreiben, um damit die deutsche Exportindustrie zu versorgen.
Drittens fußt grünes Wachstum auf einem massiven und global ungleich verteilten Ressourcenverbrauch – mehr Wachstum bedeutet mehr Energieverbrauch, und soll dieser erneuerbar sein, verbraucht das mehr Ressourcen, die weitgehend aus dem Globalen Süden angeeignet werden, endlich sind und deren Abbau eine der wichtigsten Ursachen für Biodiversitätsverlust und Artensterben darstellt. Alles in allem wird deutlich: Die notwendige, viel schnellere Verringerung der Emissionen ist bei gleichzeitigem makroökonomischem Wirtschaftswachstum im Globalen Norden nicht nur viel schwieriger, sondern sehr wahrscheinlich unmöglich. Um ein viel verwendetes Bild zu nutzen: Eine wachsende Ökonomie zu dekarbonisieren ist wie der Versuch, eine Rolltreppe herunterzugehen, die permanent hochfährt.
Die Kritik am grünen Wachstum wird also nicht nur von Aktivist:innen geäußert, sondern zunehmend auch in der Forschung lauter – und zwar auf der Basis immer stärkerer empirischer Daten. Forschungen vor allem aus der ökologischen Ökonomik zeigen die Grenzen des Wachstumsparadigmas auf, einschließlich des Rebound-Paradoxons, demzufolge eine effizientere Ressourcennutzung häufig deren Kosten senkt und somit letztlich zu einem höheren Verbrauch führt. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahre legen nahe, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, die Treibhausgasemissionen in dem Umfang reduzieren zu können, der notwendig ist, um einen Klimakollaps zu verhindern, wenn die Länder des Globalen Nordens weiterhin Wachstum – selbst vermeintlich „grünes Wachstum“ – anstreben.[6]
Degrowth als alternatives Gesellschaftsmodell?
Sowohl die Analyse, dass grünes Wachstum nicht nachhaltig sein kann, als auch die Diskussion über die Notwendigkeit alternativer Gesellschaftsmodelle wird vor allem unter dem Stichwort „Degrowth“ diskutiert. In den letzten zehn Jahren hat sich unter den Schlagwörtern décroissance, degrowth oder Postwachstum eine vor allem europäische Bewegung von Aktivist:innen und Wissenschaftler:innen versammelt, die das vorherrschende Entwicklungsmodell des kontinuierlichen kapitalistischen Wachstums kritisiert und nach Alternativen sucht. Degrowth – was so viel heißt wie Wachstumsrücknahme oder Entwachstum – ist dabei vor allem ein politischer und provozierender Slogan, der die Hegemonie des Wachstumsparadigmas infrage stellt. Degrowth fordert eine geplante ökologische Reduktion der Wirtschaftstätigkeit mit dem Ziel, die ökologischen Grenzen einzuhalten und so globale Gerechtigkeit, Wohlstand und Gleichheit zu stärken. Degrowth argumentiert, dass die sogenannten Industrieländer, um Nachhaltigkeit zu erreichen, das Ziel des BIP-Wachstums aufgeben und weniger notwendige und zerstörerische Formen der Produktion einschränken müssen, um den Energie- und Materialverbrauch zu reduzieren.
Degrowth oder Postwachstum – beides kann weitgehend synonym verwendet werden – führt dabei ziemlich vielfältige und teils widersprüchliche Strömungen und Positionen zusammen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie alle den Technikoptimismus des seit den 1990er Jahren vorherrschenden Nachhaltigkeitsdiskurses mit seinem Versprechen der Entkopplung von Wachstum und Umweltverbrauch kritisieren. Ökologische Gerechtigkeit, so ein Kernargument, kann nur erreicht werden, wenn die „imperiale Lebensweise“ des Globalen Nordens mit ihrem nicht nachhaltigen Wohlstand auf Kosten des Globalen Südens und der Umwelt überwunden wird.[7] Es geht also um die Deprivilegierung derjenigen, die aktuell auf Kosten anderer leben und diese Kosten in Raum und Zeit externalisieren. Und es geht darum zu problematisieren, dass die sich im Kapitalismus entwickelnden Produktivkräfte (technologischer Fortschritt, Industrialisierung, Digitalisierung, Kontrolle über die Natur) eben gerade nicht – wie in der Linken oft fortschrittsoptimistisch angenommen wurde – progressiv sind, sondern sich zu Destruktivkräften entwickeln. Weil eine absolute Entkopplung von Umweltverbrauch und Wirtschaftswachstum in ausreichendem Maß und der kurzen verbleibenden Zeit nahezu unmöglich ist, impliziert dies ein Ende des Wachstums im Globalen Norden und eine Verringerung der biophysikalischen „Größe“ der Wirtschaft.[8]
Die zweite wesentliche Gemeinsamkeit liegt in dem Versuch, „konkrete Utopien“ als Alternativen zum Wachstumsdiktat zu entwerfen, sich mit der Möglichkeit wachstumsunabhängiger Institutionen und Infrastrukturen auseinanderzusetzen und dies mit widerständigen Praktiken und alternativen Lebensweisen im Hier und Jetzt zu verbinden. Im Kern geht es darum, das Ökonomische als Sphäre einer verselbstständigten Rationalität und das ökonomische Kalkül als alleinige Entscheidungsgrundlage zurückzudrängen – und damit sowohl die Idee der Nachhaltigkeit als auch den gesellschaftlichen Stoffwechsel und die gesellschaftlichen Institutionen zu repolitisieren und zu demokratisieren sowie selbstbestimmte Freiräume zu erkämpfen. Überlegungen zu einer Postwachstumsgesellschaft sind dabei nicht isoliert und losgelöst von bisheriger Theorie und Praxis entstanden, sondern basieren auf einer Vielzahl von Denktraditionen und knüpfen an konkrete soziale Auseinandersetzungen an. Wichtige Impulse kommen vor allem aus der politischen Ökologie und Bioökonomik, der feministischen Ökonomie, den postkolonialen und Post-Development-Studien sowie der Kapitalismus- und Technikkritik. In den letzten Jahren wurden zudem materialistische, marxistische und imperialismustheoretische Analysen in der Degrowth-Debatte immer wichtiger.
Die Kritik am Wirtschaftswachstum ist fast so alt wie das Phänomen selbst. Eine neue Dimension bekam sie durch die verstärkte Wahrnehmung, dass die Ressourcen auf diesem Planeten endlich sind. So ist die breite gesellschaftliche Diskussion über „Die Grenzen des Wachstums“, die nach dem ersten Bericht an den Club of Rome von 1972 begann, bis heute nicht abgerissen. Die Geburt des Wortes „décroissance“ in seiner heutigen Bedeutung kann ebenfalls auf das Jahr 1972 zurückdatiert werden. Der Sozialphilosoph André Gorz fragte bereits damals: „Ist das Gleichgewicht der Erde, für das Nullwachstum – oder sogar décroissance der materiellen Produktion notwendige Bedingung ist, vereinbar mit dem Überleben des kapitalistischen Systems?“[9] Der wichtigste Impuls im 21. Jahrhundert kam von der Décroissance-Bewegung, die sich seit Anfang der 2000er Jahre von Frankreich aus auf Spanien, Italien, das übrige Europa und darüber hinaus ausgebreitet hat. In den Ursprüngen war diese Bewegung stark in anarchistischen Umweltgruppen und Kampagnen für auto- und werbefreie Städte, gegen industrielle Großinfrastrukturen und für den Aufbau von lokalen Alternativen verwurzelt, hatte aber immer auch eine akademische und internationalistische Ausrichtung auf globale Umweltgerechtigkeit.
Vor dem aktuellen Hintergrund des sich beschleunigenden ökologischen Zusammenbruchs und der häufigen Wirtschaftskrisen hat die Degrowth-Bewegung zuletzt stetig an Boden gewonnen. Sie hat nicht nur einen Aufschwung in der Forschung erlebt, wo inzwischen jährlich Hunderte von Artikeln zu diesem Thema veröffentlicht werden, sondern ist auch zu einem Thema populärer Bücher und häufiger öffentlicher – oft sehr kontroverser – politischer Debatten geworden. Besonders eindrücklicher Ausdruck des zunehmenden Interesses ist das Buch „Das Kapital im Anthropozän“ des japanischen Marxologen Kohei Saito, ein ökosozialistisches Manifest, das, basierend auf Karl Marx, die Notwendigkeit eines Degrowth-Kommunismus begründet und zum absoluten Bestseller wurde: In kurzer Zeit wurden allein in Japan mehr als eine halbe Million Exemplare verkauft, die Thesen in allen Talkshows diskutiert, eine deutsche Übersetzung ist gerade erschienen.[10]
Fünf Felder für eine Degrowth-Agenda
Wie aber könnte eine solche Degrowth-Agenda in der Praxis aussehen? In einem kürzlich in der Zeitschrift „Nature“ erschienenen Artikel werden fünf zentrale Politikbereiche identifiziert, in denen die Länder des Globalen Nordens ihre Emissionen rasch reduzieren und gleichzeitig das soziale Wohlergehen verbessern könnten.[11] Erstens, Abbau derjenigen Wirtschaftssektoren, die nicht rechtzeitig nachhaltig gemacht werden können oder hauptsächlich dem Konsum einer Elite dienen, wie fossile Brennstoffe, Fast Fashion, Werbung und Luftfahrt. Zweitens, die Bereitstellung von „universellen öffentlichen Dienstleistungen“ durch die Regierung, wie „hochwertige Gesundheitsversorgung, Bildung, Wohnraum, Transport, Internet, erneuerbare Energien und nahrhafte Lebensmittel“. Drittens, die Einführung einer Garantie für grüne Arbeitsplätze, die Mobilisierung von Arbeitskräften für den ökologischen Umbau und die Verbesserung der sozialen Sorgetätigkeiten. Viertens, allgemeine Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit, um nicht nur die Produktionsemissionen zu senken und die Beschäftigung zu stabilisieren, sondern auch, um den Menschen mehr frei verfügbare Ressourcen für Zeitwohlstand, politische Partizipation und Formen des alternativen Hedonismus zu geben. Und schließlich die Ermöglichung einer nachhaltigen Entwicklung auf globaler Ebene durch den Erlass der Schulden des Globalen Südens, die Eindämmung des ungleichen Austauschs im internationalen Handel und durch ökologische Reparationen. Würden all diese Maßnahmen in großem Maßstab umgesetzt, würden sie den Energieausstoß und den Ressourcenverbrauch drastisch reduzieren und gleichzeitig das allgemeine Wohlbefinden verbessern.
Für eine starke öffentliche Grundversorgung
Ein wesentlicher Bestandteil der Degrowth-Agenda wäre die Gewährleistung einer universellen Grundversorgung der Bevölkerung. Deutschlands dreimonatiges Experiment mit billigen Bahntickets – nur neun Euro pro Monat für alle öffentlichen Verkehrsmittel im Regional- und Stadtverkehr im Sommer 2022 – könnte als Beispiel dienen. Es hat nicht nur die CO2-Emissionen um schätzungsweise 1,8 Mio. Tonnen CO2 reduziert (das entspricht dem Stromverbrauch von etwa 350 000 Haushalten für ein Jahr), sondern auch dazu beigetragen, die Inflation niedrig zu halten und die Freiheit und Mobilität für alle zu erhöhen. Entsprechend wird das Experiment weithin als politischer und sozialer Erfolg gewertet, wohingegen sein Nachfolger, das 49-Euro-Ticket, für ärmere Haushalte einfach zu teuer ist.[12] Während der Covid-19-Pandemie sorgten mehrere europäische Länder ebenfalls für preiswerte und weithin verfügbare Mobilität, darunter Initiativen für kostenlose öffentliche Verkehrsmittel in der estnischen Hauptstadt Tallinn oder in Malta. In eine ähnliche Richtung zielen Politiken, die bestehende Wohnungsbestände in Genossenschaften umwandeln, wie dies in Österreich und Dänemark geschehen ist und vom deutschen Mietshäuser-Syndikat in kleinem Stil praktiziert wird – einem Netzwerk von Wohnprojekten, die zusammenarbeiten, um Häuser zu kollektivieren und günstige, vom Markt unabhängige Mieten zu ermöglichen.[13] Darüber hinaus können Maßnahmen ergriffen werden, um die Lebensdauer von Produkten zu verlängern und das Recht auf Reparatur zu institutionalisieren, wie es die EU derzeit in Erwägung zieht, um so der „geplanten Obsoleszenz“ entgegenzuwirken, also der Praxis von Unternehmen, die Lebensdauer eines Produkts planmäßig einzuschränken, um die Verbraucher:innen zur Neuanschaffung zu bewegen.
In einem kürzlich erschienenen Bericht der Bertelsmann Stiftung über die deutsche Sozial- und Klimapolitik wird zudem die Einführung einer Klimakreditkarte vorgeschlagen, um die potenziellen inflationären Auswirkungen der grünen Energiewende in Deutschland abzufedern. Verbraucher, die ein bestimmtes Einkommensniveau nicht überschreiten, hätten demnach freien Zugang zu 1000 Kilowattstunden Strom pro Jahr und Person sowie zu öffentlichen Verkehrsmitteln im Wert von 5000 Kilometern, 220 Kilogramm regionalem Obst und Gemüse sowie 20 000 Litern Wasser, um nur einige wichtige Güter und Dienstleistungen zu nennen.[14]
Öffentlicher Luxus statt Konsumverzicht
Andere Degrowth-Politiken konzentrieren sich auf die Reduzierung des übermäßigen Konsums der Reichen durch stark progressive Einkommens- und Vermögenssteuern, Finanztransaktionssteuern, Steuern auf Luxuskonsum und sogar maximale Einkommensquoten. Dies basiert auf der Analyse, dass die ökologische Krise eine Klassenkrise ist, die mit anderen Ungleichheitsdimensionen wie vor allem dem Lebensort, der Nationalität, mit Rassismus und Sexismus verschränkt ist. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache – drei kurze Beispiele aus neueren Studien: 2021 waren die oberen zehn Prozent der Weltbevölkerung verantwortlich für fast die Hälfte aller energiebezogenen CO2-Emissionen, die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung nur für 0,2 Prozent. Über den gesamten Zeitraum 1990 bis 2019 – also die entscheidenden Jahrzehnte, in denen die Folgen des Verbrennens fossiler Ressourcen bekannt waren und ein großer Teil der Klimakatastrophe verursacht wurde – emittierte das reichste eine Prozent 1,5-mal so viel Treibhausgase wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Und angesichts der aktuellen Trends werden allein die Emissionen der weltweiten Millionäre mehr als 70 Prozent des gesamten Emissionsbudgets aufbrauchen, das verbleibt, um das 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten. Daher zielt die Degrowth-Bewegung darauf ab, Luxuskonsum und, damit zusammenhängend, gesellschaftliche Ungleichheit und Machtunterschiede zu politisieren, wie das durch Blockaden von Privatjet-Terminals durch das Netzwerk Scientist Rebellion und andere Gruppen bereits geschieht. Kurz nach solchen Blockaden gab jüngst einer der größten Flughäfen Europas, Amsterdam Schiphol, bekannt, Privatflüge zu verbieten. Bei solchen Aktionen geht es nicht nur um die Kritik an der Kohlenstoffungleichheit, sondern auch um das Infragestellen gesellschaftlicher Sehnsüchte, die mit der imperialen Lebensweise verknüpft sind.
Eine ökologische Klassenpolitik im Kapitalozän
Während die Produktions- und Lebensweise von relativ kleinen, aus einer globalen Perspektive sehr privilegierten Teilen der Weltbevölkerung die Klimakrise maßgeblich verursacht, sind die Folgen im Globalen Süden schon jetzt katastrophal: Flutkatastrophen, Dürren, Brände, Hunger. Vom fossilen Wirtschaftswachstum, das diese Krisen produziert, profitieren dabei nur wenige. Der World Inequality Report zeigt, dass das reichste Prozent der Weltbevölkerung insgesamt 38 Prozent des gesamten Vermögenswachstums zwischen 1995 und 2021 akkumulierte, verglichen mit nur zwei Prozent für die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung.[15] Degrowth formuliert angesichts dessen transformative Politiken, die diese Ungerechtigkeiten angehen, kurzum: eine ökologische Klassenpolitik im Kapitalozän. Auch wenn Degrowth vielfach als Forderung nach wirtschaftlicher Rezession, Austerität und Konsumverzicht missverstanden wird, geht es in der internationalen Diskussion um makroökonomische Politiken, die zwar privaten Reichtum und Überproduktion begrenzen, aber gleichzeitig Zugang zu den für ein gutes Leben notwendigen Infrastrukturen für alle schaffen – es geht also um nicht weniger als die Vermehrung des öffentlichen Luxus.
Im Wesentlichen zielt Degrowth auf eine Gesellschaft, in der das Wohlergehen nicht durch den Markt und den materiellen Konsum vermittelt wird, sondern durch kollektive Formen der Versorgung mit physischen und sozialen Gütern – und in der der Schwerpunkt auf Gebrauchswerten und gelingenden Beziehungen statt auf Wettbewerb und Tauschwerten liegt. Immer mehr Studien zeigen, dass dies nicht nur möglich ist, sondern auch durch Umverteilung und öffentliche Gelder finanziert werden kann. Dafür allerdings müsste das Geld- und Finanzsystem so umstrukturiert werden, dass die Gesellschaft nicht mehr davon abhängig ist, dass privates Kapital in das Gemeinwohl investiert wird.[16] Sicherlich würde das Leben dann ganz anders aussehen. Viele Menschen würden wahrscheinlich weniger materielle Gegenstände besitzen. Aber die meisten hätten Zugang zu besseren Dienstleistungen und die Gesellschaft als Ganzes wäre nachhaltiger, gerechter und erfüllender. Auch wenn manche Degrowth als utopisches Projekt abtun mögen, gibt es angesichts der sich beschleunigenden Klimakatastrophe kaum alternative Möglichkeiten, die Emissionen in dem erforderlichen Tempo zu stoppen. Die Zeit läuft ab, und Degrowth bietet dagegen Prinzipien und Politikansätze für eine gerechtere und wirklich nachhaltige Zukunft für alle.
[1] AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023, www.ipcc.ch, 20.3.2023.
[2] European Environment Agency, Is Europe reducing its greenhouse gas emissions?, www.eea.europa.eu, 22.6.2022.
[3] Sachverständigenrat für Umweltfragen, Wie viel CO2 darf Deutschland maximal noch ausstoßen? Fragen und Antworten zum CO2-Budget, www.umweltrat.de, Juni 2022.
[4] Kevin Anderson, IPCC’s conservative nature masks true scale of action needed to avert catastrophic climate change, www.theconversation.com, 24.3.2023.
[5] Ulrike Herrmann, Raus aus der Wachstumsfalle. Wie wir mit der britischen Kriegswirtschaft die Klimakrise bewältigen können, in: „Blätter“, 10/2022, S. 57-66.
[6] Vgl. Helmut Haberl, Dominik Wiedenhofer, Doris Virág u.a., A Systematic Review of the Evidence on Decoupling of GDP, Resource Use and GHG Emissions, Part II: Synthesizing the Insights, in: „Environmental Research Letters“, 6/2020; Jason Hickel und Giorgos Kallis, Is Green Growth Possible?, in: „New Political Economy“, 4/2020, S. 469–486; Thomas Wiedmann, Manfred Lenzen, Lorenz T. Keyßer und Julia K. Steinberger, Scientists’ Warning on Affluence, in: „Nature Communications“, 1/2020.
[7] Ulrich Brand und Markus Wissen, Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und Natur in Zeiten des globalen Kapitalismus, München 2017.
[8] Vgl. Giacoma D’Alisa, Federico Demaria und Giorgios Kallis (Hg.), Degrowth. Handbuch für eine neue Ära, München 2016; Matthias Schmelzer, Andrea Vetter und Aaron Vansintjan, The Future is Degrowth. A Guide to a World Beyond Capitalism, London 2022.
[9] Zit. nach D’Alisa u. a. (Hg.), Degrowth, a.a.O., S. 17.
[10] Kohei Saito, Systemsturz. Der Sieg der Natur über den Kapitalismus, München 2023.
[11] Jason Hickel, Giorgos Kallis, Tim Jackson u.a., Degrowth Can Work — Here’s How Science Can Help, www.nature.com, 12.12.2022.
[12] Vgl. Stefan Nicola und Josefine Fokuhl, Germany’s Ultra-Cheap Train Ticket Saved 1,8 Million Tons of CO2, bloomberg.com, 30.8.2022; Inken Behrmann und Valentin Ihßen, Deutschlandticket: Verkehrswende retour, in: „Blätter“, 4/2023, S. 17-20.
[14] Vgl. Miriam Rehm, Vera Huwe und Katharina Bohnenberger, Klimasoziale Transformation – Klimaschutz und Ungleichheitsreduktion wirken Hand in Hand, www.bertelsmann-stiftung.de, 7.2.2023.
[15] Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez und Gabriel Zucman, World Inequality Report 2022, https://wir2022.wid.world.
[16] Joel Millward-Hopkins, Julia K. Steinberger, Narasimha D. Rao u.a., Providing Decent Living with Minimum Energy: A Global Scenario, in: „Global Environmental Change“, 6/2020; Jason Hickel, Giorgos Kallis, Tim Jackson u.a., Degrowth Can Work, a.a.O.; Stephanie Kelton, The Deficit Myth. Modern Monetary Theory and the Birth of the People’s Economy, New York 2020.