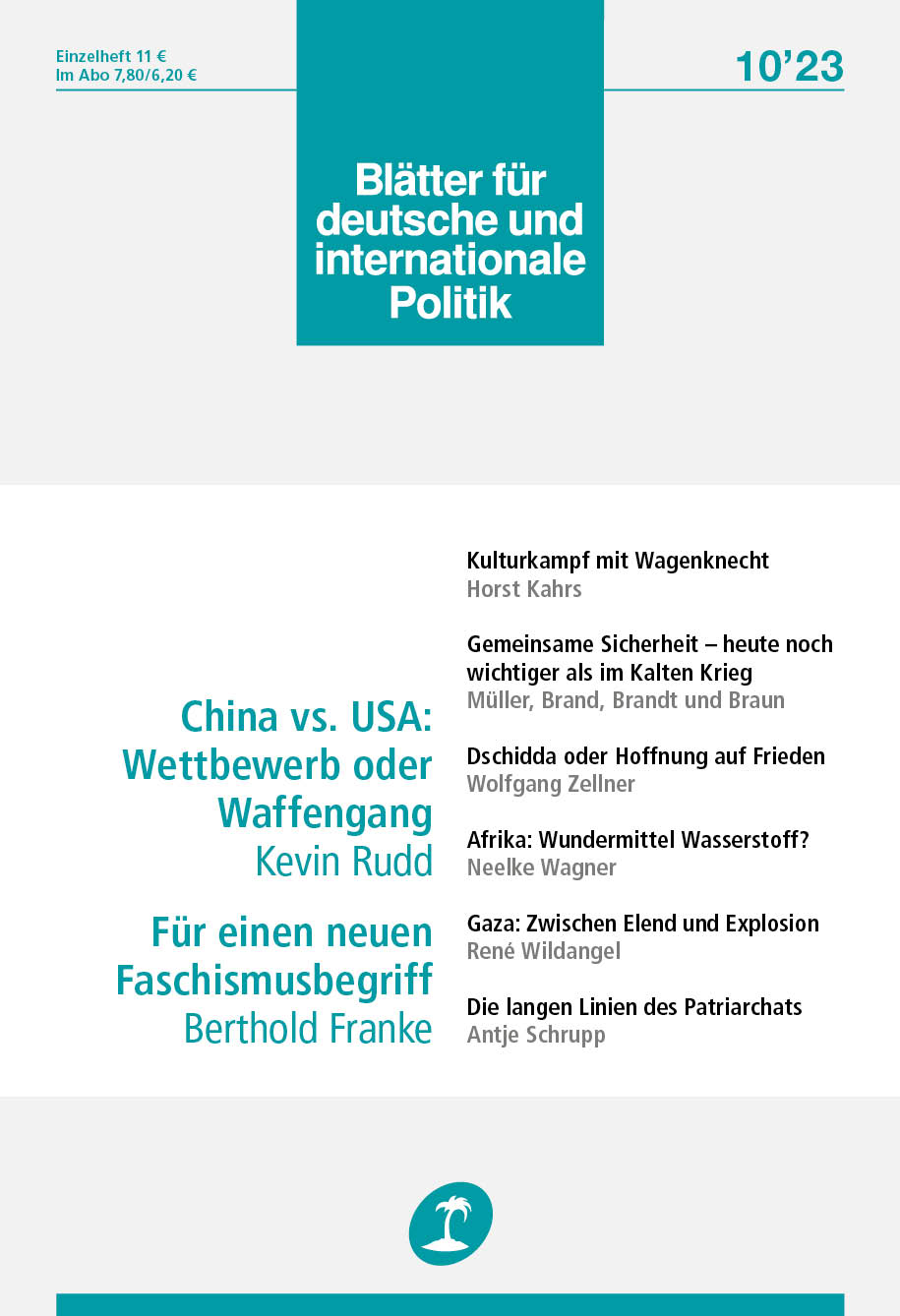Bild: Christian Lindner und Lisa Paus während der Pressekonferenz zur Einigung bei der Kindergrundsicherung in Berlin, 28.8.2023 (IMAGO / photothek / Florian Gaertner)
Am Ende gab es doch noch eine Einigung: Im Streit um die Höhe der benötigten Gelder für die geplante Kindergrundsicherung stimmte Familienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) schließlich den mageren 2,4 Mrd. Euro für das kommende Jahr zu. Ursprünglich war von bis zu zwölf Mrd. Euro die Rede, die nötig wären, um Kindern ein armutsfreies Aufwachsen zu ermöglichen. Folglich bleibt auch nach dem Kompromiss im Zuge der Haushaltsberatungen eine ganze Reihe an Fragen offen.
Bisher gibt es für Familien unzählige Leistungen, deren Zugänge sehr unterschiedlich geregelt sind. Die drei wichtigsten sind: Erstens das Kindergeld, das Anfang dieses Jahres auf 250 Euro erhöht wurde und das allen Kindern automatisch zufließt. Allerdings wird es einerseits mit Bürgergeldbezügen verrechnet, weshalb arme Kinder davon gar nicht profitieren, und es liegt andererseits unter der maximalen Steuerersparnis, die Eltern mit hohen Einkommen über die Kinderfreibeträge geltend machen können – maximal 370 Euro je Monat. Diese erfahren dadurch eine höhere Zuwendung für ihre Kinder als arme und durchschnittlich verdienende Familien. Zweitens können Eltern mit geringem Einkommen einen Kinderzuschlag von bis zu 250 Euro je Kind beantragen. Diesen Kinderzuschlag, der in der Kindergrundsicherung aufgehen soll, erhalten jedoch nur rund 30 Prozent der eigentlich leistungsberechtigten Familien, weil er zu unbekannt ist und eigeninitiativ beantragt werden muss. Schließlich erhalten Eltern im Bürgergeldbezug für ihre Kinder drittens aktuell 318 bis 429 Euro, je nach Alter der Kinder. Hinzu kommen noch weitere Leistungen für Familien wie der Unterhaltsvorschuss, das Bildungs- und Teilhabepaket oder Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Armut als prägende Erfahrung
Dem aktuellen System liegt also eine doppelte Unwucht zugrunde, weil Kinder aus Familien mit einem höheren Einkommen in zweifacher Hinsicht privilegiert sind: Einerseits bei der Höhe der Leistungsgewährung, da die finanziellen Entlastungen im Rahmen des Kinderfreibetrages über dem Kindergeld liegen. Andererseits beim Leistungszugang, denn Kindergeld und Kinderfreibetrag fließen automatisch, während andere Leistungen beantragt werden müssen. Zudem ist die Bemessung des kindlichen Existenzminimums in sich inkonsistent, da das steuerliche Existenzminimum deutlich über dem sozialrechtlich definierten Existenzminimum liegt.
Diese ungleiche und unübersichtliche Struktur der Höhe und des Zugangs zu sozialen Leistungen ist eine der Ursachen dafür, dass Kinderarmut in Deutschland ein sehr präsentes und strukturell verfestigtes Phänomen ist. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung wächst mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut auf. Das sind hochgerechnet 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Zwei Drittel der von Armut betroffenen Kinder leben mindestens fünf Jahre durchgehend oder wiederkehrend in Armut – für sie ist Armut eine prägende, oft dominierende Phase in ihrer Kindheit.
Die Bertelsmann Stiftung definiert Kinder als arm, die in Haushalten mit weniger als 60 Prozent des gewichteten Durchschnittseinkommens leben müssen. So wird Armut in Relation zur gesamtgesellschaftlichen Einkommensverteilung definiert und an das gesamtgesellschaftliche Wohlstandsniveau gekoppelt. Kritiker:innen monieren, dass dadurch mit dem Anstieg des Durchschnittseinkommens automatisch auch die Armutsquote steige. Doch in der wissenschaftlichen Diskussion hat sich diese relative Armutsdefinition durchgesetzt, weil sie den wichtigen Aspekt der gesellschaftlichen Teilhabe berücksichtigt: Deren Möglichkeiten und Grenzen werden eben nicht nur durch die eigenen materiellen Verhältnisse, sondern auch durch die der anderen Mitglieder der Gesellschaft bestimmt.
Von Teilhabe ausgeschlossen
Tatsächlich sind Kinder, die in (relativ) armen Haushalten aufwachsen, in vielen Bereichen von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen: Von Armut betroffene Kinder sind beispielsweise häufig schlechter in der Schule und weniger gesund, was mit langfristigen sozialen Risiken einhergeht. Sie haben oft holprige Bildungsverläufe und müssen häufiger eine Klasse wiederholen. Zudem schämen sich viele arme Kinder, Freunde nach Hause einzuladen, und können an Aktivitäten, die Geld kosten, nicht teilnehmen. Kinderarmut bestimmt nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft der Betroffenen. Der Anteil der Kinder, die in Haushalten mit weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens leben, liegt dabei deutlich über dem der Kinder in Bedarfsgemeinschaften. Deshalb ist die Fokussierung auf Kinder in Bedarfsgemeinschaften fatal, denn damit wird das Ausmaß der Problematik massiv unterschätzt.
Mit der Kindergrundsicherung wollte man nicht zuletzt auch jene Kinder erreichen, deren Eltern wenig verdienen, die aber die ihnen zustehenden Leistungen nicht abrufen. Die ursprüngliche Idee sah also vor, alle Leistungen, auch – oder wenigstens teilweise – den Kinderfreibetrag, zu bündeln. Dieser sollte in Form eines Garantiebetrages für alle Kinder ausgezahlt werden, zuzüglich eines einkommensabhängigen Zusatzbetrages für Kinder, die in Familien mit geringem Einkommen aufwachsen. In der Summe sollten Garantiebetrag und Zusatzbetrag das soziokulturelle Existenzminimum von Kindern gewährleisten. Ziel war nicht nur, Kinderarmut deutlich zu reduzieren, sondern auch, die Ungleichbehandlung zwischen Kindern von Eltern mit hohem Einkommen und solchen von Eltern mit niedrigem und mittlerem Einkommen abzuschaffen.[1]
Der vorliegende Kompromiss weicht davon allerdings in mehrfacher Hinsicht ab: Zum einen, weil nur ein Teil der Leistungen, die Kindern zugutekommen, zu einer Kindergrundsicherung zusammengefasst werden soll. Der Kinderfreibetrag beispielsweise bleibt von den aktuellen Plänen unberührt – und damit auch die systematische Privilegierung von Kindern aus ohnehin schon bessergestellten Familien. Auch Kinder, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, sollen von den Leistungen der Kindergrundsicherung ausgeschlossen bleiben.
Zum anderen orientiert sich die maximale Höhe der auszuzahlenden Leistungen an der Höhe des Bürgergeldes, welche zumindest nach Einschätzung der meisten Wissenschaftler:innen deutlich zu niedrig angesetzt ist. Viele Expert:innen kritisieren, dass der tatsächliche finanzielle Bedarf von Menschen bei der Berechnung des Bürgergelds systematisch unterschätzt wird – das galt schon vor den seit zwei Jahren massiv gestiegenen Lebenshaltungskosten, denen Einkommensschwache derzeit besonders ausgeliefert sind. Die Berechnung orientiert sich an den 20 Prozent der ärmsten Haushalte nach der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). Zudem werden viele Ausgabenpositionen aus dem Regelsatz herausgerechnet, wie etwa Ausgaben für Haustiere oder Eis aus der Eisdiele. Es ist daher begrüßenswert, dass das soziokulturelle Existenzminimum neu berechnet werden soll.
Inwieweit die Kindergrundsicherung ein wirksames Instrument gegen Kinderarmut wird, hängt entscheidend davon ab, auf welcher Höhe das soziokulturelle Existenzminimum künftig festgelegt wird und wie viele Kinder am Ende tatsächlich Zugang zu dem dadurch definierten Zusatzbetrag haben werden. Klar ist, dass die Kosten einer Kindergrundsicherung, die allen Kindern ein tatsächliches soziokulturelles Existenzminimum garantiert, um ein Vielfaches über den aktuell beschlossenen 2,4 Mrd. Euro liegen würden.
Hürden, Ausschluss, marode Bildung
Aufschlussreich ist jedoch nicht nur der gefundene Kompromiss, der sich vor allem dadurch auszeichnet, dass er viele zentrale Weichenstellungen und Konflikte in die Zukunft verlagert, sondern auch die zuvor geführte mediale und politische Debatte, die grundlegende Fragen über den Umgang mit Armut in einem eigentlich reichen Land aufwirft. So offenbart die Auseinandersetzung über die Definition von Armut (fokussiert man sich auf Kinder und Familien in Bedarfsgemeinschaften oder nur auf Kinder in Familien mit weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens) sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie inklusiv eine Gesellschaft gedacht wird. Es geht um die grundlegend normative Frage, welcher Solidaritätsbegriff sozialpolitischen Instrumenten zugrunde liegen soll: Soll der Sozialstaat allen seinen Mitgliedern gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen oder reicht es, grundlegende Bedürfnisse zu befriedigen? Wer gehört zur Solidargemeinschaft und wer nicht? Wenn Christian Lindner darauf verweist, dass ein Großteil der Kinder in Bedarfsgemeinschaften Kinder von Geflüchteten seien, formuliert er ein eher exkludierendes Solidaritätsverständnis. Ob nun bewusst oder unbewusst, war dieser Hinweis darüber hinaus eine Anrufung rassistischer Ressentiments.
Tatsächlich sind viele Geflüchtete auf Transferleistungen angewiesen und brauchen Unterstützung bei der Arbeitsmarktintegration – und vor allem endlich eine rasche, unbürokratische Anerkennung ihrer Qualifikationen. Denn nicht zuletzt der vom Fachkräftemangel geplagte deutsche Arbeitsmarkt ist darauf angewiesen, hier Hürden abzubauen. Allerdings lässt die von der Bundesregierung im Haushalt 2024 geplante Kürzung von Integrationsprogrammen um immerhin fast ein Drittel daran zweifeln, dass es den Protagonist:innen tatsächlich um Arbeitsmarktintegration geht.
Immer wieder wird in der Debatte um Kinderarmut gefordert, statt höherer Zuwendungen an die Familien vielmehr sicherzustellen, dass die Kinder frühzeitig Bildungseinrichtungen besuchen – insbesondere, wenn es um Geflüchtete und Zugewanderte geht. Zweifellos ist das deutsche Bildungssystem ausnehmend schlecht darin, Chancengleichheit für Kinder aus einkommensarmen Familien (viele davon haben einen Migrationshintergrund) zu schaffen. So belegen die IGLU-Studien regelmäßig, dass Kinder aus den unteren sozialen Schichten bessere Leistungen erbringen müssen, um eine Gymnasialempfehlung zu bekommen, als Kinder aus höheren sozialen Schichten. Hier wären strukturelle Reformen und eine deutlich bessere finanzielle und personelle Ausstattung des Systems notwendig.
Dafür jedoch fehlen nach wie vor konkrete Vorschläge – aktuell mangelt es bundesweit an fast 400 000 Kitaplätzen, und auch von einer Ganztagsbetreuung an den Grundschulen sind wir vielerorts meilenweit entfernt. Hinzu kommt: Die dringend nötigen Investitionen wirken erst langfristig und würden allenfalls einen Beitrag zur Verhinderung kommender Kinderarmut leisten. 2,8 Millionen Kinder sind jedoch jetzt arm. Ihre vermutlich ohnehin oft von Brüchen und Traumata geprägte Kindheit findet jetzt statt und sie brauchen jetzt Geld. Für alle Familien, unabhängig von der Herkunft, gilt: Die Bekämpfung von Kinderarmut lässt sich am effektivsten mit höherer finanzieller Zuwendung erreichen.[2]
Alleingelassen: Alleinerziehende
Kinderarmut ist ein strukturell verfestigtes Phänomen und auf verschiedene Risikolagen zurückzuführen. Eine davon ist, bei einem alleinerziehenden Elternteil aufzuwachsen. Doch anstatt diese Gruppe endlich angemessen zu unterstützen, wurde nun beschlossen, direkte Transferzahlungen an Erwerbsanreize zu knüpfen. Allerdings wird gerade bei der Gruppe der Alleinerziehenden deutlich, dass Erwerbsarbeit nicht automatisch vor Armut schützt: Die Erwerbsquote alleinerziehender Mütter, die den übergroßen Anteil der Alleinerziehenden stellen, ist bereits jetzt deutlich höher als jener Mütter, die mit dem anderen Elternteil zusammenleben – und trotzdem ist ihr Armutsrisiko größer. Es braucht eben nicht nur Zugang zu irgendeiner Erwerbsarbeit, sondern zu gut bezahlter Erwerbsarbeit, die sich zugleich mit der Sorgearbeit vereinbaren lässt.
Dennoch setzt FDP-Finanzminister Christian Lindner ausgerechnet bei Alleinerziehenden auf Erwerbsanreize – sie sollen den Unterhaltsvorschuss für über Sechsjährige künftig nur noch bei einer Erwerbstätigkeit mit mindestens 600 Euro Einkommen erhalten. Damit sollen Anreize geschaffen werden, „sich weiterhin um Arbeit zu bemühen“. Dies betrifft in der übergroßen Mehrheit Frauen, deren ehemalige Partner sich weigern, ihren Kindern den ihnen zustehenden Unterhalt zu zahlen – diese Familien sind nun verstärkt von Armut bedroht.
Und selbst ohne Erwerbsarbeit arbeiten Alleinerziehende rund um die Uhr: Sie versorgen Kinder – und das meist ohne nennenswerte Unterstützung. Lindners sprachliche Ungenauigkeit ist kein Zufall, sondern folgt einer Logik, die schon in der Pandemie sichtbar wurde: Unbezahlte Sorgearbeit, die ganz überwiegend Frauen leisten, wird unsichtbar gemacht – sie gilt schlicht nicht als Arbeit. Sie findet keine gesellschaftliche Anerkennung, sondern wird selbstverständlich erwartet.
Studien des WSI belegen die unglaubliche Erschöpfung von Müttern während und im Nachgang der Pandemie.[3] Aus dieser Erschöpfung und dem Gefühl, alleingelassen zu werden, speist sich ein grundlegender Vertrauensverlust gegenüber der Politik. Wenn der Kanzler von Respekt spricht, den diese Bundesregierung Menschen entgegenbringen will, fühlen sich diese Frauen sicher nicht mitgemeint. Und die Diskussion um die Kindergrundsicherung ist ebenso wie der gefundene Haushaltskompromiss der Ampel nicht dazu angetan, sie vom Gegenteil zu überzeugen.
[1] Weil es juristisch umstritten ist, ob der steuerliche Kinderfreibetrag abgesenkt werden kann, um eine Umverteilung von oben nach unten zu gewährleisten, gibt es alternativ den Vorschlag, den Garantiebetrag auf die maximale Höhe des Kinderfreibetrages anzuheben.
[2] Heike Solga, Bildung und materielle Ungleichheiten. Der investive Sozialstaat auf dem Prüfstand, in: Rolf Becker und Heike Solga (Hg.), Soziologische Bildungsforschung, Sonderheft der „Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie“, 2012, S. 459-487.
[3] Andreas Hövermann und Bettina Kohlrausch, Der Vertrauensverlust der Mütter in der Pandemie, „WSI Report 73“, März 2022.