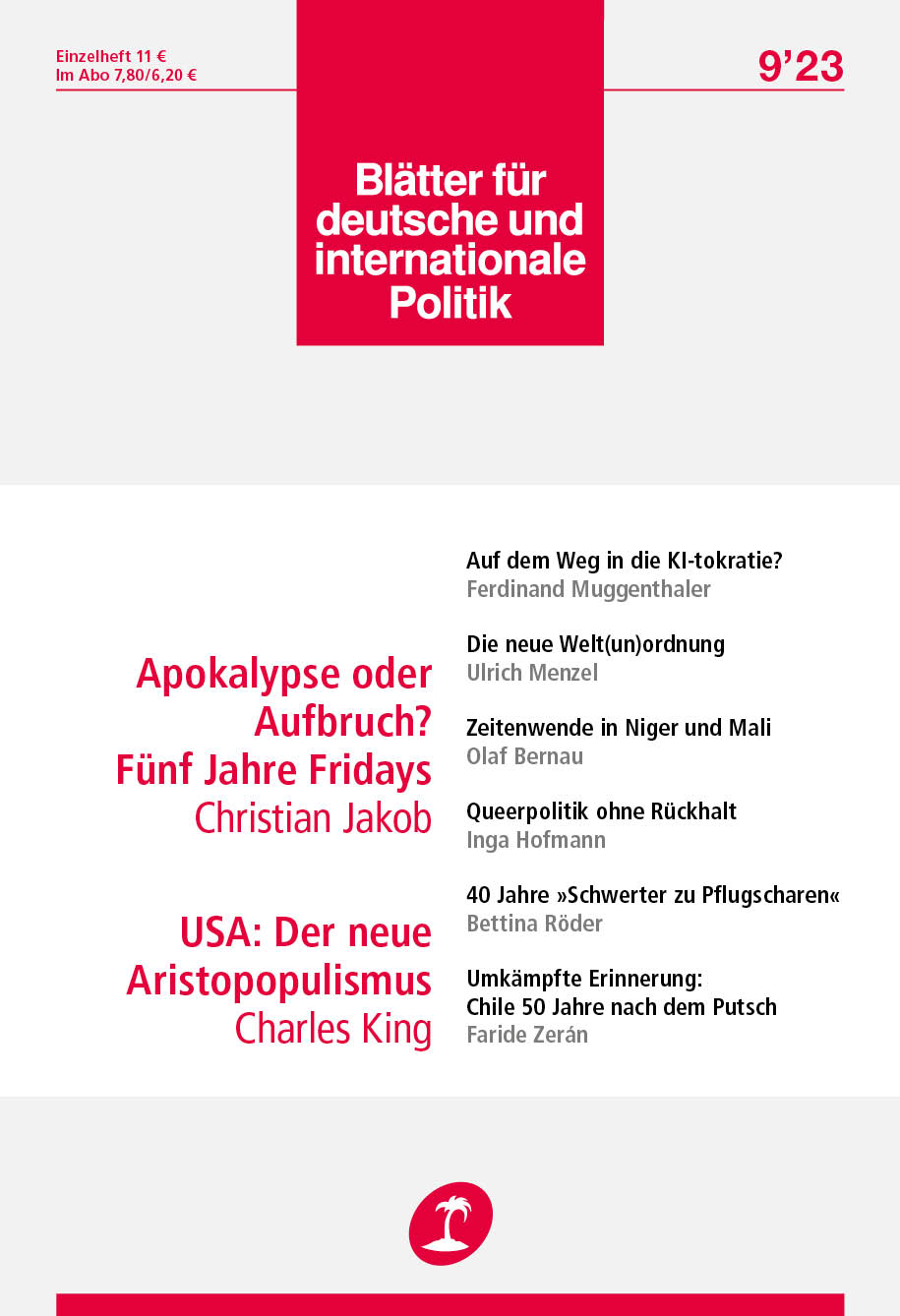Chile 50 Jahre nach dem Putsch gegen Allende

Bild: Menschen erinnern an die 119 Menschen, die im Rahmen der »Operation Colombo« während der Militärdiktatur in Chile (1975) verschwunden sind, Santiago de Chile, 22.7.2023 (IMAGO / Claudio Abarca Sandoval)
Was ist aus Margarita Paillal geworden, der Mapuche[1]-Bäuerin aus Cautín, deren Foto die Titelseite der Zeitschrift „Chile Hoy“ zierte, die am 11. September 1973 an den Zeitungskiosken hing? Paillal war 30 Jahre alt und Mutter von sieben Kindern. Zusammen mit zwei anderen Mapuche-Anführern war sie in die Hauptstadt Santiago de Chile gereist, um bei Präsident Salvador Allende die Verhaftung und Folterung von Bauern in der Gegend von Temuco anzuprangern. Angeführt wurde die Strafaktion gegen die politisch aktiven Gemeinden von Oberst Pablo Iturriaga und dem Kommandeur der Luftwaffe Rigoberto Pacheco. Mit einer Gruppe Soldaten hielten sie Ende August 1973 in der Provinz Cautín im Süden Chiles vier Tage lang das ehemalige Herrenhaus einer Finca besetzt, auf der im Zuge der Agrarreform die Agrarkooperative „Jorge Fernández“[2] entstanden war. Sie rechtfertigten ihren Einsatz durch das sogenannte Waffenkontrollgesetz.
Ich war 23 Jahre alt, hatte Paillal eine Woche zuvor interviewt und war von ihrem Mut und ihrer Klarheit beeindruckt. Was wird aus ihr werden, fragte ich mich an jenem Morgen des 11. September 1973 auf meinem Weg durch das Stadtzentrum Santiagos in die Redaktion von „Chile Hoy“, für die ich arbeitete. Dabei blickte mich die 30jährige an jeder Ecke, an der es einen Kiosk gab, mit traurigem und trotzigem Blick an, als würde sie mich nach dem Satz fragen, mit dem ich das Interview überschrieben hatte: „Wir sind wütender denn je.“ Ein Satz, der sich im Laufe des Tages als das Militär vorrückte, nach der Rede Allendes und der Bombardierung des Präsidentenpalastes „La Moneda“, als Provokation entpuppte, die Paillal der brutalen Repression der Putschisten auslieferte.
Margarita Paillal hatte diese tausend Tage der Regierung Allende intensiv und engagiert gelebt; sie hatte ihre Kinder großgezogen, sie war eine Bauernanführerin geworden, und wie so viele glaubte sie, den Himmel mit ihrer Hand berührt zu haben. Ich suche nach der Akte mit ihrem Interview und zitiere sie: „Ich bin in der Leitung eines Comando Comunal und weil ich kämpferisch bin, streite ich mich mit den Genossen. Ich verlange und befehle, dass die Frauen das gleiche Recht haben zu arbeiten – an der Seite ihrer Männer – und das gleiche Recht zu streiten und zu kämpfen. Denn wir Frauen sind es, die am meisten unter der Armut leiden, die die Bedürfnisse kennen und die für unsere Kinder sorgen müssen.“[3]
Diese Mapuche-Anführerin und tausende Arbeiter, Bauern und Pobladores[4], waren in jenen drei Jahren der Regierung Allende die Protagonisten. Sie drängten auf Veränderungen, die manchmal über das hinausgingen, was von den politischen Parteien und Führern der „Unidad Popular“[5] angestrebt wurde. Ihre Gesichter sehen den Gesichtern derjenigen zum Verwechseln ähnlich, die heute, ein halbes Jahrhundert später, eine andere Zukunft fordern. Eine andere Zukunft als sie das neoliberale Drehbuch nach Jahrzehnten von Regierungen, die das Land unter der Verfassung und dem Wirtschaftsmodell des Pinochetismus verwalteten, für sie vorsah. Zu diesen Gesichtern gehören vielleicht die der Enkelkinder von Paillal.
Was machte ich am 11. September 1973?[6] Es heißt, dass es an diesem Tag bewölkt war, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den Himmel geschaut habe, bis ich auf das Dach des Gebäudes kletterte, in dem sich ein Teil der Belegschaft der Zeitschrift „Chile Hoy“ versteckt hielt, gerade als La Moneda bombardiert wurde. Als in den frühen Morgenstunden das Telefon klingelte und der Journalist Horacio Marotta, Leiter der Nachrichtensendung von „Chile Films“, mir von den Meldungen über Truppenbewegungen erzählte und mich warnte, sprang ich aus dem Bett und weinte in der Gewissheit, dass sich eine Tragödie anbahnte. Die improvisierte Botschaft von Präsident Allende, die ich später hörte, zerstreute alle Zweifel. Ich erinnere mich, dass ich zu „Radio Nacional“ gehen wollte, wo ich ebenfalls als Journalistin arbeitete. Die Redaktion des Radios befand sich mitten im Zentrum von Santiago, aber ich sah fremde Menschen aus dem Gebäude kommen und ging weiter.
Nur mein Instinkt leitete mich durch die Straßen voller Menschen, die aus dem Regierungsviertel flüchteten. Gepanzerte Fahrzeuge, Militärlastwagen, Panzer, eine ganze Höllenmaschinerie bewegte sich in Richtung der Morandé,[7] während in den Bäckereien die Menschen Schlange standen und verlangten, bedient zu werden, damit sie nach Hause gehen konnten. Es war der Morgen, an dem ich am meisten in meinem Leben gelaufen bin. Der längste Morgen meines Lebens.
Ich ging zum Bustamante-Park, zur Wohnung von Marta Harnecker, der Leiterin von „Chile Hoy“, und gemeinsam gingen wir zum Sitz der Zeitschrift in der Avenida Italia, wo ein Team von Redakteuren auf uns wartete. Nachdem wir Akten und Tonbänder herausgenommen hatten, gingen wir mit der Gruppe von Journalisten zu einem sicheren Haus in der Straße Villavicencio. Es handelte sich um eine Wohnung im obersten Stockwerk eines kleinen Gebäudes.
Marta war von einem der Putschgeneräle, Gustavo Leigh, im ersten Kommuniqué der Junta denunziert worden, und einige der anwesenden Journalisten gehörten zur Belegschaft der uruguayischen Zeitschrift „Marcha“, die vom Militärregime in ihrem Land geschlossen worden war.
Die Wohnung als „sicheren Ort” zu bezeichnen, war ein Witz. So sehr, dass ihr eigentlicher Bewohner, ebenfalls ein Journalist und Linker, anderswo Zuflucht gesucht hatte. Er besaß eine der umfangreichsten marxistischen Bibliotheken seiner Zeit, und die Wände seiner kleinen Wohnung waren mit großen Ikonographien bedeckt, die das grimmige, unerschrockene Gesicht von Marx zeigten. Eine andere Gruppe von Journalisten und Intellektuellen, die in der Wohnung unter uns Zuflucht gesucht hatte, kam mitten in der Ausgangssperre nach oben, um mit uns Informationen auszutauschen.
Als im Oktober 2019 die Massenproteste ausbrachen, wunderten sich viele, dass sie nicht gemerkt hatten, dass Chile zu einem Dampfkochtopf geworden war, in dem alle Geschichten über die angeblichen Wohltaten des chilenischen neoliberalen Modells explodierten. Sie hatten das Ausmaß der Mobilisierungen nicht wahrgenommen, die dieser sozialen Revolte vorausgingen: die Proteste der Schüler im Jahr 2006, genannt „Marsch der Pinguine“. Die Rebellion der Studenten 2011. Der feministische Mai 2018 mit seiner Forderung nach einem kulturellen Wandel. Sie hatten auch die massiven Kundgebungen zum Internationalen Frauentag oder die sozialen Aufstände in Orten wie Freirina, Aysén, Chiloé und anderen Teilen des Landes nicht beachtet.
Von einigen Ausnahmen abgesehen, entwarfen die Medien in diesen Jahrzehnten nach der Diktatur nicht nur das Bild eines bedingungslos akzeptierten und erfolgreichen sozioökonomischen Modells, sondern auch das einer homogenen, unkritischen Gesellschaft, in der es keine Debatten gab und aus der nur einzelne abweichende Figuren herausstachen: die Figur des Armen, des Marginalisierten aus dem einfachen Volk, die im Allgemeinen mit der Figur des Kleinkriminellen gleichgesetzt wurde. Die Figur des Künstlers, die auf den Bereich des Spektakels reduziert wurde. Und die des Intellektuellen, die als anstrengend wahrgenommen wurde, und dessen Beiträge selten auftauchten, solange sie nicht trivialisiert werden konnten.
Dieses Bild von einem weißen Land ohne Herkunft und Gedächtnis, das von Chile gemalt wurde, symbolisiert in dem Eisberg, mit dem sich Chile auf der Expo in Sevilla 1992 vorstellte, und das der Soziologe Manuel Antonio Garretón in seinem Essay „Der unsichtbare Teil des Eisbergs“[8] so treffend beschrieben hat, war keine zufällige Konstruktion. Die Medien, der offizielle Diskurs, der verordnete Konsens zu Beginn des Übergangs zur Demokratie verschoben so nicht nur die notwendige Debatte über unsere Unterschiede, die typisch sind für ein Land, das durch Schmerz und Schrecken zersplittert ist und einen wesentlichen Teil seines Wesens verleugnet, den mestizischen[9], pluralen, vielfältigen Teil mit eigenem kulturellen Erbe und Gedächtnis. Aufgeschoben wurde auch die Möglichkeit, die Vergangenheit moralisch zu beurteilen, damit das „Nie wieder“ in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen nicht nur ein Slogan, sondern ein Vermächtnis für künftige Generationen werden kann.
Verordneter Konsens und simulierte Homogenität
Die 1990er Jahre bestätigten, dass der Eisberg eine Metapher für die Simulation einer homogenen Gesellschaft war. Die unabhängige Presse, die in der Lage war, über die reichhaltigen Konflikte und Debatten in unserer Gesellschaft zu berichten, verschwand allmählich, während die Konzentration der Printmedien durch zwei große Konglomerate, El Mercurio und Copesa, Gestalt annahm. Das sei eine Frage des Marktes, wurde uns aus dem Präsidentenpalast gesagt.
Die Agenda der politischen, wirtschaftlichen und militärischen Macht spiegelte ein konservatives, zensiertes Land wider, das Angst vor der Freiheit hat. Scheidung, Abtreibung, sexuelle Vielfalt, indigene Völker, die Verletzung der Menschenrechte, um nur einige Themen zu nennen, wurden aus der öffentlichen Debatte verdrängt, während die öffentliche Sicherheit, die Wirtschaftsindikatoren, der Fußball und die Show des schlechten Geschmacks das tägliche Leben der Chilenen bestimmten.
Der Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) mit dem Titel „Die Paradoxien der Modernisierung” durchleuchtete den Zustand Chiles in den 1990er Jahren vielleicht gründlicher als jede andere Analyse und zeigte, wie desillusioniert, gespalten, misstrauisch, ängstlich und uninformiert das Land war.
Darin gab es viele Zeugnisse des Unbehagens an einem politischen Übergang, der sich schamlos ins 21. Jahrhundert bewegte, den Diktator aus dem Londoner Gefängnis heraus verteidigte und Fragen nicht nur in Bezug auf Wahrheit und Gerechtigkeit im Bereich der Menschenrechte aufwarf, sondern auch in Bezug auf die Änderung der von der Diktatur geerbten Verfassung, die Rechte der indigenen Völker, den Wiederaufbau eines öffentlichen Bildungs- und Gesundheitssystems, die Rechte der Frauen und sexueller Minderheiten, um nur einige Themen zu nennen.
An diesem Morgen glühten die Telefondrähte in Santiago, aber das System brach nicht zusammen. Als Netz von Journalisten tauschten wir sekündlich Informationen aus, die ziemlich genau waren, mit Ausnahme derjenigen, die von einer Befreiungsarmee unter dem Kommando von General Prats[10]sprachen, was angesichts des Schreckens eine Fantasie war. Ich kann mich nicht mehr an die ersten Momente in dieser kleinen Wohnung in der Straße Villavicencio erinnern, die für einen Moment von den Besuchern aus dem Stockwerk darunter überfüllt war. Erinnern kann ich mich an den Moment, als die Bombardierung begann, als drei oder vier von uns Journalisten auf das Dach des Gebäudes kletterten, angeführt von Ulises Gómez, dem Sohn von José Gómez López, einem Mitflüchtling, dem die Tür, die auf das Dach führte, aus der Hand fiel und einen Lärm verursachte, der das kleine Gebäude und einige seiner Bewohner bis ins Mark erschütterte.
Der Rauch von „La Moneda“ in Flammen, der ohrenbetäubende Lärm der Bomben, die vor unseren Nasen fielen, die Rufe, die den Wahnsinn, den Tod, das Schicksal von Augusto Olivares[11], des Präsidenten Allende, der cordones industriales[12], der Städte, der Universitäten, unserer Häuser besiegelten, zeigten das Grauen, das unaufhaltsam auf uns zu kam.
Der entscheidende Tag war gekommen, nur war niemand darauf vorbereitet. In den Tiefen unserer Seelen träumten und spekulierten wir über alles, nur nicht über die Möglichkeit, dass der Verrat wahr werden könnte.
Am 4. September 2022 gingen mehr als 13 Millionen Menschen oder 85,7 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen, um über den Verfassungsentwurf abzustimmen, der von den 155 Mitgliedern des Verfassungskonvents neun Monate lang ausgearbeitet worden war. Die Niederlage war niederschmetternd. Am Tag des Referendums stimmten nur 38,14 Prozent für den Text, 61,86 Prozent lehnten ihn ab. Mehr als 7,8 Millionen Menschen sagten Nein zu dem Text, der eine der fortschrittlichsten Verfassungen der Welt hätte werden können.
Meine Generation kennt die Niederlagen und ihre Spuren. Extreme, wenn es um Staatsstreiche und ihre Folgen wie Verbrechen, Verschwindenlassen, Folter, Exil und Tränen geht. Physische und psychische, politische und persönliche Niederlagen, die Jahre und Generationen brauchen, um über sie hinwegzukommen.
Die Niederlage vom 4. September war zweifellos verheerend für einen Teil der Gesellschaft. Wir hatten von dem Land geträumt, das in diesem Text beschrieben wird. Wir hatten uns diese utopische Gesellschaft mit garantierten Rechten, auch für die Natur, vorgestellt. Die Mobilisierungen von 2006, 2011, 2018 und dann der Ausbruch der Massenproteste im Oktober 2019 ließen uns glauben, dass dieser Aufschwung seine Entsprechung in einem Text finden würde, der den freiheitlichen und demokratischen Geist widerspiegelt, den das Land atmete.
Vielleicht hatten wir die Tiefe der Wirtschaftskrise unterschätzt, die sich mit der Pandemie ausbreitete, und die, angesichts der spärlichen staatlichen Hilfen, die Entnahmen aus den privatsierten Rentenfonds in eine Überlebensalternative verwandelte. Auch die Auswirkungen der lateinamerikanischen Migrationskrise hatten wir nicht richtig verstanden. Eine Krise, die nicht nur unsere kleineren Städte und Gemeinden traf und die prekären Gesundheits-, Bildungs- und Wohnungssysteme belastete, sondern vor allem einen tiefgreifenden Rassismus und eine Fremdenfeindlichkeit an die Oberfläche brachte, vor denen Umfragen und Studien längst gewarnt hatten. Einstellungen, die auch geschürt wurden durch eine gleichzeitige Krise der Sicherheit, deren Ausmaß wir nicht richtig analysiert hatten.
Das Scheitern der neuen Verfassung
Auch aus dem Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2021 haben wir nicht die richtigen Schlüsse gezogen. Damals bekam der Kandidat der extremen Rechten, José Antonio Kast, in der ersten Runde mehr Stimmen als der Kandidat der Linken, Gabriel Boric (27,92 Prozent Kast / 25,83 Prozent Boric). In der zweiten Runde verlor der Kandidat der extremen Rechten zwar gegen Boric, aber er verlor mit nicht unerheblichen 44,13 Prozent und seine Partei erhielt eine große Zahl der Parlamentssitze.
Und erst recht hatte unser Lager nicht ernst genommen, dass es in Chile nicht nur um die schriftliche Verfassung ging, sondern um eine Veränderung des politischen, sozialen und wirtschaftlichen Modells und damit um das Ende der Privilegien derjenigen, die den Staatsstreich von 1973 ermöglicht und unterstützt hatten.
Es war daher keine Überraschung, dass alle möglichen Mittel eingesetzt wurden, um diese Veränderung zu verhindern. Mittel, die meiner Generation vertraut waren. Die Rechte schürte nicht nur die Polarisierung mit einer aggressiven Rhetorik im Kongress und anderen Foren der demokratischen Debatte, einschließlich des Verfassungskonvents, sondern sie erzeugte auch Angst mit Falschmeldungen, verbreitet von bestimmten Medien und in sozialen Netzwerken. So behauptete sie, mit der neuen Verfassung würden die privaten Rentenfonds enteignet, das Recht auf ein eigenes Haus, die Nationalflagge und die Nationalhymne abgeschafft.
Es war kurz nach fünf Uhr nachmittags, und die Stille der über die Stadt verhängten Ausgangssperre wurde von vereinzelten Schüssen unterbrochen, die uns das Echo der Niederlage hören ließen. In der Küche der winzigen Wohnung kochte Marta Harnecker eine Suppe, und ich, unerfahren in solchen Dingen, versuchte, ihr bei ihrer gigantischen Aufgabe zu helfen, ein Dutzend unruhiger Gäste zu verköstigen.
Das Geräusch des schweren Fahrzeugs, das auf dem Bürgersteig vor dem Gebäude vorfuhr, brachte uns zum Stillstand. Von der Küche aus konnte man das Panorama der Straße Villavicencio in seiner ganzen Pracht sehen. Das Aufgebot an Militärpolizisten in Kampfmontur, die aus dem Bus stiegen und ihre Maschinengewehre auf das oberste Stockwerk, unser Fenster, richteten, beseitigte jeden Zweifel. Unser Abendessen würde unterbrochen werden, das Ziel waren wir.
Aus einem unerklärlichen Grund beschlossen wir, unsere Kollegen nicht zu alarmieren. Wir setzten unser Treiben fort, als ob nichts geschehen wäre. Wir gingen gerade ins Wohnzimmer, als es energisch an der Tür klopfte. Der Journalist Miguel Budnick, ein aus dem Fernsehsender der Universität von Chile bekanntes Gesicht, öffnete die Tür, ohne zu ahnen wem, vielleicht in dem Glauben, dass ein anderer Nachbar mit neuen Informationen hereinkommen würde. Die schwer bewaffneten Männer traten ein und gaben die üblichen Befehle: zur Wand drehen, Hände hoch und Beine auseinander. Dann: Zeigen Sie Ihre Ausweise! Eine befehlende Stimme entschied, dass die beiden Frauen in der Gruppe in einer entspannten Position bleiben könnten. Wir wurden durchsucht, und dieselbe Stimme sagte: „Gibt es hier Journalisten?” „Nein“, antworteten wir im Chor und wie betäubt. „Gibt es hier Ausländer?” „Nein“, sagten wir in einem Ton, der angesichts der Ironie im Ton des Kommandanten, der unsere Ausweise in der Hand hielt, erbärmlich klang. „Durchsucht die Wohnung!”, befahl er.
Ich weiß nicht mehr, was ich in diesem Moment dachte oder fühlte, aber Marx‘ Gesicht, das an die Hauptwand des Raumes genagelt war, gab mir einen Blick zurück, den ich inmitten des Chaos als perplex interpretierte. Die Worte der Kommuniqués der Militärjunta klangen noch in unseren Ohren, mit dem hasserfüllt ausgesprochenen Namen von Marta Harnecker darin, ebenso wie die Warnung vor Ausländern, die als Extremisten, Terroristen und ähnliches mehr bezeichnet wurden. Ernesto González Bermejo, ein bekannter uruguayischer Journalist, der zum Team von „Chile Hoy“ gehörte, war bei uns und wurde wie viele andere auch gesucht.
Nach den unendlich langen Minuten, die die Razzia dauerte, befahl diese Stimme den Rückzug, und als sein Trupp bereits die Wohnung verlassen hatte, warnte er uns zu unser aller Überraschung: „Seid vorsichtig, ein Nachbar im ersten Stock hat euch denunziert. Sobald die Ausgangssperre aufgehoben ist, verlasst den Ort, denn es ist sehr gefährlich!“
Die Vergangenheit gehört zum Leben eines jeden, auch zum Leben eines Historikers, sinnierte Eric Hobsbawm in Santiago de Chile, als wir gemeinsam in der Lobby des Hotels Carrera saßen. Das Hotel existiert nicht mehr, genau wie dieser bedeutende britische Historiker jüdischer Herkunft, Autor eines Dutzends grundlegender Bücher wie „Das imperiale Zeitalter“ oder „Europäische Revolutionen“, dessen sterbliche Überreste auf dem East Londoner Friedhof ruhen, ganz in der Nähe von Marx‘ Grab.
Hobsbawm besuchte Chile Ende 1998. Ich interviewte ihn für die Zeitschrift „Rocinante“, die es auch nicht mehr gibt, gerade zu der Zeit, als Pinochet in London verhaftet wurde.[13] Wir sprachen über die Bedeutung des Gedächtnisses, und ich fragte ihn, ob es ein Zufall sei, dass er als Historiker immer wieder an Ort und Stelle ist, wenn ein historisches Ereignis stattfindet. Er lachte und antwortete, das sei einfach Glück. Das gleiche Schicksal hatte ihn nach Berlin geführt, als Hitler gerade die Macht übernahm, nach Moskau nach Stalins Tod und nach Lateinamerika auf dem Höhepunkt der revolutionären Bewegungen.
Hobsbawm erzählte mir an diesem Nachmittag von einem Erlebnis mit US-Studenten in den 1980er Jahren. Als er ihnen erzählte, dass er am Tag der Machtergreifung Hitlers in Berlin gelebt habe, sei das für sie so gewesen, als hätte er erzählt, er habe am ersten Kreuzzug teilgenommen. Beide Episoden lägen sehr weit zurück, erklärte er und betonte, dass die alten Mechanismen, die die Generationen miteinander verbunden haben, zerbrochen seien.
Erinnern an die Verschwundenen: Sprechen wir noch dieselbe Sprache?
Dann wies Hobsbawm darauf hin, dass in mehreren europäischen Ländern ein völliges Schweigen über die Erfahrung der Weltkriege herrsche. Dagegen werde die gemeinsame Erfahrung des Zweiten Weltkriegs in England oder in Russland durch öffentliche Erinnerungen, durch Erzählungen und durch Fernsehsendungen kontinuierlich am Leben erhalten. In Deutschland und Frankreich sei dies jedoch nicht der Fall.
„Im ersten Fall gab es eine ganze Generation, die nicht über die Ereignisse des Krieges sprechen konnte oder wollte. Dasselbe gilt für Frankreich, das nach dem Krieg auf der Grundlage eines Mythos rekonstruiert wurde, dem Mythos des Widerstands aller Franzosen gegen die Deutschen, den es aber tatsächlich so nicht gab. Deshalb war es fast dreißig Jahre lang nicht möglich, über einen großen Teil der Vergangenheit zu sprechen“, erklärte der Historiker.
Hobsbawm kam zu dem Schluss, dass die Welt eine andere geworden war: Die Bedeutung der Wörter war – obwohl laut Wörterbuch noch dieselbe Sprache gesprochen wurde – für jemanden, der in den 1980er Jahren auf die Welt gekommen war, eine andere als für jemanden, der in den 1950er Jahren geboren wurde.
Jetzt frage ich mich, in welcher Kategorie sich Chile heute, 50 Jahre nach dem Putsch, befindet, wenn Leugnungsdiskurse an allen Fronten wuchern, während an einem verregneten Samstagmorgen Ende Juli 2023 die 119 Männer und Frauen, die die Diktatur 1975 in der sogenannten Operation Colombo verschwinden ließ, in einem beispiellosen und herzzerreißenden Marsch durch die Hauptstraßen der Innenstadt Santiagos „wiederauferstehen“.
In Holz nachgebildet und von ihren Verwandten umarmt, wurden diese 1,80 Meter großen Figuren vom Museum der Erinnerung und der Menschenrechte zum Museum der Schönen Künste getragen, in einer Reise der Gerechtigkeit und des Gedenkens. Die großen Medien, einschließlich des Fernsehens, berichteten nicht über dieses symbolträchtige Ereignis, und machten so – wie es die Diktatur vor 48 Jahren getan hatte – die Opfer unsichtbar.
Es heißt, der 11. September sei ein nebliger Tag gewesen, aber das kann ich nicht bestätigen. Ich weiß auch nicht, was mit dem Bauernmädchen geschah, dessen wütendes Gesicht an jenem Dienstag in den Kiosken hing, und was geschah, nachdem der Trupp die Wohnung in der Straße Villavicencio verlassen hatte. Ich weiß nicht, ob wir am Ende die Suppe gegessen haben, oder ob wir irgendwann in dieser langen Nacht, als die Schüsse fielen, geschlafen, geweint oder geredet haben. Ich habe keine Erinnerungen, nur das Gefühl, etwas Komplexerem gegenübergestanden zu haben als der erschütternden Vision des Todes.
Dieser Offizier, an dessen Gesicht ich mich nicht mehr erinnere, hat uns vielleicht glauben lassen, dass noch nicht alles verloren sei. Ich weiß es nicht. Der 11. endete für mich mit dem Zuschlagen der Tür, durch die die Uniformierten die Wohnung verlassen hatten.
Als die letzten gingen, veranlasste mich ein unwiderstehlicher Impuls, eine Frage zu stellen, eine „déformation professionelle“, aber im Nachhinein eine unverzeiliche Entgleisung: „Wie ist die Lage draußen, was passiert, gibt es viele Tote”, fragte ich einen Unteroffizier, der stehen blieb, zögerte und etwas Vages antwortete, das ebenso absurd war wie meine überraschende Frage: „Mehr oder weniger schlecht, schalten Sie das Radio ein!”
Nachdem die Tür schließlich zugeschlagen wurde, war der erste, der das Schweigen brach, der Journalist José Cayuela, ein langjähriger Freund von mir, der mich in seiner Rolle als Chefredakteur zurechtwies ob meines lächerlichen und unangemessenen Rechercheimpulses.
Ich habe keine weiteren Bilder von diesem Tag in meinem Gedächtnis. Seltsam sind die Fallstricke der Erinnerung. Dann erinnere ich mich wieder, wie wir das Gebäude verließen, als die Ausgangssperre für ein paar Stunden aufgehoben wurde. Schon in Marta Harneckers kleinem Citroen 2CV wurden wir beide von einem jungen bewaffneten Wehrpflichtigen angehalten, der zaghaft auf uns zeigte, ohne zu wissen, wie er das kleine, mit Papieren und Zeitschriften vollgestopfte Fahrzeug und zwei Frauen, die ihn mit Fragen und Lächeln bedrängten, durchsuchen sollte.
Als wir eine der Alleen am Rande des Parque Forestal hinauffuhren und den verwirrten Jungen zurückließen, brachen wir in Gelächter aus. Der Tag war hell und die Bergkette der Anden leuchtete. Im September ist Santiago so, hell und warm. Selbst an Tagen, an denen der Tod in der Nähe ist.
Eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Mori mit dem Titel „Chile im Schatten Pinochets“, die im vergangenen Mai veröffentlicht wurde, bestätigte das Klima, das schon in den Medien und den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Gedenken an den 50. Jahrestag des Staatsstreichs zu spüren war. Die ausführliche Befragung kam zu dem Ergebnis, dass 36 Prozent der Bevölkerung – 20 Prozentpunkte mehr als vor zehn Jahren – glauben, dass die Streitkräfte „zu Recht“ geputscht hätten, während 41 Prozent der Meinung sind, dass „es nie einen Grund gibt, einen Staatsstreich durchzuführen“, was 27 Prozentpunkte weniger sind als bei der gleichen Umfrage im Jahr 2013, als 68 Prozent dieser Meinung waren. Nach Ansicht der Direktorin von Mori, Marta Lagos, hat die Studie gezeigt, „dass es im Westen keinen anderen Diktator gibt, der den Lauf der Zeit so gut überstanden hat wie Augusto Pinochet, der 50 Jahre nach dem Putsch sogar wieder an Ansehen gewonnen hat“.
Diese Studie wie auch der jüngste Vorschlag einer Gruppe von Verfassungsräten – Mitglieder eines neuen Verfassungsrates, in dem Vertreter der Rechten die Mehrheit haben –, dass Verurteilte über 75 Jahre ihre Strafe unter Hausarrest verbüßen können, was bedeuten würde, dass beispielsweise 145 Personen davon profitieren würden, die wegen Menschenrechtsverletzungen im Gefängnis sitzen, die sie während der Diktatur begangen haben, veranlasst uns nicht nur uns zu fragen, welche Art von Politik und Gesellschaft da seit 1990 entstanden sind.
Pinochet gewinnt an Ansehen: Das Jahrhundert der Verleugnung?
Es stellt sich auch die Frage, welche Rolle die Presse spielt angesichts dieser Umfrage und von Hassreden und Verleugnungsdiskursen, die beständig zunehmen und unwidersprochen in den Medien kursieren, als ob der Journalismus nichts mit der ethischen Verpflichtung zu tun hätte, die Menschenrechte und die Demokratie zu verteidigen. Es ist daher kein Zufall, dass in Chile der 50. Jahrestag des Staatsstreichs einhergeht mit der zunehmenden Leugnung der Verbrechen der Diktatur und mit Angriffen auf Gedenkstätten.
Die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte stellt dazu in ihrem Bericht zur Lage der Menschenrechte in Chile 2022 fest, dass die Zunahme des Negationismus Hand in Hand geht mit der Schändung von Orten der Erinnerung: „In den letzten drei Jahren hat die Kommission eine Zunahme der Angriffe auf Gedenkstätten festgestellt. Öffentlichen Informationen zufolge wurden in vielen dieser Fälle Mahnmale und Gedenktafeln, die an die Opfer schwerer Menschenrechtsverletzungen der Diktatur erinnern, teilweise zerstört oder mit Botschaften beschmiert, die die Opfer beleidigen, die Verbrechen leugnen oder Hass verbreiten. Darüber hinaus gab es Berichte über Einbrüche auf das Gelände der Gedenkorte und über Handlungen, die sowohl die Unversehrtheit der Gedenkstätten als auch der Beweismittel oder der sterblichen Überreste der Opfer, die auf dem Gelände vermutet wurden, beeinträchtigt oder gefährdet haben.“
Hobsbawm nannte das 20. Jahrhundert aufgrund der vielfältigen Gewalttaten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit „das Jahrhundert der Extreme“. Im 21. Jahrhundert wird versucht, diese Gewalttaten und Verbrechen zu vergessen oder zu leugnen. Aus diesem Grund haben einige Historiker es als „das Jahrhundert der Verleugnung und Straflosigkeit“ bezeichnet.
So bleibt ein halbes Jahrhundert nach dem Militärputsch, bei dem ein demokratisch gewählter Präsident gestürzt, der Regierungspalast bombardiert und Zehntausende Menschen massakriert wurden, Hobsbawms Frage offen, ob Chile zu den Ländern gehört, die ihre Vergangenheit verschweigen – oder ob das „öffentliche Gedächtnis“, von dem der Historiker sprach, über das Leugnen, das Vergessen und das Weglassen siegen wird.
Die Übersetzung aus dem Spanischen stammt von Ferdinand Muggenthaler.
[1] Die Mapuche sind die größte indigene Gruppe in Chile. Beim Zensus 2017 bezeichneten sich über zehn Prozent der Einwohner Chiles als Mapuche.
[2] Die Agrarreform hatte bereits die Vorgängerregierung gestartet, aber vor allem die Regierung Allende trieb sie voran: Sie enteignete insgesamt 6,4 Millionen Hektar Großgrundbesitz und verteilte sie an Kleinbauern, Kooperativen oder stellte sie unter staatliche Verwaltung.
[3] Die „comandos comunales” (Kommunalkommandos) verstanden sich als Organe einer entstehenden rätedemokratischen Volksmacht; Interview mit Margarita Paillal, in: „Chile Hoy“, 65/1973.
[4] Bewegung der städtischen Unterschicht, die Land besetzte, um darauf Behelfsunterkünfte zu bauen und bezahlbaren Wohnraum forderte.
[5] Das linke Parteienbündnis, für das Allende 1970 als Präsidentschaftskandidat antrat. Er gewann den ersten Wahlgang mit relativer Mehrheit. Im zweiten Wahlgang, der verfassungsgemäß im Parlament stattfand, wurde er mit großer Mehrheit – 153 von 195 Stimmen – zum Präsidenten gewählt.
[6] Dieser und alle weiteren kursiv gesetzten Auszüge aus: Faride Zerán, Los grises de mi mamá, in: ¿Qué hacía yo el 11 de septiembre de 1973? (Was machte ich am 11. September 1973?), Santiago de Chile 1997, S. 149-159.
[7] Straße, die am Regierungspalast vorbeiführt.
[8] Manuel Antonio Garretón, La Faz sumergida del Iceberg, Santiago de Chile 1994.
[9] Als Mestizen werden in Lateinamerika Menschen bezeichnet, die sowohl von Europäern als auch von Indigenen abstammen.
[10] Gemeint ist der verfassungstreue General Carlos Prats. Er war zeitweise Innenminister und Vizepräsident unter Allende. Nach dem Putsch seines Nachfolgers als Armeechef, Augusto Pinochet, ging er ins Exil nach Argentinien. Dort wurde er 1974 durch eine Autobombe getötet.
[11] Der Journalist und Präsidentenberater Augusto Olivares nahm sich als erster unter den Verteidigern des Präsidentenpalastes das Leben. Er gilt als erstes Opfer der Militärdiktatur.