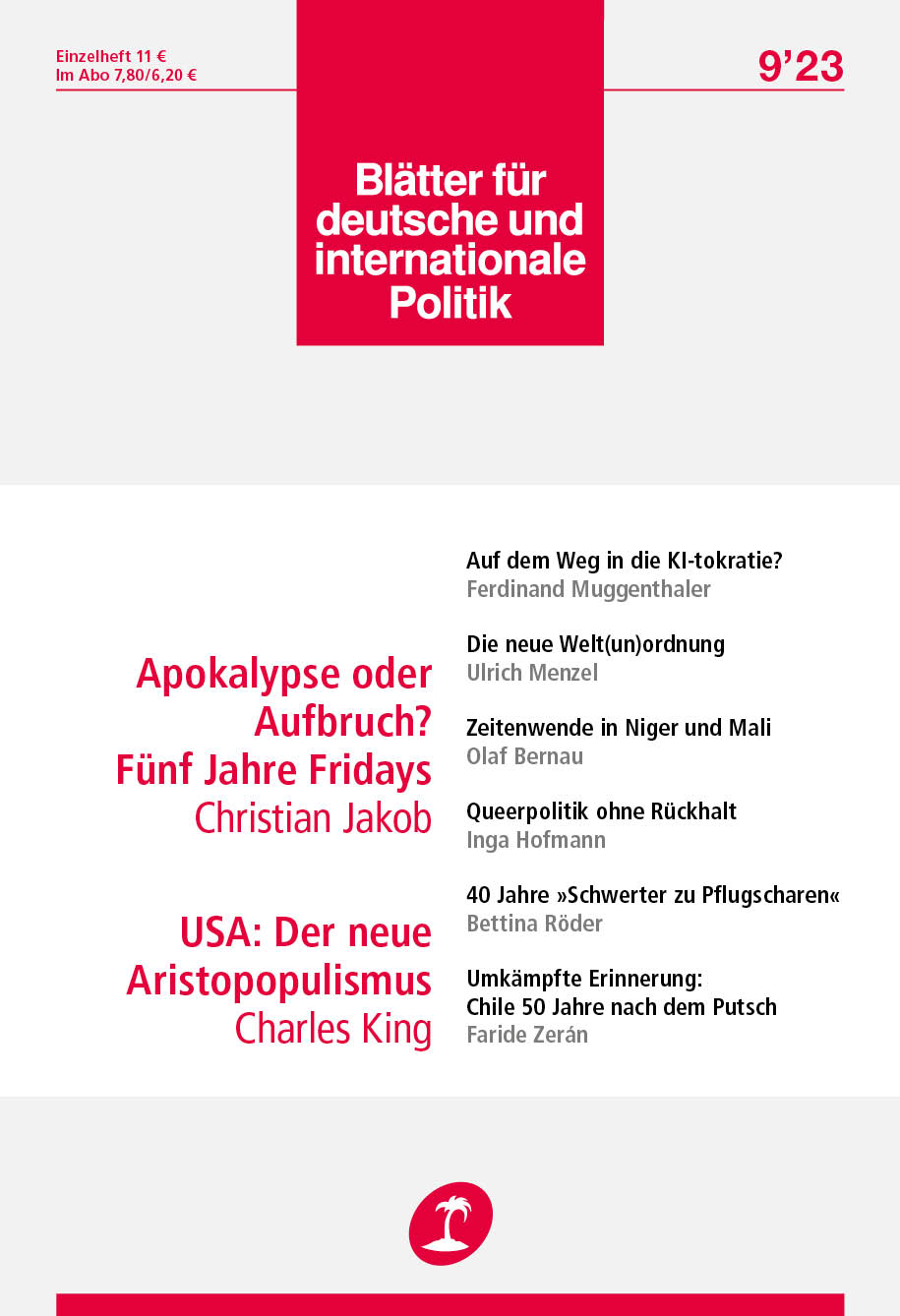Bild: Traktoren bei der Strohernte in der Region Weser-Ems in Niedersachsen, 15.7.2023 (IMAGO / Countrypixel)
Er ist begrenzt, nicht vermehrbar und seit jeher ein stark umkämpftes Gut: der Boden. Neben Wasser bildet er eine der wichtigsten Lebensgrundlagen auf unserem Planeten, denn jedes Lebewesen an Land ernährt sich von dem, was auf dem Boden oder durch ihn gedeiht. Gerade in Zeiten der rasant voranschreitenden Klimakrise steigt sein Wert stetig. Er gilt aber auch als inflationssicher, was ihn zu einem äußerst lukrativen Anlageobjekt macht. Zugleich spielen sich mannigfaltige Konflikte um seine Nutzung und Ressourcen ab – seien es die Energiekrise und die Strategien zu ihrer Bewältigung, die Ernährungskrise, die zunehmende Versiegelung und Verschmutzung des Bodens durch Landwirtschaft und Industrie oder seine Nutzung als Kohlenstoffsenke. Ohne zu übertreiben, lässt sich daher behaupten: Auf dem Boden wird die Zukunft von Gesellschaften und des Planeten verhandelt.
Dennoch sehen wir ein Missverhältnis: Einerseits schreitet der Aufkauf von Land durch Investoren rapide voran. So besitzen laut einer aktuellen Studie des Thünen-Instituts nichtlandwirtschaftliche natürliche Personen durchschnittlich etwa 49 Prozent der Flächenanteile in den untersuchten Gemeinden, insbesondere in Ostdeutschland.[1] Andererseits wird im öffentlichen Diskurs und in der Politik der enormen Relevanz des Bodens für das menschliche und letztlich für alles Leben auf der Erde erstaunlich wenig Rechnung getragen.