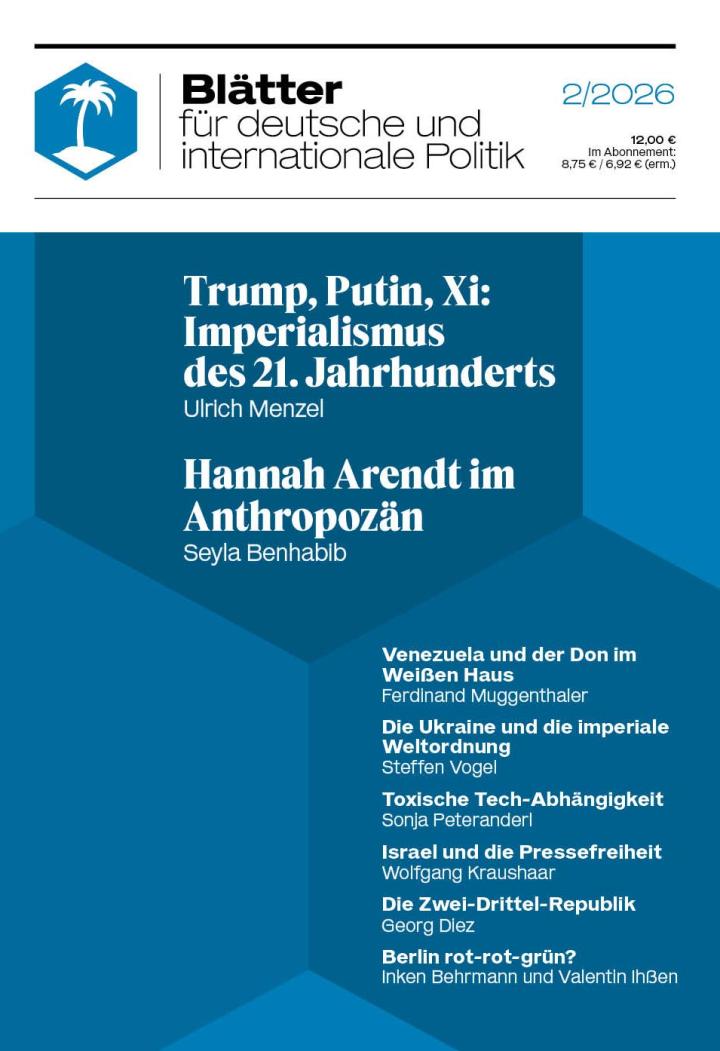Warum die Bodenpolitik völlig neu gedacht werden muss

Bild: Eine Landstraße zwischen Feldern (IMAGO / Imaginechina-Tuchong)
Der Boden ist unsere Existenzgrundlage, als Grund wird er ausgemessen und in Besitz genommen, als Fläche im Raum unterschiedlich genutzt, alles zusammen ist es Land – und das war schon immer ein knappes Gut. Aber noch nie war die Konkurrenz so groß. „Buy land, they’re not making it any more“: Mit einem Tempo, das selbst Mark Twain, von dem das bekannte Zitat stammt, in Schwindel versetzt hätte, wird heute „die Erde“ neu vermessen und in Besitz genommen – und zwar in der doppelten Bedeutung des Wortes, als Planet und als fruchtbare Krume. Investoren suchen Land, wo sie es kriegen können, zu Hause und in aller Welt. Man kann Land kaufen, besitzen, pachten, kann damit handeln wie mit anderen Waren. Land, das früher dem Staat und meist den Bäuerinnen und Bauern, die es bewirtschafteten, gehörte oder das von indigenen Bevölkerungsgruppen gemeinschaftlich genutzt wurde: Es ist heute auch und nicht zuletzt ein Rendite- und Spekulationsobjekt.
Viel zu lange war die Knappheit und Überbuchung des Grundes der Elefant im Raum. Doch jetzt, erstaunlich spät zwar, aber dafür immer öfter, ist die Rede von der Fläche als „neuer Währung“, so formuliert es der Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Stefan Tidow, oder immer wieder vom „neuen Gold“. Um jeden Hektar Erde wird gebuhlt. Immer schneller wird Land deshalb immer kostbarer und laufend teurer. Das gilt für Baugrundstücke in den Städten wie für den Wald. Im Wasdower Wald etwa stieg die Versteigerungssumme im Wettbewerb zwischen Interessenten aus Naturschutz, Jagd und Forstwirtschaft am Ende auf fast das Doppelte des Verkehrswerts. Und laufend teurer wird besonders das Ackerland. Familienbetriebe können beim Kauf von Agrarflächen kaum mehr mithalten, da die Preise auf dem Bodenmarkt drastisch viel höher gestiegen sind als die Einkommen. Ein Viertel der Äcker, die in den vergangenen Jahren den Besitzer gewechselt haben, wurde von Käufern ohne agrarwirtschaftliche Vorgeschichte erworben. Dazu gehören Finanzfonds, Immobilienunternehmen oder Firmenbesitzer wie der kürzlich verstorbene Brillenhersteller Fielmann.
Seit einigen Jahren gehen Unternehmen aus reichen Ländern auch in Afrika, Asien oder Südamerika auf Boden-Shopping-Tour. „Sollen sie doch Kolonien fressen“, spottet David Montgomery, Professor für Geomorphologie und Autor des Buches „Dreck – Warum unsere Zivilisation den Boden unter den Füßen verliert“[1], in Anspielung auf das legendäre Kuchenzitat aus der Französischen Revolution. Auf diese Weise gehört immer mehr Grund und Boden immer weniger Menschen oder Organisationen. Doch Land ist kein Gut wie alle anderen. Einer Definition der UNO zufolge ist es das „biologisch produktive terrestrische System, das den Boden, den Pflanzenbestand, andere Teile der belebten Umwelt sowie die ökologischen und hydrologischen Vorgänge umfasst, die innerhalb des Systems ablaufen“.[2] Das ist eine spröde Beschreibung für etwas Unabdingbares: die Grundlage allen Lebens – „wertvoller als Diamanten“, so der grüne Agrarminister Cem Özdemir.
Wie das Land gepflegt und genutzt wird, bestimmt, wie viel Kohlenstoff der Boden speichert oder emittiert, wie viele Früchte er hervorbringt, welche Qualität das Trinkwasser hat, ob Sturzregen versickern kann oder zu zerstörerischem Hochwasser wird, ob die Böden in der Sommerhitze ihre Umgebung kühlen oder alles verdorren lassen, ob biologische Vielfalt gedeiht oder verdirbt und ob die Ökosysteme den menschengemachten Bedrohungen standhalten werden. Wie wir unser Land nutzen, prägt die Gestalt unserer Landschaften, die kulturelle Identität der ländlichen Regionen, der Städte und der Menschen, die darin wohnen. Wie wir unser Land nutzen, bestimmt, was wir essen, wie wir wohnen und reisen, kurz, wie wir leben.
Doch wir haben es nicht gut genutzt. Regierungen, Landwirte, auch wir Konsumenten und Stadtbewohner haben das Land mit stetig anspruchsvolleren Konsum- und Wohnansprüchen unter Asphalt und Beton vergraben und seiner Lebendigkeit beraubt. Wie aber lässt sich die wachsende Gefährdung dieses wertvollen Gemeingutes mit der wachsenden Konzentration des Landes in den Händen weniger Vermögender vereinbaren? Wer entscheidet zukünftig über das Land, wenn es immer enger wird, weil immer mehr Menschen weltweit versorgt werden müssen, mit Wasser, Nahrungsmitteln, Kleidung, Behausung, Mobilität; wenn die Ansprüche der Menschen steigen – aber die Reichen nicht teilen wollen und der Planet und seine Natur Grenzen setzen? Wie weiten Regierungen den Blick fürs Ganze und denken all diese Wissens- und Interessenswelten kreativ zusammen, statt sie teils widersprüchlich nebeneinanderher zu steuern? Wie lösen sie die unzähligen neuen Zielkonflikte um Grund und Boden?
Bei alledem geht es um politischen Sprengstoff, denn die Kämpfe um das Land und seine Nutzung sind längst entbrannt. Im Jahr 2021 wurden weltweit 200 Menschen ermordet und Tausende staatlichen Repressalien ausgesetzt, teils in Haft genommen, weil sie gegen Bergbauprojekte, Waldrodungen oder die Vertreibung von Kleinbauern vorgingen, „an der Verteidigungslinie gegen den ökologischen Kollaps“[3], wie es die Organisation Global Witness nennt. In Europa leben Umweltaktivisten und Naturschützerinnen zwar nicht so gefährlich wie in Mexiko, Kolumbien oder Brasilien. Aber viele Kämpfe um Landressourcen im Globalen Süden sind mit unseren Konsumansprüchen unmittelbar verbunden. Und auch hierzulande prallten Staat und Bürger aufeinander, ob im besetzten Hambacher Forst oder im kleinen Dorf Lützerath, als Tausende Aktivistinnen und Aktivisten fruchtbaren Boden vor den Schaufeln der Braunkohlebagger retten wollten. Umweltschützer versammelten sich in Protestcamps gegen geplante Gewerbegebiete auf der besagten grünen Wiese. Oder sie versuchten, Pläne des Autokonzerns Tesla einzudämmen, dessen „Gigafactory“ für Elektroautos in Grünheide mitten in der dürregefährdeten Brandenburger Mark ein Wasserschutzgebiet bedroht. Fast 200 Hektar Wald fielen der „grünen“ E-Mobilität zum Opfer.
Wer entscheidet über das Land?
Und das sind nur die spektakulärsten Konflikte. Denn auch ohne überregional Schlagzeilen zu liefern, verstärkt sich der Streit um das Land.
Zum Beispiel im Hamburger Klövensteen, einem idyllischen Waldgebiet vor den Toren der Stadt, wo der Milchbauer Hauke Jaacks seinen Hof an einen Immobilienmakler verloren hat. Die Familie Jaacks hatte den Moorhof seit vielen Jahren gepachtet, ihre große Herde rotbunter Milchkühe auf den Weiden am Wald gehörte für die Erholung suchenden Hamburgerinnen zum Landschaftsbild wie die Knicks, die langen Hecken entlang der Weiden und die alten Eichenalleen. Als die Eigentümer sich zum Verkauf ihres Hofes entschlossen, meldete Jaacks sein Interesse an. Er wähnte sich sicher, den Hof kaufen zu können, schließlich haben landwirtschaftliche Pächter ein Vorkaufsrecht. Doch ein Hamburger Immobilienmakler überbot den Milchbauern und bekam den Zuschlag für einen Pferdehof – trotz Gerichtsverfahren und einer bundesweiten Petition mit 170 000 Unterschriften für den Erhalt des Bauernhofs. Hauke Jaacks blieb, hoffte auf neue Flächen in der Nähe, widersetzte sich einer ersten Zwangsräumung und gab nach zwei Jahren Kampf schließlich auf. Sein Lebenswerk, die rotbunte Herde, wurde größtenteils verkauft und geschlachtet.
Zweites Beispiel: das Münchner Umland. Dort könnten die Pioniere vom Kartoffelkombinat, das über 2000 Münchner Haushalte mit Gemüse versorgt, ihre Pachtflächen verlieren – an Photovoltaik-Investoren. Die Genossenschaft gilt als Vorzeigemodell dafür, wie der Umbau der Agrar- und Ernährungssysteme gelingen kann. Sie hat nicht einfach Kunden, sondern teilt die regionale, ökologische Gemüseernte unter den Genossen auf, arbeitet selbstbestimmt und zahlt ihren Gärtnerinnen und Gärtnern faire Löhne. Das alles sei nun in Gefahr, sagt der Gründer und Vorstand Daniel Überall. „Der Pächter hat uns gekündigt. Ende 2025 läuft der Vertrag aus. Investoren, die Photovoltaik pflanzen wollen, bieten Summen, die sich mit fair produzierten Lebensmitteln nicht erwirtschaften lassen.“ Unternähme man eine Deutschlandreise, könnte man an vielen derartigen Baustellen anhalten, die durchaus legitimen Interessen, ja wichtigen Zielen wie der nachhaltigen Energieversorgung dienen, die aber zugleich Ackerflächen, Moore, Sümpfe, Heideflächen oder Wälder zerstören oder gefährden. Die Fragen, die all die scheinbar lokalen Konflikte aufwerfen, sind dabei übergreifender und struktureller Art, und sie spitzen sich ähnlich, ja oft noch drastischer im Rest der Welt zu: Hat das Menschenrecht auf Wohnen Vorrang oder das Lebensrecht eines Tieres, einer Art? Zählen Straßen und Ställe mehr oder revitalisierte Moore? Solaranlagen oder Äcker, Holznutzung oder wilder Wald, Wasser für die Landwirtschaft oder für die Industrie oder zum Trinken? Oder gilt bei alledem nur: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst?
Bodenversiegelung – bloß ein Kavaliersdelikt?
Die allgemeine Folge der weltweit enorm steigenden Nachfrage nach „Biomasse“, wie Ökonomen Pflanzen gerne nennen, war bislang allzu oft ein gleichförmiger, großflächiger Anbau von anfälligen Kulturen auf Kosten der Böden – während der Energie-, Mobilitäts- und Bauhunger der Städte immer größere Flächen frisst. In Deutschland sind heute schon rund 45 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsfläche zubetoniert. Von 2017 bis 2020 wurden im Durchschnitt täglich 54 Hektar zusätzlich für Gebäude, Straßen, Windräder oder PV-Anlagen ausgewiesen und damit potenziell oder schon real versiegelt. Das sind weniger als um die Jahrtausendwende, da lag der tägliche Betonierungszuwachs wegen des Baubooms bei 190 Hektar. Doch 2021 drehte sich der Trend wieder, die Zahl stieg erneut auf 55 Hektar, eine Fläche, die mehr als 78 Fußballfeldern entspricht. Und es ist kein Ende in Sicht, im Gegenteil: Die neue, beschleunigte Baueuphorie der Ampelkoalition lässt weitere Betonierung befürchten. Eine Vielzahl kommunaler Einzelentscheidungen, die dem zugrunde liegen, summieren sich zu einem klaren Verstoß gegen die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Sie fordert das Gegenteil: Bis zum Jahr 2030 sollten noch höchstens 30 Hektar täglich zusätzlich in Anspruch genommen werden. Die fatale Entwicklung wird hingenommen wie ein Kavaliersdelikt. Dabei fordern Experten schon lange eine Null-Expansionspolitik. Netto null auch für den Landverbrauch. Besser noch allerdings wäre ein Minus, denn der Boden als die existenzielle, unersetzliche Ressource ist nicht nur knapp, sondern vielerorts dramatisch geschädigt, erodiert, vergiftet, ja existenziell bedroht. „Gut möglich, dass der Boden das komplexeste unserer lebenden Systeme ist“, schreibt der renommierte englische Umweltjournalist George Monbiot in seinem Buch „Neuland“ – „und wir behandeln ihn wie Dreck“, bestenfalls wie „totes, passives Substrat“.[4] Die Folge sind Wassermangel, Artensterben, drohende Nahrungsmittelknappheit.
Die US-Amerikaner haben das schon einmal erlebt, nämlich in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, als sich weite Teile der Great Plains nach einer Dürre in eine Staubwüste verwandelten – nachdem das Präriegras gerodet und der Boden falsch beackert worden war. John Steinbeck hat in seinem Roman „Die Früchte des Zorns“ über die „dust bowl“ und die Not, die sie ausgelöst hat, geschrieben. Daran erinnert man sich jetzt angesichts der dramatischen Bedrängnisse und Konflikte in Teilen des Globalen Südens. Dort holen Kleinbauern, um die sich jahrzehntelang kein Staat mit Beratung und Hilfe gekümmert hat, aus dem Boden, was geht – bis nichts mehr geht. Der Klimawandel verschärft die Degradierung. Schon bis 2050 werden laut dem Weltatlas der Deserfitikation 500 bis 700 Millionen Menschen gezwungen sein, ihre Dörfer zu verlassen, weil ihr Land sie nicht mehr ernähren kann.[5]
Dabei werden gute Böden dringend gebraucht, um die vielen, lange bekannten und mittlerweile existenziellen Krisen zu lösen. Ohne gesunde Böden keine Wälder, die wieder Wasser speichern und Wolken bilden, keine Feuchtgebiete und Wiedervernässung der Moore, keine Ausdehnung begradigter Flüsse, keine Erneuerung der Anbausysteme, keine Rettung der biologischen Vielfalt mit summenden Wiesen, keine Steigerung der ökologischen Funktionen von Nutzflächen und Naturräumen. Längst geht es darum, die Böden, die alle Ökosysteme miteinander verbinden, nicht mehr nur zu erhalten, sondern sie zu erneuern. George Monbiot schreibt kategorisch: „Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Flächennutzung die wichtigste aller Umweltfragen ist.“
Die Ironie der Geschichte: Die Art der Landnutzung ist sowohl die Ursache für die sozialen und ökologischen Krisen als auch der Kern der Lösung. Dieses komplexe Überlebensprojekt ganz neu zu steuern, ist tatsächlich entscheidend, es ist eine politische Mammutaufgabe. Und diese Aufgabe ist hochbrisant. Schließlich geht es dabei auch um eine im kapitalistischen System besonders heilige Kuh: das Eigentum. Die Eigentumsfrage ist der eigentliche Elefant im Raum – weil man immer noch nicht gern darüber redet, dass die Verfügungsmacht über Eigentum beschränkt werden müsste, wenn die Grundlagen des Lebens geschützt werden sollen. Geschieht dies nicht, droht eine fatale Refeudalisierung des Landes, national wie weltweit.
In Deutschland implodiert der Konflikt im Spannungsfeld zwischen zweiArtikeln des Grundgesetzes. Auf der einen Seite schützt der Staat laut Artikel 20a „auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere“. Auf der anderen Seite gewährleistet Artikel 14 das Eigentums- und Erbrecht. Allerdings mit einer oft übersehenen Einschränkung, die es in sich hat: „Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ Diese Anforderung empfinden die einen als Übergriff auf ihre Freiheit. Sie sehen die Entscheidung darüber, wie man Land und Boden nutzt, allein in der Macht und Verantwortung der Eigentümer:innen. Die anderen wertschätzen den Boden vorrangig als existenzielles Gemeingut.
Worauf es heute und in Zukunft ankommt, ist eine entschiedene Politik für den Boden, national wie international. Über Jahrzehnte haben die meisten Regierungen diese Aufgabe massiv vernachlässigt. Man erkennt es schon daran, dass Land und Boden im Gegensatz zum Wasser, zum Klima oder auch zur Artenvielfalt lange durch kein starkes globales Abkommen geschützt worden sind. Ihrem Erhalt diente nur die UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung. Aber deren Programme widmeten sich, noch dazu beschämend unterfinanziert, vorrangig Ländern wie Burkina Faso oder Mauretanien, die seit jeher in aller Härte mit den Folgen von Erosion und Austrocknung konfrontiert sind.
Erst seit sich auch im Mittelmeerraum Wüsten entwickeln und Dürren sich bis nach Deutschland auszubreiten drohen, seit der Boden von Indien über die Po-Ebene bis zu den amerikanischen Great Plains geringere Ernten bringt, verhärtet, erodiert, weggeschwemmt wird und zugleich auf der Positivseite endlich auch als Gesundheitsquell, Kohlenstoffspeicher und damit Klimaschützer anerkannt wird, rückt seine Erneuerung auf unterschiedlichen Ebenen in den Fokus der politischen Aufmerksamkeit. Seit 2015 ist der Boden in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen verankert, auch in der UN-Klimarahmenkonvention wurde er zum Thema. Der Ruf nach einer umfassenderen globalen Boden-Konvention wird zum Glück lauter. Mit dem europäischen Green Deal soll nun endlich auch eine EU-Bodenschutz-Richtlinie verabschiedet werden, wenngleich sich der vorliegende Entwurf bisher vor allem auf Messungen und Monitoring beschränkt.
Um die gefährdeten Böden – unsere Lebensgrundlage – wirklich zu schützen, bräuchte es wirksame Auflagen für ihre Wiederbelebung, einen De-facto-Stopp für jede neue Versiegelung, eine Obergrenze für die Größe einzelner Besitztümer, damit auch kleine und mittelständische Betriebe erhalten bleiben. Bislang haben sich die Bundes- und Landesregierungen an solche Ziele jedoch noch nicht herangewagt. Hoch bedeutsam für die Qualität der Böden sind zudem die europäische Agrarreform und die Renaturierungs- und Natur-Flächen-Gesetze, die gerade abgestimmt werden. Große Hoffnung auf Besserung besteht nicht, gemessen am aktuellen Fokus der Koalition auf einen flächenfressenden, planungsbeschleunigten Infrastrukturausbau. Gemessen auch daran, dass der Bundeshaushalt mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom November 2023 zur Finanzierung des Klima- und Transformationsfonds unter heftigen Druck geraten ist.
Immerhin widmen sich neben den Regierungen und Parlamenten auch immer mehr gesellschaftliche Initiativen dem Ziel, die Wirtschaft, vom Boden her gedacht, im Wortsinn Grund-legend umzugestalten. Zusammendenken, das ganze System in den Blick nehmen: das ist angesichts der beschriebenen Konflikte und Widersprüche eine Schlüsselqualifikation der Zukunft. Dass an einem solchen geerdeten Rundumblick kein Weg vorbeiführt, hat der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen der Bundesregierung (WBGU) bereits 2020 in seinem Gutachten „Landwende im Anthropozän“ gefordert. Die unterschiedlichen Formen, Land zu nutzen, müssten sich „von der Konkurrenz zur Integration“ bewegen, heißt es darin. Gesetze, Planung und Praxis sollten mit Vorrang „Mehrgewinnstrategien“ vorantreiben, also praktische Lösungen und Programme, die viele Probleme und mehrere Wenden zugleich hebeln.
Solche „soziotechnischen“ Innovationen sind oft experimentell, auch sie können im Gewirr der Zielkonflikte unvorhergesehene Nebenwirkungen mit sich bringen. Die systemischen Reformen erfordern daher auch neue wissenschaftliche Begleitgremien, Entscheidungs- und Korrekturwege, zudem eine politische Fehlerkultur und so viel demokratische Beteiligung wie möglich. Je mehr Augen auf ein Problem schauen, je mehr Menschen mitreden, desto schärfer wird der Blick fürs falsche Detail und richtige Ganze. Für die „Landwende zur Nachhaltigkeit“ seien „politischer Wille, Kreativität und Mut“ gefordert, schreiben daher die Gutachter des WBGU: „Es braucht Pionier:innen, die neue Wege testen und beschreiten, Staaten, die Rahmenbedingungen setzen, notwendige Maßnahmen durchsetzen und miteinander kooperieren, sowie Mechanismen eines gerechten Ausgleichs zwischen Akteuren.“
»Landwende im Anthropozän« – Vorrang für »Mehrgewinnstrategien«
Doch wo waren der erforderliche politische Mut und Wille zur Umsetzung der Vorgaben? „Die vermag ich bislang nur bei wenigen Themen zu erkennen“, resümierte die Umweltjuristin und Co-Vorsitzende des WBGU, Sabine Schlacke, drei Jahre nach Erscheinen des Gutachtens.
In der politischen Praxis erweist sich auch die schöne Formel des WBGU, die Transformation müsse „systemisch, synergistisch, solidarisch“ in Angriff genommen werden, bislang als schöner Traum. Statt integrierter Planung gilt meist noch immer: Klima first, Artenschutz second. Das ist das Gegenteil von Zusammendenken, es ist ein Rückschritt ins Eindimensionale.
Dieser Rückschritt hat viele Gründe: Die Pandemie, Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, als Folge die weltweite Inflation und dann seit Oktober 2023 der Nahostkonflikt haben mit kurzfristigen Prioritäten die langfristigen Notwendigkeiten zu einem Teil wieder in die zweite Reihe gedrängt. Aus einem schnell aufgelegten Sondervermögen sind 100 Milliarden in die Verteidigung geflossen, und als „first“ gilt jetzt die Geopolitik.
Zweitens sind die ökologischen Probleme drei Jahrzehnte lang aufgeschoben worden, obwohl der Handlungsdruck im Anthropozän größer ist „als je zuvor in der Menschheitsgeschichte“, schreiben die Gutachter des WBGU. Die Konsequenz dieser Verdrängung: Die Zielmarke 2030, die für den Green Deal und viele andere Herausforderungen festgelegt wurde, lässt in Europa nur noch sechs Ernten und eineinhalb Legislaturperioden Zeit. Dass dementsprechend nun alles gleichzeitig geschehen muss, überfordert viele.
Drittens denken und wirken Wissenschaftlerinnen, Ministerialbeamte, Manager, Naturschützerinnen oder Bauernverbandsfunktionäre meist in den Logiken ihrer Organisationen. Den eigenen Silo zu verlassen, die anderen Perspektiven in Entscheidungen einfließen zu lassen, ist kaum eingeübt.
Viertens sind die Verwaltungen kolossal überfordert. Ihnen fehlen Mitarbeiter, die einen schon jetzt detailwütigen Regelwust praktisch umsetzen und seine Einhaltung kontrollieren sollen; ganz zu schweigen von fachübergreifenden Planungsnetzwerken.
Schließlich der fünfte und letzte Grund: Das alte System leistet erheblichen Widerstand. In allen Industrien gilt zwar Nachhaltigkeit mittlerweile als „Megatrend“. Aber Lobbyisten der herkömmlichen Energie-, Finanz- und Agrarsysteme blockieren immer wieder Innovationen, die auf der Höhe der Probleme stehen, sie diffamieren soziale Ansätze und versuchen stattdessen, vermarktbare technologische Lösungen durchzusetzen. Diese folgen oft eher einer wirtschaftlichen Logik als jener der Nachhaltigkeit.
Die Folgen sind fatal: Immer schneller geben die Beschleunigung des Klimawandels und des Artensterbens, die Digitalisierung, die Globalisierungs- und Renationalisierungsprozesse den Takt vor – während zugleich weite Teile der Gesellschaft die Dimension der Probleme noch immer verdrängen oder leugnen und bei Dürren nicht Hunger und Durst befürchten, sondern „leere Pools und Duschverbote“, wie das Magazin „Stern“ im Sommer 2023 warnte. Doch die strukturellen Probleme und existenziellen Gefahren bleiben, und es hilft nichts: Wir dürfen die Augen vor dem Druck auf Böden und Flächen nicht länger verschließen, sondern müssen es zum Thema machen, bei den Europa- und Landtagswahlen dieses Jahres, aber auch bei der nächsten Bundestagswahl: Wie lässt sich die enorme Komplexität der Grund- und Bodenfrage managen, wenn zugleich der Zeitdruck steigt? Und wie lässt sich verhindern, dass sich bei den erforderlichen Nutzungseinschränkungen Teile der Gesellschaft überfordert fühlen und nach rechts abdriften, so wie in der Bauern-Bürger-Partei in den Niederlanden oder wie hierzulande in der AfD?
Im Dickicht der enorm widersprüchlichen Aufgaben und Anfeindungen helfen vielleicht am besten jene Ratschläge, die Hermann Scheer, der SPD-Politiker, Vordenker und Gestalter des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, eines Exportwelterfolgs, sich und anderen gab: Nicht aufhören, unermüdliche Überzeugungsarbeit zu leisten. Den „Knackpunkt“ suchen. Sprich: Nicht überall gleichzeitig wirbeln, sondern Prioritäten setzen.
Bei Land und Boden liegt der Knackpunkt im „Dreieck der Nachhaltigkeit“. Viel zu lange wurden dabei der Ökologie, der Ökonomie und dem sozialen Ausgleich Gleichrangigkeit zugeschrieben. Dürren und Fluten, Stürme und Ressourcenkrisen ungeahnten Ausmaßes als Folgen des Klimawandels zeigen aber immer klarer, von Pakistan bis ins Ahrtal, von der Po-Ebene bis nach Kanada: Naturgesetze sind unerschütterlich. Wir müssen die Prioritäten unzweifelhaft klarer setzen: Ecology first. Es geht nicht mehr um die viel zitierte „Versöhnung“ von Ökonomie und Ökologie, das war schon immer ein Euphemismus. Denn ohne Ökologie keine Ökonomie und auch kein sozialer Ausgleich. Gerade wer sich mit dem Boden beschäftigt, diesem Medium des großen Zusammenhangs, der erkennt unmissverständlich: Wir leben zwar in einer üppigen, erfindungsreichen Natur, aber sie setzt uns harte Grenzen. Das mechanisch fortgeschriebene Wachstum des Bisherigen ist zukunftsblind, auch mit grünem Anstrich als green growth. Wir müssen vielmehr einen neuen „frugalen Wohlstand“ (Wolfgang Sachs) erfinden. Nur so werden wir den Problemen des Anthropozäns wirklich auf den Grund gehen, und nur so können wir den natürlichen Boden unseres Wohlstands nachhaltig schützen und bewahren.
Der Beitrag basiert auf „Der Grund. Die neuen Konflikte um unsere Böden – und wie sie gelöst werden können“, dem neuen Buch der Autorinnen, das am 14. März im Verlag Antje Kunstmann erscheint.
[1] David Montgomery, Dreck: Warum unsere Zivilisation den Boden unter den Füßen verliert, München 2010.
[2] UNCCD, Konvention der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Desertifikation in den von Dürre und/oder Desertifikation schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika, unccd.int.
[3] 200 Naturschützer im vergangenen Jahr getötet, faz.net, 29.9.2022.
[4] George Monbiot, „Neuland: Wie wir die Welt ernähren können, ohne den Planeten zu zerstören“, New York 2022.
[5] Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU), Landwende im Anthropozän: Von der Konkurrenz zur Integration, wbgu.de, 2020.