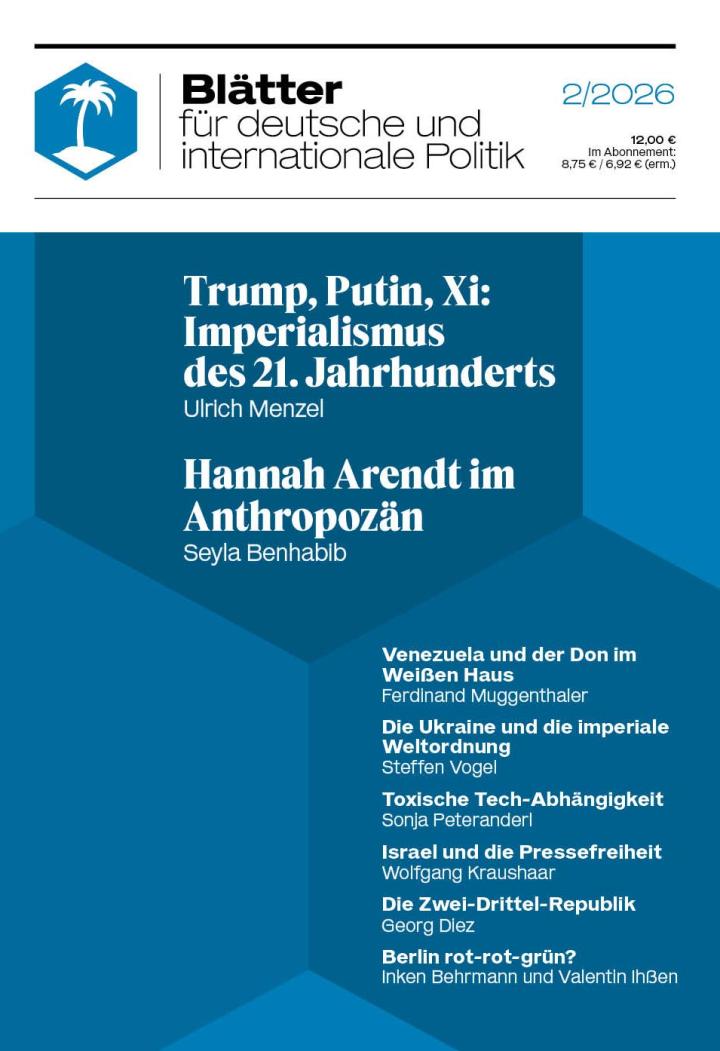Bild: Ein Strahlenwarnzeichen am Waldrand (IMAGO / Depositphotos)
Auch wenn immer wieder manche einer Renaissance der Atomkraft das Wort reden: Der hiesige Ausstieg von 2023 ist längst irreversibel. Denn weder lassen sich die stillgelegten Atomkraftwerke (AKW) technisch wieder hochfahren noch wären Neubauprojekte für die Energieversorgung in Deutschland kurz- und mittelfristig von Relevanz. Verzögerungen und Kostensteigerungen aufgrund immer neuer Probleme beim AKW-Bau in Frankreich (Flamanville, Block 3) oder Großbritannien (Hinkley Point C) zeigen dies nur zu deutlich.
Ohnehin neigt sich die Zeit fossil-nuklearer Energiegewinnung in Großkraftwerken dem Ende zu.[1] Was bleibt, ist jedoch der Atommüll, der seit 1961 auch in deutschen AKW erzeugt wurde. Über Jahrzehnte behaupteten Akteur:innen aus Politik und Unternehmen, unterstützt durch die Wissenschaft, die Entsorgung radioaktiver Abfälle sei kein Problem. Das war schon immer falsch. Doch erst der Atomausstieg ließ die Schwierigkeiten und Komplika-tionen offen zutage treten.[2] Denn nun besteht vonseiten der Unternehmen kein wirtschaftliches Interesse mehr, die Müllproblematik schönzureden, für die nicht einmal die vehementesten AKW-Optimist:innen bis heute eine Lösung haben.
Das Entsorgungsproblem untergräbt auch die – ohnehin haltlose – Behauptung extrem niedriger Energiepreise (too cheap to meter) durch Atomstrom weiter. Die Kosten für eine möglichst sichere Langzeitlagerung, für die politisch-administrativen Verwaltungs- und Begleitprozesse, für gesellschafts- wie naturwissenschaftliche Forschungsprojekte sowie den Schutz der Lager vor inneren und äußeren Gefahren werden ins Unermessliche steigen. Weder die zuständigen staatlichen Behörden noch das Bundesumweltministerium haben bisher eine Gesamtaufstellung dazu vorgelegt. Auch das sogenannte Standortauswahlgesetz (StandAG), das 2013 unter der schwarz-gelben Regierung erstmals verabschiedet und seitdem mehrfach geändert wurde, konnte hier kaum Planungssicherheit schaffen.
Dabei ist die Aufgabe klar: Der Müll muss für eine Million Jahre so sicher wie nur möglich von Menschen und der Umwelt abgeschottet werden, so sieht es auch das Gesetz vor. Insgesamt 650 000 Kubikmeter Atommüll an mehr als 70 oberirdischen Lagerstätten bergen schon jetzt erhebliche Sicherheitsrisiken. Rund vier Prozent davon – 27 000 Kubikmeter – sind hochradioaktiver Abfall, verteilt auf etwa 1750 Transportbehälter, die sich nicht zur langfristigen Lagerung eignen. Wie lange diese Behälter dicht bleiben, kann niemand sagen. Auch worin, wo genau und wie der Atommüll zukünftig (end-)gelagert werden soll, ist noch immer ungeklärt.[3] Dafür wird immer deutlicher, dass der Ansatz, Atommüll erst zwischen- und dann endzulagern, wie ihn Politik und Energieunternehmen in Deutschland seit Jahrzehnten verfolgen, in der Praxis nicht zum Ziel führt. Auf diesen »Scherbenhaufen« wurde immer wieder hingewiesen.[4] Zu gravierend sind die Probleme der Standortsuche und zu ungewiss die bisherigen Zeitpläne, um daran festhalten zu können.
Zum Handeln verdammt
Den kurzfristigen hohen Profiten (private goods) der Energieversorgungsunternehmen durch die Atomenergie stehen die gesellschaftlichen Kosten (public bads) gegenüber, die im Umgang mit deren Hinterlassenschaften anfallen werden. Die nachfolgenden Generationen wurden nicht mitberücksichtigt – nicht hinsichtlich der Schäden beim Uranabbau, nicht im Hinblick auf die Langzeitwirkungen von Nuklearkatastrophen oder des strahlenden Atommülls. Das Verursacherprinzip, nach dem derjenige, der den Dreck erzeugt hat, ihn auch wegmachen muss, ist bei vielen solcher Umweltlasten reine Illusion.
Generationenübergreifende Probleme mit hundert- und tausendjährigen Langzeitfolgen sind längst zur neuen, katastrophalen Normalität auf unserem Planeten geworden: Der Anstieg der Meeresspiegel, die Wüstenbildung als Folge des Klimawandels, abgeholzte Regenwälder oder die Vermüllung des Planeten mit Chemikalien und Plastik prägen die Menschheitsgeschichte und begrenzen die Handlungs- und Möglichkeitsräume zukünftiger Generationen immer stärker.
Diese Folgeschäden der kapitalistischen Produktions- und Konsumweise sind wie der böse Geist, der sich, wenn er erst einmal aus der Flasche gelangt ist, kaum wieder einfangen lässt. Auch das nukleare Erbe verdammt die uns nachfolgenden Generationen zum Handeln: Sie müssen über eine unbestimmbare Zeit hinweg verhindern, dass atomare Strahlung austritt, und sind zu weitreichenden Anpassungen an Schäden gezwungen, die wir durch unseren hohen Verbrauch fossil-nuklearer Energieträger verursacht haben.
»Schnellstmöglich« ist relativ
Die Energieversorger Vattenfall, Eon, RWE und EnBW als Betreiber der deutschen AKW haben 2016 einen Deal mit der damaligen schwarz-roten Regierung geschlossen und sich 2017 durch eine Ablasszahlung in Höhe von rund 24 Mrd. Euro aus der Verantwortung gekauft. Für die riskanten und kostspieligen atomaren Altlasten ihres profitablen Geschäfts sind sie nun nicht mehr zuständig. Das war strategisch geschickt. Sie wussten am besten, dass die Entsorgung radioaktiver Abfälle eine schier unlösbare und gesellschaftlich konfliktreiche Aufgabe ist. Nur den Rückbau der AKW müssen sie noch bewerkstelligen und finanzieren. Den Umgang mit dem Atommüll und alle weiteren Entsorgungsschritte muss dagegen nun der Staat regeln. Er muss sich auch mit der Frage der Akzeptanz beschäftigen, die dessen Lagerung vor allem an den derzeitigen Standorten aufwirft. Denn auch wenn die Radioaktivität in einigen Jahrzehnten durch Zerfallsprozesse abnimmt, bedeutet das nicht unbedingt einen Sicherheitsgewinn: Behälter und Gebäuden altern, hinzu kommen Bedrohungen von außen, etwa durch panzer-brechende Waffen oder sprengstoffbeladene Drohnen.[5]
Deshalb soll der Atommüll schnellstmöglich unter die Erde. »Schnellstmöglich« ist im Umgang mit atomaren Abfällen jedoch relativ, denn die Standortauswahl für ein geologisches Tiefenlager verzögert sich immer weiter: 2017 hieß es, über den Standort werde 2031 entschieden, 2022 sollte es 2064 so weit sein, und nur zwei Jahre später wurde schließlich 2074 als möglicher Zeitpunkt genannt. Solche Verzögerungen sind bei Nuklearprojekten nicht die Ausnahme, sondern der Normalfall – auch in Deutschland.
Zwei Beispiele belegen das: Das ehemalige Eisenerzbergwerk Schacht Konrad im niedersächsischen Salzgitter ist als Atommülllager für leicht- und mittelradioaktive Abfälle vorgesehen. Davon abgesehen, dass sich das geplante Fassungsvermögen bereits als zu gering herausgestellt hat, wurde der Starttermin für die Einlagerung schon mehrfach verschoben. Nun soll die Endlagerstätte Anfang der 2030er-Jahre in Betrieb genommen werden. Das wäre rund 20 Jahre später als ursprünglich geplant und 55 Jahre nach Beginn der Eignungsuntersuchung. Es könnte aber auch sein, dass der vorgesehene Standort sich als gänzlich ungeeignet erweist. Davon gehen Kritiker:innen des Projektes wie das »Bündnis gegen Schacht Konrad« jedenfalls aus.[6]
Zweites Beispiel: In die Schachtanlage Asse-II wurde unsachgemäß schwach- und mittelradioaktiver Atommüll gekippt. Die Abfälle in der absaufenden und einsturzgefährdeten Anlage müssen nun aufwendig geborgen werden. Ob das wirklich gelingt, wie lange es dauern wird und wie riskant es ist, steht nicht fest. Die Mitte der 1960er-Jahre angestrebte schnelle Lösung zur Atommüllentsorgung führt damit nun zu unabsehbaren Problemen und Sorgen für viele nachfolgende Generationen.
Was lässt sich daraus lernen? Selbst wenn irgendwann ein Standort für die Endlagerung atomarer Abfälle feststehen sollte, birgt der ober- und untertägige Bau der Lagerstätte weitere Ungewissheiten. Jahreszahlen geben Planungs- und Orientierungshilfen, die jedoch – je länger sie in die Zukunft reichen – substanzlos werden. Sie können nicht mit wissenschaftlichen Erkenntnissen unterfüttert werden. Dennoch wird damit Politik gemacht.
Klarer Fall von Fake News
Nachdem eine vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) in Auftrag gegebene Studie des Öko-Instituts 2024 zu dem Schluss gekommen war, dass »selbst bei einem idealen Projektablauf« damit gerechnet werden müsse, dass die Endlagersuche erst 2074 abgeschlossen werden könne, wurden Forderungen nach einer Beschleunigung des Standortauswahlverfahrens laut. Andernfalls könne es noch bis 2150 dauern, bis der letzte Atommülltransport ins Tiefenlager erfolgt ist.[7] Auch wenn alles (relativ) schnell gehen sollte, ist der Begriff der Zwischenlagerung des Atommülls irreführend und fehl am Platz: Er beschönigt die desaströse Lage aus ungeklärten Entsorgungsschritten und offenen wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und technischen Fragen. Die oberirdische Lagerung ist definitiv kein Zwischenstadium mehr für wenige Jahrzehnte wie ursprünglich geplant. Sie wird nach heutigem Kenntnisstand für weit mehr als ein Jahrhundert zur entsorgungspolitischen und dauerriskanten Normalität in Deutschland – speziell für die Kommunen mit entsprechenden Lagerstätten. Die Oberflächenlager müssen nämlich in Betrieb bleiben, bis auch der letzte Behälter abtransportiert wurde. Das könnte auch nach 2150 noch der Fall sein. Derzeit gilt nur: Der Transport des Atommülls ins Ausland ist ethisch nicht vertretbar und durch das Atomgesetz untersagt. Erzählungen, wonach atomare Abfälle künftig in sogenannten Small Nuclear Reactors (SMR) recycelt werden könnten, gehören ins Reich der Fake News: Solche Konzepte sind über Entwicklungs- und Modellentwürfe noch nie hinausgekommen.
Neue Sicherheitskultur vonnöten
Was ist die Konsequenz aus dieser katastrophalen Lage? Im Umgang mit den nuklearen Hinterlassenschaften sollten wir von der pessimistischen Annahme ausgehen, dass der Atommüll noch sehr lange oberirdisch gelagert wird. Vor diesem Hintergrund muss die Sicherheitskultur in Deutschland neu konzipiert und umgesetzt werden. Zum einen muss alles dafür getan werden, um den Austritt radioaktiver Strahlung aus alternden Behältern und Gebäuden zu verhindern. Zum anderen müssen die atomaren Lagerstätten besser vor Terrorattentaten, kriminellen Handlungen und kriegerischen Angriffen geschützt werden und sie dazu laufend auf den neuesten Stand von Wissenschaft und Technik gebracht werden. Ob dies funktionieren kann, wenn viele Maßnahmen der Geheimhaltung unterstellt und nicht öffentlich diskutiert werden, ist zumindest fraglich. Sollte der Atommüll sicher gelagert sein, spricht nichts gegen Transparenz. Die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen fordert eine »Neubewertung der Sicherheitslage«, und Anti-Atom-Initiativen verlangen ein neues Gesamtkonzept, das solchen Schwierigkeiten in der Planung und den neuen Gefahrenszenarien gerecht wird.[8] Der Umgang mit Atommüll muss als Daueraufgabe verstanden, laufend überprüft und von Berichtspflichten begleitet werden. Dabei ist es unerlässlich, die Öffentlichkeit zu beteiligen, Verfahrensbeschleunigungen und deren Kosten müssen begründet werden. Die Sicherheit an der Oberfläche darf nicht in der Hoffnung auf ein Tiefenlager in naher Zukunft vernachlässigt werden.
Daraus leiten sich grundsätzliche und weitreichende Überlegungen ab: Verstetigt sich die sogenannte Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle so weit, dass dazu ein oder zwei Neubauten für die Lagerung an der Oberfläche oder im nahen Untergrund nötig werden? Dies könnte der Fall sein, wenn sich die Möglichkeiten, bestehende Lager sicherer zu machen, baulich wie technisch als begrenzt erweisen. Dagegen spricht allerdings, dass dann Atommülltransporte erforderlich werden, die schon immer riskant und gefährlich waren. Und müsste nicht, weil sich Schacht Konrad als ungeeignet erweisen könnte, jetzt schon – ebenfalls aus Sicherheitsgründen – ein weiteres Suchverfahren gestartet werden, wie es die Initiative »ausgestrahlt« fordert?[9]
Die Alltags- und Fachbegriffe, mit denen Politik und Energieversorger den Atomstrom promotet haben, als in Deutschland noch AKW in Betrieb waren, müssen wir mehr denn je kritisch gegenlesen. Sie dienten nie dazu, die Wirklichkeit zu beschreiben, als vielmehr zur Beschönigung einer höchst umstrittenen Technologie. Nicht nur der Begriff »Zwischenlagerung« gehört dazu, sondern auch die vermeintlichen Lösungswege »Entsorgung« und »Endlagerung«. Ein schnelles, sorgloses Ende wird es nicht geben. Der »nukleare Dreck«[10] ist und bleibt für immer in der Welt.
[1] Vgl. Akademienprojekt »Energiesysteme der Zukunft« (ESYS), energiesysteme-zukunft.de.
[2] Vgl. Achim Brunnengräber, Ewigkeitslasten. Die »Endlagerung« radioaktiver Abfälle als soziales, politisches und wissenschaftliches Projekt, Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2019, bpb.de.
[3] Vgl. BGE, Die BGE zeigt, wo die Endlagersuche aktuell steht, bge.de, 3.11.2025.
[4] Vgl. Jochen Stay, Der große Atommüllpoker, in: »Blätter«, 10/2016, S. 29–32.
[5] Vgl. Oda Becker und Jutta Weber, Mögliche Auswirkungen von Terrorangriffen auf Zwischenlager für hochradioaktiven Abfall, ausgestrahlt.de.
[6] Dem Bündnis gehören u.a. an: die IG Metall Salzgitter-Peine, das Landvolk Braunschweiger Land, die Arbeitsgemeinschaft Schacht KONRAD und die Stadt Salzgitter, ag-schacht-konrad.de.
[7] Vgl. Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), Auftragnehmerin: Öko-Institut e.V., Unterstützung des BASE bei der Prozessanalyse des Standortauswahlverfahrens, Vorhaben FKZ 4718F10001, base.bund.de, Juli 2024.
[8] Vgl. Ursula Schönberger, Atommüll – Eine Bestandsaufnahme für die Bundesrepublik Deutschland, Salzgitter, atommuellreport.de.
[9] »ausgestrahlt-magazin«, Februar 2025, S. 11, ausgestrahlt.de.
[10] Elmar Altvater, Der nukleare Dreck muss weg oder: Ohne Externalitäten keine kapitalistische Moderne, in: Achim Brunnengräber und Rosaria Di Nucci, Im Hürdenlauf zur Energiewende, Wiesbaden, 2014, S. 401–412.