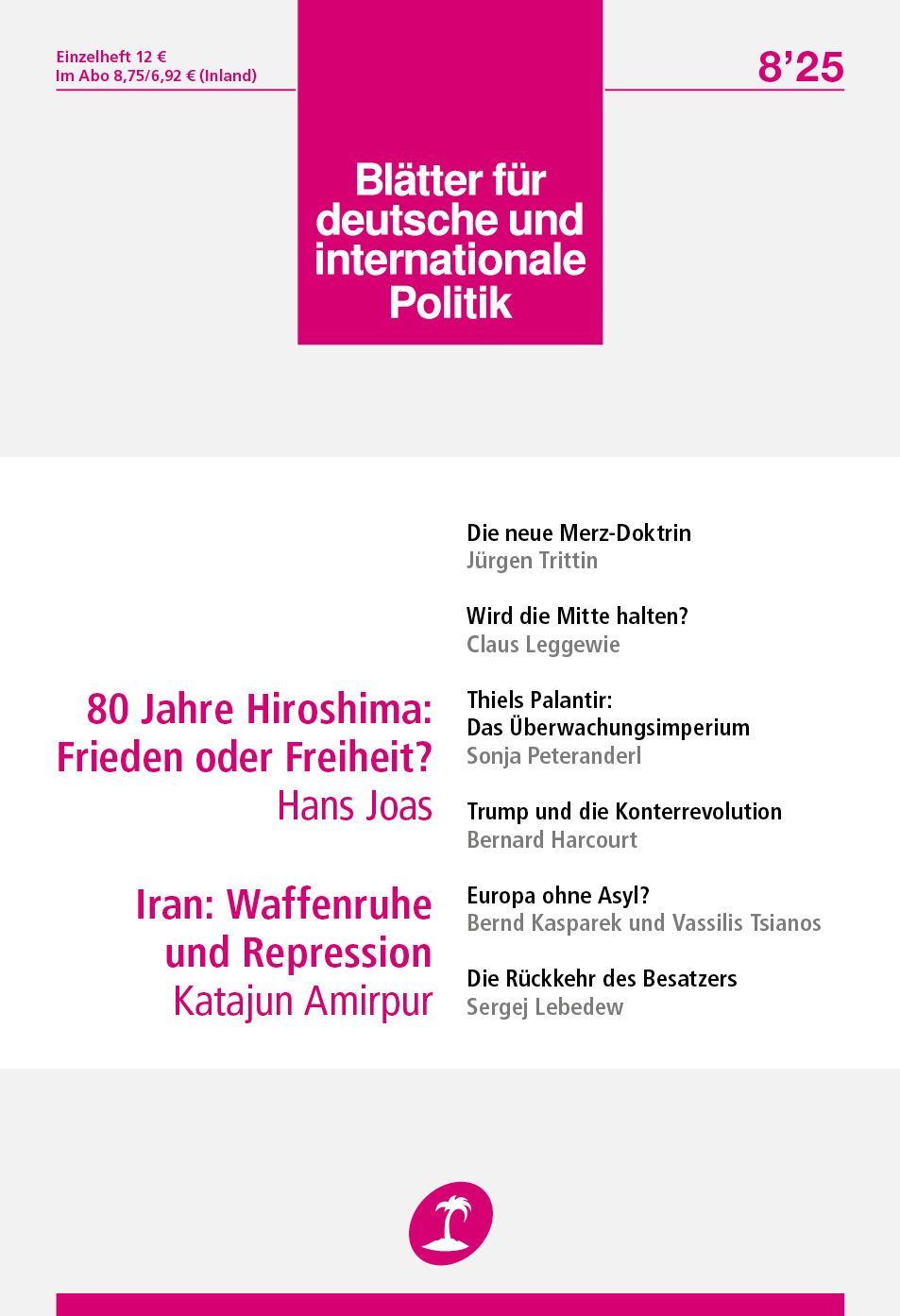Bild: Die Bismarckstraße in Berlin (IMAGO / Dirk Sattler)
Statt Tempo 30 soll in Berlin auf vielen Straßen wieder Tempo 50 gelten. Neue Busspuren oder Radstreifen werden von der Verwaltung blockiert, mancherorts werden fast fertige Fahrradstreifen wieder zu Parkplätzen umgewidmet. Auch das bundesweite Vorzeigeprojekt der Hauptstadt, der autofreie Abschnitt auf der Friedrichstraße, ist längst Geschichte: Wo früher auf Straßen Pflanzen und Bänke standen, auf denen Passant:innen unbehelligt von Lastern und Pkw verweilen konnten, fahren heute wieder motorisierte Fahrzeuge. Das Berliner Mobilitätsgesetz des ehemaligen rot-rot-grünen Senats galt bundesweit als vorbildlich für die Verkehrswende: weg von der „autogerechten Stadt“[1] hin zu einer klimagerechten, fahrrad- und fußgängerfreundlichen Politik. Doch nach sieben Jahren fällt die Bilanz ernüchternd aus: Bis 2030 sollte ursprünglich ein flächendeckendes Fahrradnetz mit einer Länge von fast 2700 Kilometern entstehen. Bis Ende 2024 waren jedoch lediglich 158 Kilometer fertig. Drei Jahre in Folge verlangsamte sich unter dem schwarz-roten Senat der Ausbau, 2024 kamen nur noch 20 neue Kilometer hinzu.[2] Auch im ersten Halbjahr 2025 passierte kaum etwas. Nicht nur in Berlin, auch im restlichen Deutschland stockt die Verkehrswende, während sie anderswo in Europa durchaus vorankommt.
Verkehrswende, das meint die Abkehr vom Prinzip der autogerechten Stadt – hin zu einer nachhaltigen Mobilität und einem neu verteilten öffentlichen Raum. Über mehr als ein halbes Jahrhundert hat die Stadtplanung die Bedürfnisse des motorisierten Verkehrs in den Mittelpunkt gestellt, in der alten Bundesrepublik wie auch in der DDR, trotz des dortigen hohen Stellenwerts des ÖPNV. Alte Bauten verschwanden, dafür entstanden vielerorts Stadtautobahnen, Netze von Schnellstraßen, Tangenten und innerstädtische Hochstraßen. Ebenso wie diese und andere Bausünden das Bild vieler Städte noch immer prägen, ist die autogerechte Stadt weiterhin im Denken von Entscheidungsträger:innen verankert, wie die Pläne für den Ausbau der Berliner Stadtautobahn mitten durch die Innenstadt und der Auto-Wahlkampf der Berliner CDU zeigen. „Berlin ist für alle da. Auch für Autofahrer“, plakatierte die CDU in der Hauptstadt – als wären Autofahrende eine schutzbedürftige Minderheit. Auch im Bundestagswahlkampf wandte sich die Union ausdrücklich gegen eine vermeintliche „Anti-Auto-Haltung“.
Beharrungskraft der Autolobby
Dabei können wir das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 nur mit einer anderen Verkehrspolitik erreichen. Und doch ändert sich an der Klimaschädlichkeit des Autoverkehrs bislang kaum etwas, die Klimaziele für diesen Sektor werden weit verfehlt, weil die bisherigen Bundesregierungen keine wirksamen Maßnahmen ergriffen haben, wie etwa rigidere Tempobegrenzungen. Auch die schwarz-rote Koalition im Bund hat nicht vor, eine Verkehrswende einzuleiten, im Gegenteil. Im Koalitionsvertrag bekennt sie sich zum Auto. Union und SPD wollen die Pendlerpauschale erhöhen, derweil die Zukunft des erfolgreichen Deutschlandtickets noch immer ungesichert ist. Der Bundesverkehrswegeplan mit zahlreichen Ausbauprojekten soll unverändert bestehen bleiben, obwohl er veraltet ist und die Klimaziele bei den Projektierungen noch keine Rolle spielten. Im Zuge der geplanten massiven Aufrüstung wird einmal mehr der Ausbau von Fernstraßen eine große Rolle spielen.
Kein anderer Bereich steht so für die Beharrungskräfte fossiler Geschäftsmodelle wie der Individualverkehr, das zeigt die immer wieder aufflammende Diskussion über das europaweite Ende für die Zulassung neuer Verbrennungsmotoren. Dieses ist für 2035 geplant, wird aber zunehmend infrage gestellt. Angesichts der Erderhitzung ist der Antriebswechsel jedoch ein unverzichtbarer Teil der Verkehrswende – auch wenn diese viel mehr beinhalten muss als das Ersetzen des Verbrennermotors durch einen Elektroantrieb. Die Ampel hatte das Ziel gesetzt, hierzulande bis 2030 15 Mio. E-Autos zuzulassen, und mit der abrupt gestrichenen Förderung für E-Autos nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts 2023 diesen Ansatz wieder abgewürgt. Die Zahl der Autos steigt derweil ungebrochen und liegt bei nahezu 50 Mio., das entspricht statistisch 1,2 Fahrzeugen pro Haushalt. 2023 verfügten nur noch 20 Prozent der Haushalte über kein Auto, 2017 waren es noch 22 Prozent.
Allerdings: Gewachsen ist auch die Fahrradflotte: von 75 Mio. im Jahr 2017 auf 81 Mio. im Jahr 2023, davon waren knapp ein Fünftel E-Bikes.[3] Doch die Infrastruktur für Räder wächst nicht mit. In dutzenden Städten brachten Bürger:innen daher sogenannte Radentscheide auf den Weg, um ihre Kommunen zum Ausbau zu bewegen.
Mehr Spielraum, aber kein Geld
Doch selbst da, wo sie erfolgreich sind, wie in Aachen, geht es nur langsam voran. Initiativen und Fahrradverbände müssen den Stadtverwaltungen jeden neuen Meter mühsam abtrotzen. Zwar verfügen die Kommunen seit 2024 über größere Spielräume bei der Verkehrsplanung[4], aber wie sich das auswirkt, wird sich erst in einigen Jahren zeigen, denn Verkehrsplanung läuft über einen langen Zeitraum. Bis 2024 galt – der Denkart der autogerechten Stadt entsprechend –, der uneingeschränkte Vorrang des fließenden Autoverkehrs. Die Folge: Wollten Kommunen etwa eine Schulstraße oder einen Zebrastreifen anlegen, mussten sie belastbare Gründe wie eine besondere Gefährdung vorweisen. Ansonsten drohten Projekte bei einer Klage von Gerichten kassiert zu werden. Jetzt dürfen Städte endlich auch Ziele wie Klimaschutz, Gesundheit oder die Stadtentwicklung als Grund angeben, um neue Busspuren oder Radwege zu bauen. Und doch bleibt der Umbau zäh; ein Grund dafür sind die klammen Kassen der Kommunen, die oft schon damit überfordert sind, die bestehende Infrastruktur instand zu halten. Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik stieg der Investitionsstau der Städte und Gemeinden im vergangenen Jahr weiter und liegt nun bei rund 216 Mrd. Euro. Neben Schulen sind Straßen davon besonders betroffen. Fast ein Drittel der Kommunen geht davon aus, dass sie den Unterhalt ihrer Straßeninfrastruktur nicht oder fast nicht mehr leisten können[5] – die finanziellen Spielräume für neue Radwege sind also eng.
Mindestens so gravierend wie fehlendes Geld sind weltanschauliche Motive, die die Verkehrswende blockieren. Sie ist zum Teil eines Kulturkampfes geworden. Jede noch so kleine Einschränkung, wie die Erhebung von kostendeckenden Parkgebühren oder die Einführung von Tempo-30-Zonen, wird schnell als Angriff auf die Freiheit der Autofahrenden interpretiert.
Immer wieder scheitern Versuche, etwas zu ändern – auch weil Kritiker:innen auf Rückenwind in der Öffentlichkeit hoffen können. Das kurzzeitige Projekt in der Kolumbusstraße im Münchner Süden, bei dem ein autofreies Areal in einer Wohngegend entstand, sorgte für bundesweites Aufsehen, weil sich einzelne Bürger:innen, flankiert von Boulevardmedien, lautstark dagegen wehrten und sogar von „Krieg“ sprachen. Der Kulturkampf ums Auto wird keineswegs nur von der politischen Rechten geführt. Ausgerechnet in Hannover, der einst ersten als autogerecht geltenden Stadt Deutschlands, haben die Sozialdemokrat:innen im Stadtrat die Koalition mit den Grünen aufgekündigt, um den Vorstoß des grünen Oberbürgermeisters Belit Onay für eine autofreie Innenstadt auszubremsen. Auch in Berlin zeigt die SPD keine Begeisterung für die Verkehrswende und lässt der CDU bei der Restauration der autofreundlichen Politik freie Hand.
Vorbilder Paris, London und Kopenhagen
Dass es anders geht, zeigt die französische Hauptstadt. Unter der seit 2014 amtierenden sozialistischen Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat Paris systematisch die Infrastruktur für den Radverkehr ausgebaut und den Autoverkehr eingeschränkt. 1996 gab es in Paris drei Kilometer Radwege, jetzt sind es viele hunderte. Autos dürfen in großen Teilen der Stadt nicht schneller als 30 Stundenkilometer fahren. Im vergangenen November hat Paris in den Arrondissements eins bis vier eine „Zone à Trafic Limité“ eingerichtet, die etwa 130 Kilometer Straße umfasst. Innerhalb dieser Zone soll es keinen Durchgangs-Autoverkehr geben. Anlieger und Lieferanten können die Straße weiterhin nutzen. Aus Lärmschutzgründen und um die Luftqualität zu verbessern, wurde die Höchstgeschwindigkeit auf der Pariser Stadtautobahn, dem Périphérique, auf 50 Stundenkilometer begrenzt. Spötter:innen monieren, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit dort wegen der vielen Autos oft ohnehin nur bei 40 Stundenkilometern liegt – aber gerade das soll sich ja ändern. Bereits jetzt sind 220 der rund 6000 Pariser Straßen autofrei und werden in „rue-jardins“ (Gartenstraßen) umgewandelt. Bei einer Bürgerbefragung im März 2025 sprach sich eine Mehrheit dafür aus, weitere 500 Straßen in „rue-jardins“ zu verwandeln. Allerdings war die Beteiligung gering. Besonders eindrücklich zeigte sich der Erfolg des Umbaus während der jüngsten Hitzetage im Juli – die vielen neuen Grünflächen und Bäume sorgen schon jetzt für ein sehr viel angenehmeres Stadtklima. Auch die Schadstoffbelastung ist massiv zurückgegangen.
Eine entscheidende Stellschraube für die Verkehrswende ist die Parkraumbewirtschaftung. Je mehr und je billiger Abstellraum zur Verfügung steht, desto größer ist der Anreiz, einen Pkw zu nutzen. In Deutschland ist öffentliches Parken erst seit 1966 erlaubt, bis dahin mussten Halter:innen ihr Auto auf privaten Flächen abstellen.[6] Das ist heute unvorstellbar. Dabei nehmen stehende Autos nicht nur Platz weg, sie sind für Fußgänger:innen und Radfahrende eine größere Gefahr als lange angenommen, wie die Unfallforschung der deutschen Versicherer festgestellt hat. Bei fast einem Fünftel der Unfälle, in die Angehörige dieser beiden Gruppen verwickelt sind, ist ein parkendes Auto beteiligt.[7] In Paris sollen zehntausende Parkplätze wegfallen und der frei werdende Platz für Grünflächen, Spielplätze oder Radwege genutzt werden. Parken ist dort teurer geworden, außer für E-Autos. Sind sie leichter als zwei Tonnen und registriert, dürfen sie kostenlos auf öffentlichen Parkplätzen stehen. Die Gewichtsbegrenzung bevorzugt kleine Fahrzeuge, die Fahrer:innen schwerer E-SUVs kommen also nicht in den Genuss der Vergünstigung. Auch bei konventionellen Autos spielt das Gewicht für die Parkgebühr eine Rolle. Bei Verstößen werden Strafen bis 225 Euro fällig.
Auch die britische Hauptstadt London versucht, den Autoverkehr zurückzudrängen. London erhebt seit 2003 eine City-Maut und hat 2019 eine Umweltzone eingerichtet – Fahrzeuge mit hoher Belastung müssen hier Gebühren zahlen. Bürgermeister Sadiq Khan (Labour) will, dass in der britischen Hauptstadt bis zum Jahr 2041 80 Prozent der Wege mit nachhaltigen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden. Die Grundlagen für Khans ehrgeizige Rad- und Luftreinhaltungspolitik wurden bereits unter seinem konservativen Vorgänger Boris Johnson gelegt. Der passionierte Radfahrer ließ Fahrradschnellstraßen bauen. Heute verfügt London über „Super Cycle Highways“, blau markierte Radwege, die das Zentrum mit den Außenbezirken verbinden. Etliche Straßen sind für Räder, aber nicht mehr für Autos zugänglich. Es gibt sogenannte Quietways: ruhige Routen durch Parks und verkehrsarme Straßen. Das Bike-Sharing-System mit 12 000 Fahrrädern und 800 Stationen ermöglicht es zudem, unkompliziert Räder zu nutzen.
Während Paris und London sich erst in diesem Jahrtausend auf den Weg einer Verkehrswende gemacht haben und trotz aller Fortschritte noch am Anfang stehen, hat Kopenhagen schon vor langem eine andere Richtung eingeschlagen. Auch hier galt einst das Paradigma der autogerechten Stadt. Heute pendelt fast die Hälfte der Bürger:innen mit dem Rad in die Stadt. Die dänische Hauptstadt gilt als eine der fahrradfreundlichsten der Welt. Am Anfang dieser Entwicklung stand nicht das Thema Umweltschutz, sondern Verkehrssicherheit. Die Infrastruktur wird seit Jahrzehnten gut ausgebaut. Mehr als 80 Prozent der Radwege sind baulich von der Autostraße und vom Gehweg getrennt. Neue Radwege haben in Kopenhagen eine Breite von vier Metern – damit es bei steigenden Nutzer:innenzahlen nicht zu gefährlicher Enge kommt. Die Stadt verfügt zudem über mehrere autofreie Zonen, die weiter ausgebaut werden sollen.
Auch die Innenstadt von Oslo ist nahezu autofrei. Als Sehnsuchtsort für Radfahrende gelten seit langem überdies die Niederlande. Dabei gibt es auch dort sehr viele Autos. Aber es ist im Nachbarland gelungen, den Autoverkehr weitgehend aus den Innenstädten herauszuhalten und eine flächendeckende Radinfrastruktur einschließlich Fahrradparkhäusern und Reparaturmöglichkeiten einzurichten. Begonnen hat der massive Ausbau bereits in den 1970er Jahren – als in Deutschland noch das Primat der autogerechten Stadt galt. Nachdem im Jahr 1971 400 Kinder im Straßenverkehr ums Leben kamen, formierte sich die Bewegung „Stop de Kindermoord“. Aktivist:innen forderten sicherere Straßen. Dieser Druck und der Ölschock 1973 führten dazu, dass die niederländische Regierung und die Kommunen erfolgreich neue Wege in der Verkehrspolitik und Stadtplanung einschlugen.
In Deutschland hingegen prägen die alten Beharrungskräfte noch immer die Politik. Das wird sich trotz verbindlicher Klimaschutzvereinbarungen wohl erst ändern, wenn die Bürger:innen es noch energischer als bisher fordern.
[1] Hans Bernhard Reichow, Die autogerechte Stadt. Ein Weg aus dem Verkehrs-Chaos, 1959.
[2] Vgl. Verkehrswende-Monitor Berlin, changing-cities.org, 31.12.2024.
[3] Vgl. Robert Follmer, Mobilität in Deutschland – MiD Kurzbericht, mobilitaet-in-deutschland.de, 5/2025.
[4] Vgl. Verkehrswende: Endlich mehr Spielräume für Städte und Gemeinden, umweltbundesamt.de, 26.7.2024.
[5] Vgl. KfW Bankengruppe (Hg.), KfW-Kommunalpanel 2025, difu.de, 6/2025.
[6] Vgl. Andreas Knie, Deutschlands Weg in die Automobilgesellschaft, in: „Aus Politik und Zeitgeschichte“, 51-52/2023, S. 9-15.
[7] Vgl. Unfallrisiko Parken für schwächere Verkehrsteilnehmer, udv.de, Januar 2020, S. 112.