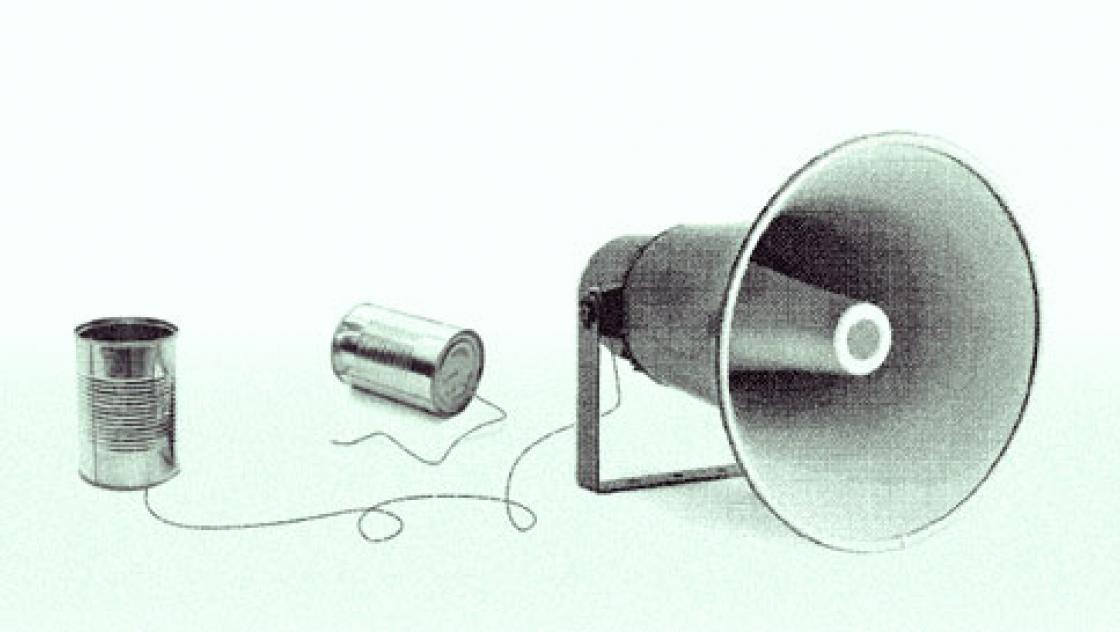Warum wir Whistleblower brauchen
Die beste Informationsquelle über öffentliche Verschwendung, Betrügerei und Täuschung ist regelmäßig ein öffentlicher Angestellter, der zu öffentlicher Integrität verpflichtet und aussagebereit ist. Solch mutiges und patriotisches Handeln, das manchmal Leben und häufig die Dollars der Steuerzahler retten kann, sollte angeregt und nicht unterdrückt werden.“[1] Mit diesen Worten bekannte sich US-Präsident Barack Obama im Jahr 2008 vollmundig zur Unterstützung des Whistleblowings. Doch offenbar, das lehren die jüngsten Enthüllungen durch Edward Snowden, gilt dies nur solange, wie sich das Whistleblowing nicht gegen die Logik des Überwachungsstaates wendet. Dabei ist es mittlerweile unbestritten, dass Whistleblowing Rechtswidrigkeiten und gesellschaftliche Missstände wirksam ins öffentliche Bewusstsein rücken kann – und zwar über staatliche Grenzen hinaus. Griff das klassische Whistleblowing noch vornehmlich auf Printmedien im nationalen Diskussionsrahmen zurück, entfaltet das Whistleblowing des 21. Jahrhunderts spätestens seit den Enthüllungen des WikiLeaks-Sprechers Julian Assange, des WikiLeaks-Informanten Bradley Manning und des US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden weltweit seine Kraft.