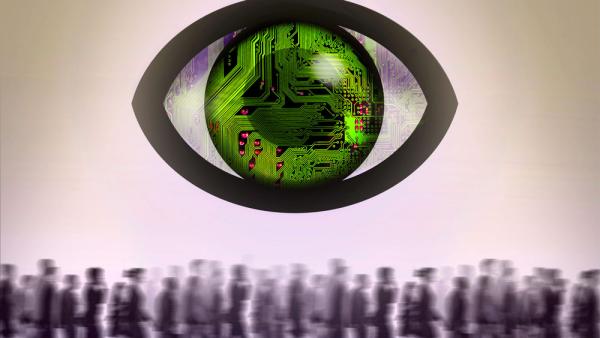Du setzt Deine Brille oder Dein Headset auf und befindest Dich sofort in Deinem digitalen Zuhause.“ Mit diesen Worten lüftete Mark Zuckerberg Ende Oktober den Vorhang zum Metaverse.[1] Die virtuelle Welt ist das Zukunftsprojekt von Meta Platforms, Facebooks neuem Mutterkonzern, der ab sofort alle Unternehmensbereiche unter einem Dach versammelt, darunter auch Facebook, Instagram und WhatsApp.
Diese drei Plattformen, das zeigt auch die neue Holding, sind in der Unternehmensstrategie in die zweite Reihe gerückt. An erster Stelle steht fortan die dreidimensionale Comicwelt des Metaverse. Bereits in fünf Jahren werden wir dort, so prognostiziert es Zuckerberg, als Avatare – also in Gestalt virtueller Doppelgänger – arbeiten, Freunde treffen, spielen und einkaufen. „Du kannst im Metaverse alles tun, was Du Dir vorstellst“, schwärmt der Facebook-Gründer. „Du wirst die Welt reichhaltiger als jemals zuvor erleben.” Ohne zusätzliche Technik geht das natürlich nicht: Um in den Genuss der virtuellen Freiheiten zu kommen, müssen Nutzer spezielle, mit Brillen und Kopfhörern ausgestattete Headsets tragen. Zudem können sie mit Hilfe von Metas Virtual-Reality-Plattform Horizon eigene digitale Räume erschaffen.
Die Vision einer solchen Parallelwelt ist keineswegs neu. Erstmals findet sich der Begriff „Metaverse“ in Neal Stephensons Cyberpunk-Roman „Snow Crash“ aus dem Jahr 1992. Darin taucht der Pizzalieferant und Hacker Hiro immer wieder in ein gleichnamiges computergeneriertes Universum ein, um der tristen wie bedrohlichen Realität zu entfliehen. In der Techbranche wird Stephenson, der neben dem Metaverse auch das Konzept des Avatars und die Kryptowährung erfunden haben soll, geradezu als Prophet verehrt. Auch in Facebooks Managementteam gilt „Snow Crash“ als Pflichtlektüre.
Zuckerberg will die Fiktion nun zur virtuellen Realität gerinnen lassen – und er glaubt fest an deren Erfolg: „Mit dem Metaverse schlagen wir das nächste Kapitel des Internets auf“, ist der Konzernchef überzeugt, „und es ist auch das nächste Kapitel für unser Unternehmen.” Aus diesem Grund wird Meta noch in diesem Geschäftsjahr mehr als 10 Mrd. US-Dollar in seine Metaverse-Abteilung Reality Labs investieren, 10 000 neue Arbeitsplätze sollen allein in Europa entstehen.
Auch wenn Zuckerbergs Ambitionen auf dem Feld der virtuellen Realität seit Jahren bekannt sind, kamen seine Ankündigungen zu diesem Zeitpunkt selbst für Branchenkenner überraschend. Denn das Metaverse ist bei weitem noch nicht marktreif. Vor allem aber steht Zuckerbergs zukunftsfrohe Präsentation im schroffen Gegensatz zu den Enthüllungen der Whistleblowerin Frances Haugen in den vergangenen Wochen. Und diese belegen eindrücklich, wie gefährlich die Idee einer von Mark Zuckerberg kontrollierten Parallelwelt ist.
Facebook Files: Profite über alles
Haugen war bis Ende Mai dieses Jahres als Teamleiterin der Einheit „Civic Integrity“ bei Facebook dafür zuständig, in dessen Netzwerken Falschinformationen, Gewaltaufrufe und Hassrede einzudämmen. Als die 37jährige jedoch erkannte, dass Facebook dieses Anliegen intern weit weniger ernst nimmt als das eigene Profitstreben, ging sie an die Öffentlichkeit: Ende September begann die Whistleblowerin, gemeinsam mit dem „Wall Street Journal“ die „Facebook Files“ zu veröffentlichen, eine Artikelserie über das skrupel- wie rücksichtslose Geschäftsgebaren ihres ehemaligen Arbeitgebers. Inzwischen kooperieren in den USA und Europa mehr als ein Dutzend Medienhäuser bei der Analyse der über 10 000 internen, von Haugen geleakten Dokumente, Studien und Memos.
Deren Berichte bestätigen zwar etliche der bekannten Vorbehalte gegen Facebooks Geschäftsgebaren. Allerdings beruhen sie nun erstmals auf Informationen, die dem tiefsten Inneren des Konzerns entstammen und damit dessen eigene PR gleich mehrfach Lügen strafen – nicht zuletzt das Narrativ, wonach Facebook/Meta eine harmonisch miteinander verbundene Welt anstrebe. Stattdessen ist nun der Nachweis erbracht, dass der Konzern wissentlich mit toxischen Produkten Profit macht – zum Schaden seiner Nutzerinnen und Nutzer, des öffentlichen Diskurses und der Demokratie.
So führt Facebook seit Jahren eine Liste mit Millionen Politikern, Prominenten und Unternehmen, die die Richtlinien des Netzwerks verletzen dürfen, ohne Sanktionen befürchten zu müssen. Unter ihnen findet sich auch das rechtsradikale Nachrichtenportal „Breitbart“, das damit im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl ungehindert Falschinformationen verbreiten konnte. Von Mitarbeitern intern geäußerte Bedenken, dass Facebook damit deren Ausgang beeinflusse, wurden schlicht beiseite gewischt. „Es wird ein kurzes Strohfeuer geben“, entgegnete Tucker Bounds, ein Kommunikationsbeauftragter von Facebook, den Kritikern: „Einige Abgeordnete werden sauer werden. Aber in einigen Wochen werden sie dann zu etwas anderem übergehen. In der Zwischenzeit drucken wir Geld und lassen es uns gut gehen.”
Zumindest mit Letzterem sollte Bounds recht behalten: Im Jahr 2020 betrug Facebooks Betriebsgewinn knapp 29,2 Mrd. US-Dollar. Politisch löste der Konzern statt eines Strohfeuers jedoch einen Flächenbrand aus: Denn nur wenige Wochen nach der Präsidentschaftswahl hob Facebook obendrein voreilig Maßnahmen auf, die Fake News eindämmen sollten – trotz der überaus angespannten Lage in den USA. Auch das Civic Integrity Team, dem Haugen angehörte, wurde Anfang Dezember aufgelöst. In der Folge konnte die „Stop the Steal“-Bewegung, die das amtliche Wahlergebnis anzweifelt und unbeirrt an Donald Trumps Wahlsieg glaubt, rasant anwachsen und am 6. Januar das US-Kapitol stürmen.
Auch mit Blick auf das Dauerproblem Hassrede handelt der Konzern seit Jahren wissentlich fahrlässig – und belog darüber die Öffentlichkeit. Zwar hatte Zuckerberg noch im vergangenen Jahr unter Eid vor dem US-Kongress ausgesagt, dass sein Unternehmen 94 Prozent der gefundenen Hassreden lösche, noch bevor ein Nutzer diese melde. Inzwischen aber wissen wir dank Haugen, dass tatsächlich weniger als fünf Prozent aller Hasskommentare auf Facebook entfernt werden.
Hinzu kommt, dass sich Facebook dabei vor allem auf den amerikanischen und europäischen Markt konzentriert. Insbesondere gegen Hetze, Rassismus und Aufwiegelungen in Afrika, Asien und dem Mittleren Osten unternahm der Konzern hingegen nur äußerst wenig, obwohl in diesen Weltregionen der Großteil seiner Nutzer lebt. Weil Facebook obendrein nicht gegen den in seinen Netzwerken blühenden Menschenhandel rechtloser Hausangestellter in Nordafrika und im Mittleren Osten vorging, drohte Apple dem Konzern zwischenzeitlich sogar damit, dessen App aus seinen App Store zu verbannen.
Gerade weil man bei Facebook sehr wohl weiß, welch toxischer Radikalisierungssog in dem Netzwerk wütet, hat man dort bislang auch systematisch jeden Versuch von Wissenschaftlern sabotiert, von außen Licht ins Dunkel des Konzerns zu bringen. Im April dieses Jahres löste Facebook beispielsweise das Team des von ihm 2016 aufgekauften Analysedienstes CrowdTangle auf. Dieser ermöglichte es Marketingabteilungen, jene Inhalte zu ermitteln, die in sozialen Medien die größte Resonanz erzeugen. Journalisten und Wissenschaftlerinnen nutzten den Dienst hingegen, um den Einfluss von Verschwörungserzählungen und Hassrede in dem Netzwerk zu untersuchen. Dem Facebook-Management missfiel das und es zog den Aufklärern kurzerhand den Stecker.
Meta als Befreiungsschlag?
Der Wucht der derzeit dicht aufeinanderfolgenden Enthüllungen hat der Konzern kaum etwas entgegenzusetzen. In den vergangenen Jahren entging Facebook weitreichenden Konsequenzen auch deshalb, weil sich im US-Kongress keine Mehrheit für eine striktere Regulierung oder gar Zerschlagung des Konzerns fand. Nun aber könnte sich das Blatt wenden. Republikaner wie Demokraten vergleichen Facebook zunehmend mit den großen Tabakunternehmen. Wie sie vertreibe auch der Techkonzern wissentlich ein Produkt, dass der Gesundheit schade, so der Vorwurf. Inzwischen haben Senatoren beider Parteien Gesetzentwürfe vorgelegt, die sozialen Plattformen wie Facebook strengere Regeln auferlegen sollen.
Somit steht der Konzern mehr denn je mit dem Rücken zur Wand – und hier kommt Meta ins Spiel. Denn ganz nach dem Motto „Gefällt Dir das Gespräch nicht, wechsle das Thema”, sollen die Umbenennung und das neue Großprojekt Metaverse gleich drei Probleme auf einmal lösen.
Erstens soll der neue Name das miserable Image des Konzerns wieder aufpolieren. Ein solches Vorgehen ist bereits von anderen Unternehmen erprobt worden: So änderte die private Sicherheitsfirma Blackwater gleich zwei Mal ihren Namen, um nicht länger mit der Tötung irakischer Zivilisten in Verbindung gebracht zu werden. BP versuchte sich im Jahr 2001 mit dem Firmennamen „Beyond Petroleum“ am Greenwashing. Und der Tabakkonzern Philip Morris benannte sich 2003 in „Altria“ um, um so eher mit Altruismus als mit Lungenkrebs assoziiert zu werden.
Auch Facebook geht es zunächst vor allem um eines: eine weiße(re) Weste. Denn hinter dem neuen Firmenschild bleiben sowohl die Produkte als auch die Machtverhältnisse unangetastet: Zuckerberg kontrolliert weiterhin rund 55 Prozent der Stimmrechte, er bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats und wird zudem Vorstandschef der Holding. Besonders erfreulich ist aus Zuckerbergs Sicht jedoch, dass künftig nicht mehr er persönlich den Gang nach Washington antreten muss, um sich für Facebooks Versäumnisse zu rechtfertigen. Stattdessen wird sein noch zu benennender Nachfolger an der Facebook-Spitze den Abgeordneten im Kongress Rede und Antwort stehen müssen. Mit anderen Worten: Zuckerberg hat sich mit der internen Umstrukturierung kurzerhand selbst aus der Schusslinie genommen, behält aber seine Macht und kann sich künftig voll und ganz dem Aufbau seines Metaverse widmen. Damit aber beweist er einmal mehr, dass er weder Schuldbewusstsein noch Verantwortung oder gar Reue für den gewaltigen Schaden empfindet, den sein Unternehmen in den vergangenen Jahren weltweit angerichtet hat.
Verlorene Jugend
Zweitens soll das Metaverse die sich zuspitzende demographische Krise des Konzerns bewältigen. Seit 2019 sind 13 Prozent der Facebook-Nutzerinnen und -Nutzer unter 30 Jahren zu Netzwerken wie TikTok oder Snapchat übergelaufen, Tendenz deutlich steigend.[2]
Verantwortlich dafür sind vor allem fehlende Innovationen. Seit seiner Unternehmensgründung im Jahr 2004 hat Facebook – bis auf die Einführung des News-Streams im Jahr 2006 und des Like-Buttons drei Jahre später – weder am Produkt noch an seinem Markenkern viel verändert. Statt selbst erfinderisch zu sein, kaufte Zuckerberg 2012 bzw. 2014 Instagram und WhatsApp ein, viele weitere Funktionen kopierte der Konzern von der Konkurrenz.
Das Metaverse soll Meta nun vor allem bei Jüngeren wieder hip und attraktiv machen. Zuckerberg glaubt fest an den Erfolg: „Wir sind überzeugt, dass das Metaverse der Nachfolger des mobilen Internets sein wird“, betont er, der nicht nur die digitale Welt revolutionieren werde, „sondern auch einen Großteil der physischen Welt sowie alle darüber liegenden Dienste und Plattformen, ihre Funktionsweise und Angebote.“
Und das führt geradewegs zum dritten Grund für die Neuausrichtung: Bis zum Jahr 2030 will der Konzern eine Milliarde Nutzer ins Metaverse locken, wo sie dann mit Produkten, Anwendungen und Apps im Gesamtwert von mehreren hundert Mrd. US-Dollar handeln – angefangen bei virtuellen Einrichtungsgegenständen und Kleidungsstücken über virtuelle Haustiere bis hin zu virtuellen Arbeitsgeräten. Vor allem Markenhersteller hoffen auf einen weiteren Absatz in der digitalen Parallelwelt. So hat das Sportunternehmen Nike als eines der ersten bereits Ende Oktober seine Marke für „virtuelle Güter“ beantragt, um auch digitale Kopien seiner begehrten Sneakers verkaufen zu können.
Mark Zuckerberg verfährt somit offenbar einmal mehr nach seinem berühmt-berüchtigten Motto „Move fast and break things“ – nur dass dieses Mal die „sozialen Medien“ selbst schöpferisch zerstört werden sollen. Die Beweggründe dafür hat der Investor Matthew Ball vor einiger Zeit in einem im Silicon Valley vielbeachteten Aufsatz beschrieben. Er erwartet, dass das Metaverse noch mehr Umsatz generieren wird als das heutige Web: „Das Metaverse wird die gleiche Vielfalt an Möglichkeiten bieten wie das Internet – neue Unternehmen, Produkte und Dienste werden entstehen […]. Dies aber bedeutet wiederum, dass viele der heutigen etablierten Unternehmen wahrscheinlich untergehen werden“, so Ball.[3] Ebendiese Hoffnung hegt erkennbar auch Zuckerberg: Genau wie einst die Internetkonzerne viele der „klassischen“ Unternehmen vom Thron gestoßen haben, soll ein Erfolg des Metaverse dazu führen, dass viele der heutigen digitalen Platzhirsche ihre Marktmacht verlieren und Meta deren Stellung einnimmt.
Das Metaverse als Mega-App
Allerdings liegt bis dahin noch ein steiniger Weg vor Meta. Denn zum einen ist die erforderliche Technik noch nicht ausgereift, auch wenn Facebook bereits 2014 Oculus übernahm, einen erfahrenen Hersteller für Virtual-Reality-Headsets. Das Unternehmen heißt heute Meta Quest und entwickelt derzeit unter dem Codenamen „Project Cambria“ ein sogenanntes Mixed-Reality-Headset, das mit zahlreichen Sensoren sowohl Augenbewegungen als auch die Mimik der Nutzerinnen und Nutzer in virtuelle Räume übertragen soll. Zugleich leiden diese Geräte nach wie vor an etlichen Kinderkrankheiten: So sind Virtual-Reality-Helme nach wie vor recht schwer und teuer, benötigen viel Strom und Rechenleistung, und sie lösen noch immer bei vielen Nutzern Schwindelgefühle aus.
Zum anderen gibt es bereits etliche virtuelle Welten, in den sich vor allem junge Menschen tummeln. So kreieren in dem Multiplayer-Spiel „Fortnite“ schon heute mehr als 300 Millionen Nutzer ihre eigenen Welten, in denen sie miteinander interagieren. Selbst Popkonzerte finden dort statt: Im Jahr 2020 absolvierte der Rapper Travis Scott in Fortnite fünf virtuelle Auftritte, denen insgesamt knapp 28 Millionen Spielerinnen beiwohnten. Erst vor gut einem halben Jahr gab Fortnite-Macher Epic Games bekannt, ebenfalls ein eigenes Metaverse zu planen. Eine ganz ähnliche Zukunft zeichnet sich bei der Spieleplattform „Roblox“ ab: Sie hat mehr als 164 Millionen Nutzer, jedes zweite Kind in den USA ist dort bereits registriert; während der Corona-Lockdowns haben einige von ihnen dort sogar ihre Geburtstagsfeiern abgehalten.
Gerade aber wegen dieses erkennbaren Trends sind Zuckerbergs Ambitionen überaus ernst zu nehmen – und umso wachsamer sollte die Politik die Metaverse-Pläne schon jetzt unter die Lupe nehmen, um in einigen Jahren nicht ein noch böseres Erwachen zu erleben als heute. Denn das Metaverse soll weit mehr als nur eine neue Social-Media-Plattform werden, nämlich eine Mega-App, die alles in sich vereint.
Schon seit längerem bemühen sich die großen Techkonzerne darum, ihre Angebote zu sogenannten Super Apps zusammenzuführen, die möglichst viele Dienstleistungen zugleich übernehmen und sich nahtlos in das Leben ihrer Nutzer einfügen. Metas Pläne reichen weit darüber hinaus: Für seine mehr als drei Milliarden Nutzerinnen und Nutzer entwickelt der Konzern eine dreidimensionale Mega-App, in der Arbeit, Handel, Freizeit- und Unterhaltungsangebote zusammengeführt sind. Weil das Metaverse laut Zuckerberg zudem „ein verkörpertes Internet“ sein wird, „in dem man Inhalte nicht nur anschaut, sondern in ihnen ist“, erhielte Meta damit zugleich ungekannte Möglichkeiten, um auch die biometrischen Daten seiner Nutzer abzugreifen. Denn diese stehen dort buchstäblich unter Dauerbeobachtung: Jede einzelne ihrer Bewegungen, jeder Blick sowie jede Veränderung ihrer Mimik kann Meta mit Hilfe der Headsets erfassen, auswerten und monetarisieren.
Entgiftet Facebook!
Zwar gelobt Zuckerberg, dass der Schutz der Nutzer und ihrer Daten „vom ersten Tag an fest im Metaverse verbaut sein“ werde. Mit Datenschutz im klassischen Sinne hat dies allerdings wenig gemein: Vielmehr sollst „Du selbst entscheiden können, wann Du mit anderen Menschen zusammen sein willst, wann Du jemanden daran hindern willst, in Deinem Raum zu erscheinen, oder wann Du eine Pause machen und Dich in eine private Blase teleportieren willst.“ Mit anderen Worten: Privatsphäre und Datenschutz sind aus Zuckerbergs Sicht auch in Zukunft kein Recht, das der Konzern seinen Nutzern einräumen muss, sondern vielmehr eine Einstellung, mit der diese anderen Nutzern Zugang zu ihrer digitalen Welt gewähren oder nicht. Der Konzern hingegen schaut immer zu.
Umso entschiedener muss die Politik nun endlich Konsequenzen ziehen und verhindern, dass Meta noch mächtiger, das Internet noch toxischer und der Schaden für die Demokratie noch größer werden.
Dafür muss sie erstens Metas Macht beschneiden. Seit Jahren wächst der Konzern unaufhaltsam, nicht nur hinsichtlich seiner Nutzer, sondern auch bei der Zahl seiner Plattformen. Aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer braucht es daher neben einem stärkeren Datenschutz auch die sogenannte Interoperabilität. Sie erlaubt es diesen, verschiedene Anwendungen zu nutzen, also etwa Nachrichten von WhatsApp an Signal zu schicken, und so die hohen Mauern der sozialen Netzwerke zu durchbrechen.
Darüber hinaus sind kartellrechtliche Verschärfungen unerlässlich. Denn längst ist Meta so mächtig, dass alternative Anbieter keine fairen Wettbewerbschancen bekommen. Im Gegenteil: Drohen diese Meta gefährlich zu werden, kauft der Konzern sie meist kurzerhand auf. Neben einer strikteren Fusionskontrolle muss dabei auch die Aufteilung des Techkonzerns geprüft werden. Denn erst dann erhielten andere Plattformen überhaupt wieder eine Chance, Vertrauen und Sicherheit anzubieten, statt mit dem Schüren von Wut und Angst Profite zu generieren.[4]
Zweitens braucht es eine Altersbeschränkung für soziale Medien. Es gibt eine Altersfreigabe für Alkohol, Autofahren, Pornografie und Tabak. Meta aber ist davon überzeugt, dass auch Kinder Facebook, Instagram und wohl auch das Metaverse nutzen sollten. Dabei zeigen die von Haugen ans Licht gebrachten Studien, dass beispielsweise Instagram bei Teenagern unter anderem Depressionen, Essstörungen und Angstzustände befördert. Und obwohl der Konzern das weiß, hat er keinerlei Korrekturen vorgenommen. Im Gegenteil lässt er es weiterhin aus Profitgründen zu, dass Anzeigenkunden die erkrankten Jugendlichen auch noch gezielt umwerben.
Drittens muss Metas Unternehmensführung für den immensen Schaden, den sie angerichtet hat, endlich zur Verantwortung gezogen werden. Vor allem Mark Zuckerberg hat die Öffentlichkeit wiederholt getäuscht und belogen – den US-Kongress sogar unter Eid –, und er hat bei alledem wissentlich einen immensen Schaden für die Gesellschaft in Kauf genommen, indem er Hassbotschaften und manipulative Werbung weitgehend frei zirkulieren lässt und nicht einmal Menschenhandel auf seiner Plattform unterbindet. Seiner gesellschaftlichen Verantwortung hat sich der Konzern damit klar entzogen: „Wenn unsere Umgebung aus Informationen besteht, die polarisieren, die wütend machen, dann führt das zu Vertrauensverlust in unser Gegenüber. […] Facebook zerreißt unsere Gesellschaft und verursacht Gewalt in der Welt“, betont auch Frances Haugen.
Mark Zuckerbergs Ankündigung des Metaverse hat die Auseinandersetzung darüber eröffnet, wie die digitale Welt von morgen aussehen soll. In Stephensons Romanvorlage befindet sich die Welt weitgehend im Besitz großer Unternehmen, während die Regierungen zu unbedeutenden Außenposten am Rande des Geschehens degradiert sind. Es liegt an uns, ob auch wir dieser Romanvorlage folgen und Mark Zuckerberg weiter ungehindert die Welt vergiften lassen. Oder ob wir ihn endlich zur Rechenschaft ziehen und dem Meta-Konzern Einhalt gebieten.
[1] Vgl. The Metaverse and How We‘ll Build It Together – Connect 2021, www.youtube.com, 28.10.2021.
[2] Alex Heath, Facebook’s lost generation, www.theverge.com, 25.10.2021.
[3] Matthew Ball, The Metaverse: What It Is, Where to Find it, and Who Will Build It, www.matthewball.vc, 13.1.2020.
[4] Vgl. Facebook & Co. in die Schranken weisen!, www.lobbycontrol.de, 4.11.2021.