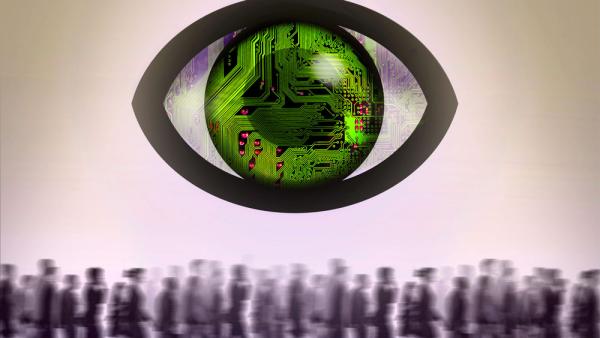Bild: Man ist nicht nur von immer mehr Smartphones umgeben, sondern wird auch zunehmend unter Druck gesetzt, es ihren Nutzer:innen gleichzutun. (IMAGO / MASKOT)
In vielen Saunen gilt das Prinzip digital detox – digitale Entgiftung. Elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets oder Computer sind dort nicht erlaubt, die Menschen sollen sich von deren übermäßiger Nutzung erholen. Zum Glück, denn in der Sauna hat ein Smartphone mit seinen Maxi-Megapixel-Kameras nun wirklich nichts zu suchen. Was in den meisten Saunen normal ist, wird in der Außenwelt jedoch immer schwieriger: Dort ist man nicht nur von immer mehr Smartphones umgeben, sondern wird auch zunehmend unter Druck gesetzt, es ihren Nutzer:innen gleichzutun. Denn viele Vorzüge des Lebens setzen heute die Nutzung digitaler Dienste voraus: Die Banking-App kann nur installieren, wer sich den Geschäftsbedingungen von Google oder Apple unterwirft; die meisten modernen Babyphones oder Pulsuhren sind ohne App quasi unbrauchbar; das Balkonkraftwerk wird über eine App gesteuert; Elektroroller funktionieren nur mit der App aus den angeblich so „marktüblichen“ App-Stores; auch die Bahn setzt mehr und mehr auf Onlinetickets und in vielen Uni-Mensen gibt es die umweltfreundliche Mehrwegverpackung nur noch per App.
Wann aber wird bei der Ausbreitung digitaler Dienste die Grenze zur strukturellen Benachteiligung überschritten, wann werden sie zum Zwang? Wenn der Postdienstleister DHL ein Paket ungefragt in eine Packstation legt, die nur noch per Smartphone zu öffnen ist? Wenn das Deutschlandticket nur noch mit Smartphone genutzt werden kann? Wenn der Kauf von Bahntickets an Bord nur noch per App möglich ist? Oder wenn der Gesetzgeber festlegt, dass man Restaurants oder gar Behörden nur noch betreten darf, wenn man eine bestimmte App installiert hat, wie mit der Luca-App vielerorts geschehen? All dies ist bereits Realität.
Was ist Digitalzwang?
Der Verein Digitalcourage, bei dem beide Autorinnen Mitglied sind, hat diese Entwicklung anhand zahlreicher Beispiele mit dem Begriff „Digitalzwang“ so umschrieben: „Digitalzwang liegt vor, wenn es sich nicht um einen Extraservice handelt und ein Verzicht auf diese Leistung die Teilhabe am öffentlichen Leben einschränkt, also eine Diskriminierung entsteht, insbesondere bei staatlichen Leistungen; wenn es keine analoge Alternative gibt, obwohl das technisch möglich wäre; wenn die analoge Alternative durch etwa höhere Kosten oder größeren Aufwand so unattraktiv gemacht wird, dass sie faktisch nicht infrage kommt.“[1]
Digitalzwang tritt zudem in verschiedenen Varianten auf. Unterschieden wird zwischen erstens einem Digitalisierungszwang, wenn man einen Computer oder ein Smartphone sowie eine Internetanbindung besitzen muss, um an einem Prozess teilzunehmen, und es keine Alternativen mehr gibt; zweitens einem App- oder Smartphonezwang, wenn eine bestimmte App und damit auch ein Smartphone sowie Zugang zum App-Store vorausgesetzt werden; drittens einem Konto- oder Accountzwang, wenn ein Dienst nur nach Anlegen eines Kontos genutzt werden kann, obwohl es auch anders ginge – etwa wenn man sich um einen Job nur bewerben kann, indem man bei einem Bewerbungsportal ein Konto anlegt; und schließlich viertens dem Datenabgabezwang, sprich: Man kann einen Dienst erst in Anspruch nehmen, wenn man einwilligt, dass im Gegenzug Daten gesammelt werden, sei es durch Cookie-Banner, Apps mit Google-Diensten oder Werbetracking.
Natürlich ist nicht jeder Dienst, den es nur online gibt, Digitalzwang. Solange es sich um Zusatzdienste handelt, ist prinzipiell nichts dagegen einzuwenden. Das Einchecken am Platz zur schaffnerlosen Fahrkartenkontrolle ist in der Bahn beispielsweise nur per App möglich und dennoch kein Digitalzwang.
Die Bahn lässt allerdings mittlerweile schleichend diverse analoge Dienste unter den Tisch fallen, die Fahrgäste brauchen, um ohne zusätzlichen Stress reisen zu können: etwa Informationen über Verspätungen und Anschlusszüge, den Wagenstandsanzeiger, den Fahrkartenkauf an Bord von Fernzügen, Reservierungen oder das Austeilen von Erstattungsformularen. Wenn die Bahn nun auch noch den Ticketkauf gegen Bargeld am Fahrkartenautomaten abschaffen würde, gäbe es keine Möglichkeit mehr, unüberwacht Bahn zu fahren.
Die Grenzen sind nicht nur innerhalb eines Dienstes fließend, sondern auch gesamtgesellschaftlich: Wenn ein Laden auf reinen Onlineverkauf setzt, ist das noch kein Problem, und wer würde schon von Amazon erwarten, dass es einen Papierkatalog oder Filialen anbieten muss? Aber wenn es bestimmte Produkte nur noch online zu kaufen gibt, wenn beispielsweise Theaterkassen schließen und Konzertkarten nur noch online erworben werden können, schließt das Menschen ohne Smartphone, Computer und Internet aus. Wir können nicht warten, bis es nur noch einen einzigen verbliebenen Anbieter für ein analoges Angebot gibt und diesem dann auferlegen, es fortführen zu müssen, weil andernfalls Digitalzwang entstünde. Da müssen wir schon früher ansetzen.
Ob ein Dienst Digitalzwang hervorruft, hängt nicht davon ab, welche Angebote die Konkurrenz macht. Es sind vor allem die Grundversorger, die in der Verantwortung stehen, ihre Dienste allen Menschen gleichermaßen zugänglich zu machen. Doch selbst staatliche Leistungen und Angebote der Grundversorgung werden zunehmend an das Smartphone gekoppelt.
Eingeschränkte Grundversorgung
Die Deutsche Post DHL etwa rüstet derzeit ihre Packstationen so um, dass sie nur noch mit Smartphone und extra installierter Post- und DHL- App funktionieren. Damit schließt sie Menschen aus, die die mit Trackern verseuchte App nicht auf ihrem Gerät installieren wollen oder schlicht kein Smartphone haben. Auch diese erhalten neuerdings Zustellbenachrichtigungen für Packstationen und stehen dann ratlos vor einer gelben Wand ohne Display. Hier wird Zug um Zug eine Leistung der Grundversorgung – nämlich Pakete empfangen zu können – mit Digitalzwang und damit auch Überwachung belegt.
Anstatt weiterhin auch einen guten analogen Service für all jene anzubieten, die sich gegen das Smartphone entscheiden, geht die Post sogar noch weiter: Sie möchte das Postgesetz anpassen und damit verschlechterten Service sowie ihren Digitalzwang legalisieren lassen. So will sie künftig Postfilialen durch aufgemotzte Packstationen ersetzen, die weder barrierefrei sind noch persönliche Beratung und Hilfestellung vor Ort anbieten und an denen man nicht einmal mehr eine Briefmarke mit Bargeld bezahlen kann. Für dieses Gesamtpaket „Digitalzwang Plus“ verlieh der Verein Digitalcourage der Deutschen Post DHL in diesem Jahr einen „BigBrother-Award“.[2]
Zusammen mit den vielen kleinen Annehmlichkeiten, auf die man „freiwillig“ verzichtet, wenn man sich heute für ein Leben ohne Smartphone entscheidet, stellt das eine beträchtliche Einschränkung dar. Doch so gerne die meisten von uns auf den kleinen Glasscheiben herumwischen: Ob wir uns ein solches Gerät zulegen und mit uns führen, sollte auch in Zukunft eine freie Entscheidung bleiben.
Im Dienst des Überwachungskapitalismus
Tatsächlich gibt es noch immer viele Menschen, die ohne Smartphone und Internetzugang leben: Im Alter zwischen 16 und 74 Jahren sind das hierzulande sechs und europaweit sieben Prozent.[3] Darunter vor allem alte und arme Menschen. Die einen sind von den komplizierten Geräten, die ständig ihre Regeln ändern, überfordert, die anderen können sich die teuren Smartphones und die monatlichen Kosten schlichtweg nicht leisten. Denn die meisten Apps verlangen permanenten Internetzugang. Da bleibt es nicht bei den Anschaffungskosten, sondern es fallen laufend Kosten für mobile Daten an. Beide Probleme werden sich in Zukunft kaum lösen lassen. Denn auch die Generation der sogenannten digital natives wird dereinst feststellen, dass das Gehirn im Alter unflexibler wird und schon von Kleinigkeiten wie der Änderung eines App-Icons aus der Bahn geworfen werden kann. Der Glaube, das Problem löse sich mit der Zeit von selbst – wenn die „digitalen Analphabeten“ eines Tages ausgestorben sind –, ist schlicht naiv, unsolidarisch und zynisch.
„Ich bin alt, aber kein Idiot“ – unter diesem Motto startete der Rentner Carlos San Juan de Laorden im vergangenen Jahr eine Petition, die sich gegen die in Spanien noch weiter als hierzulande verbreitete Tendenz richtete, Bankfilialen und Geschäfte zu schließen und menschlichen Service durch Bandansagen und Apps zu ersetzen. Mit überraschendem Erfolg: Über 600 000 Unterschriften kamen zusammen. Daraufhin sagte die Bank zu, die Öffnungszeiten zu verlängern und ihr barrierefreies Angebot auszubauen.[4]
Neben Alter und Armut gibt es viele weitere Gründe, weshalb Menschen lieber ohne Smartphone leben wollen, und die meisten sind höchst individuell: Pia wurde über ihr manipuliertes Smartphone von ihrem Ex-Freund gestalkt und hat erst Mal die Nase voll davon. Özgür legt Wert darauf, nur Technik zu benutzen, bei der er versteht, was sie tut. Jutta hat die Tracker in verschiedenen Apps analysiert und möchte diese nicht installieren – gerade weil sie weiß, was sie tun. Mark hat seit kurzem ein Kind und möchte während der ersten drei Jahre in dessen Anwesenheit kein Smartphone nutzen. Samira möchte in den Urlaub kein Smartphone mitnehmen. Laszlo besaß jahrelang ein Smartphone und genießt es heute, Menschen und Umgebung ganz anders wahrzunehmen, Langeweile im Wartezimmer auszuhalten und einen Ausflug bewusst zu erleben, statt ihn vor lauter Selfies und Videoaufnahmen zu verpassen. Ricarda kennt sich mit Datenschutz, targeted advertising – gezielter Werbung – und Demokratie aus und geht deshalb zumindest den fünf größten Tech-Konzernen Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft (kurz: GAFAM) aus dem Weg. Sie hat zwar ein Smartphone, doch darauf verwendet sie ausschließlich Apps, die sich nutzen lassen, ohne dass die GAFAM davon etwas mitbekommen. Carlos hat Parkinson und kann ein Smartphone mit seinen zittrigen Fingern nicht gut bedienen. Und Oma Tilde hat den Zweiten Weltkrieg überlebt und weiß, welch fatale Folgen mediale Manipulation haben kann.
Gerade weil die Gründe, die gegen ein Smartphone sprechen, so individuell sind, dürfen wir das Anliegen, ohne Smartphone leben zu wollen, nicht einfach ignorieren. Insbesondere deshalb nicht, weil der Überwachungsdruck, der von diesen Geräten ausgeht, immens ist.
Dennoch wird die Forderung nach analogen Alternativen gerne als Technikfeindlichkeit abgetan. Wer auf digitale Vorzüge verzichten wolle, müsse sich eben mit den damit verbundenen Nachteilen abfinden. Doch der Vorwurf verkennt, dass viele auf digitale Technik verzichten, weil dabei oft nicht das Wohl der Menschen im Mittelpunkt steht, sondern diese vor allem dem Überwachungskapitalismus dient.[5]
Das Recht auf ein analoges Leben
Wie sehr durch die – unkritische – Nutzung digitaler Dienste Prozesse angestoßen werden, die Demokratie, Freiheit und Wissenschaft aushöhlen und in akute Gefahr bringen, ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Eine Gesellschaft, die auch noch die wenigen Widerständigen unter Druck setzt, sich zu fügen, untergräbt schlicht ihr demokratisches System. Digitale Dienste nicht zu nutzen, ist daher mitunter eine höchst politische Entscheidung.
Der Publizist Heribert Prantl fordert folgerichtig ein neues Grundrecht: das Recht auf ein analoges Leben.[6] Viele kleine Einschnitte sind für sich genommen vielleicht nicht weiter erwähnenswert, aber in ihrer schieren Masse sind sie eben doch nicht mehr zumutbar. Mindestens bei allen Diensten der Grundversorgung muss es weiterhin immer auch eine analoge Alternative geben. Das gebieten uns Werte wie Fairness, Inklusion und Freiheit. Auch wenn wir selber gerne auf das Smartphone und digitale Angebote zurückgreifen, sollten wir für die analogen Alternativen streiten. Auch wenn wir die Vorzüge der Technik lieben, sollten wir uns gegen Digitalzwang einsetzen. Das ist ein Akt der Solidarität.
In der Sauna ist „digital detox“ eher eine Lifestyle-Frage. Doch es geht um weitaus mehr: Es geht um Wahlfreiheit. Es geht darum, den Alltag bewältigen und am öffentlichen Leben teilhaben zu können, auch wenn wir uns dafür entscheiden, uns nicht von einem Taschenspion auf Schritt und Tritt überwachen zu lassen. Und schließlich kann Technik auch anders gestaltet werden: datenschutzkonform, barrierefrei und menschenfreundlich. Es liegt an uns, das zu fordern und entsprechende Entwicklungen, Produkte und Dienste zu honorieren. Wir müssen deshalb eine Nachfrage für eine Technik erzeugen, die uns mündig sein lässt. Dazu aber brauchen wir die Wahl. Wenn der Preis für eine solche Entscheidung zu hoch wird und wir genötigt werden, Produkte zu nutzen, die wir eigentlich ablehnen, verlieren wir unseren freien Willen.
Gerade weil wir Technik lieben, wollen wir sie mitgestalten. Wir wollen uns nicht zermürben lassen von den vielen kleinen und großen Benachteiligungen. Und wir wollen uns nicht der ständigen Überwachung beugen, die (ganz) nebenbei erfolgt.
[1] Vgl. Leena Simon, Digitalzwang, www.digitalcourage.de, 24.4.2023.
[2] Vgl. Rena Tangens, BigBrotherAward-Laudatio für die Deutsche Post, www.bigbrotherawards.de/2023.
[3] Vgl. Statistisches Bundesamt, 7 % der Bevölkerung waren noch nie online, www.destatis.de, 30.3.2023.
[4] Vgl. Ursula Scheer, Der alte Mann und die Bank, www.faz.net, 10.2.2022; Gustav Fauskanger Pedersen, Alt, aber nicht dumm: Rentner kämpft gegen Überdigitalisierung, www.iglobenews.org, 4.4.2022.
[5] Vgl. dazu auch Shoshana Zuboff, Der dressierte Mensch. Die Tyrannei des Überwachungskapitalismus, in: „Blätter“, 11/2018, S. 101-111.
[6] Vgl. Heribert Prantl, Wer kein Handy hat, wird ausgeschlossen, www.sueddeutsche.de, 5.5.2023.