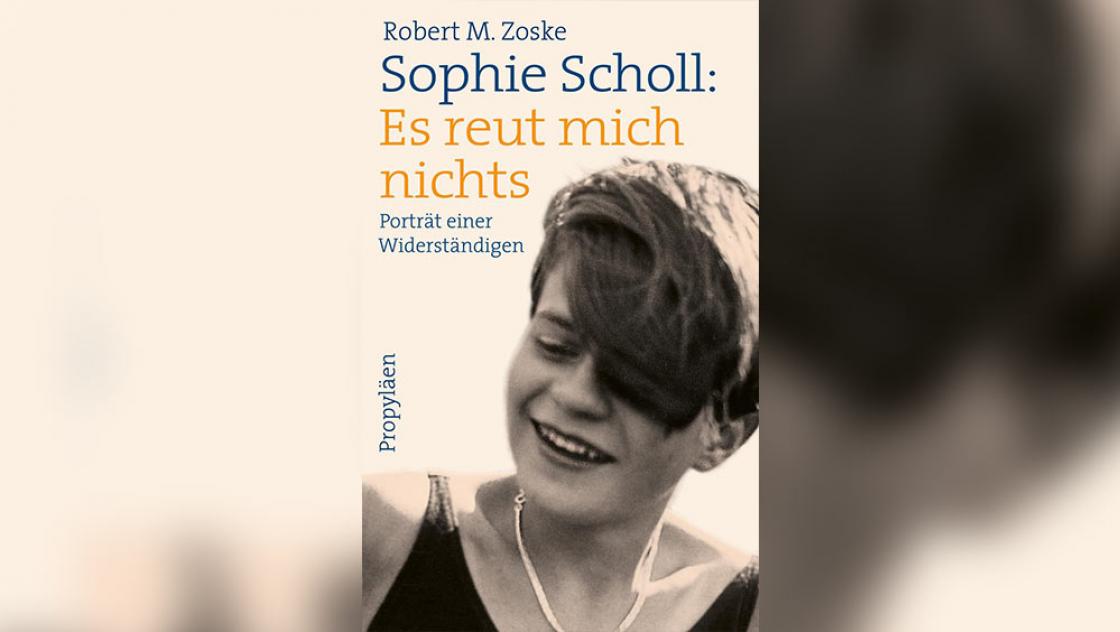
Bild: Propyläen Verlag
Nach dem Krieg galten sie als Verräter, später als Widerstandskämpfer, die schon immer in Opposition zu Hitler gestanden hätten: die Mitglieder der Weißen Rose, allen voran die Geschwister Scholl. Sophie Scholl wäre am 9. Mai 100 Jahre alt geworden. Die Biographie, die der Theologe Robert M. Zoske unter dem Titel „Es reut mich nichts“ vor kurzem vorgelegt hat, zeigt, dass sie nicht nur ein widerständiger, sondern auch ein widersprüchlicher Mensch war.
Als Reinhart Müller 1988 seine Stelle als Pfarrer in der Ulmer Pauluskirche antrat, wusste er, dass gut 50 Jahre zuvor Sophie Scholl hier konfirmiert worden war. Womit der Theologe nicht gerechnet hatte, war die ablehnende Haltung, auf die er in seiner Gemeinde stieß. Die Kirche solle aus ihr keine Heilige machen – so die Reaktion, wenn die Sprache auf Sophie Scholl kam. „Ältere Frauen erzählten mir, wie sie als Mädchen unter der strengen BDM-Leiterin gelitten hätten“, erinnert sich der heute 85jährige. Sophie dagegen sei „hundertprozentig, ja fanatisch engagiert“ gewesen. Die Ikone des deutschen Widerstandes im Nationalsozialismus, einst selbst eine überzeugte Anhängerin des Regimes? Zoske ist nicht der erste und einzige, der auf die Ambivalenzen im Leben Sophie Scholls hinweist. Aber er tut dies auf überzeugende und gut lesbare Art und Weise, auch wenn manche Formulierung übers Ziel hinausschießt. So ist es fraglich, ob die 15jährige Sophie der Überzeugung „Du bist nichts, dein Volk ist alles!“ tatsächlich angehangen hat, wie Zoske schreibt. Denn bei allem Rigorismus, der ihr eigen war, hat sie das Volk doch nie vergöttert.
„Sie war wie ein feuriger wilder Junge […] lebhaft, keck, mit heller klarer Stimme, kühn in unsern wilden Spielen und von einer göttlichen Schlamperei.“ Mit diesen Worten beschreibt Susanne Hirzel in Zoskes Buch ihre Freundin Sophie Scholl, die sie mit 14 Jahren im Jungmädelbund kennenlernte. „Letzten Endes ging es um die ‚Freiheit‘. Diesem Ziele wollten wir unser Leben weihen, hätten jedoch niemandem genauer sagen können, was das ist: ‚Freiheit‘.“ Wenn es etwas gibt, das das vielfältige Leben Sophie Scholls zusammenhält, dann ist es wohl ihr Kampf um Freiheit. Aber man muss sich hüten, den Begriff in heutigen Kategorien von Selbstverwirklichung zu denken. Freiheit war für Sophie Scholl ein Ringen um das richtige Leben. Nirgends wird das so deutlich wie in den Briefen an ihren und von ihrem langjährigen Freund und Geliebten Fritz Hartnagel. Der sich von 1937 bis 1943 erstreckende Briefwechsel ist bereits vor 16 Jahren erschienen, herausgegeben von Thomas Hartnagel, dem ältesten Sohn von Fritz Hartnagel. Ohne dieses Buch, sagt Zoske, hätte er seine Sophie-Scholl-Biographie nicht schreiben können. In den Briefen wird ständig um das Verhältnis von Nähe und Distanz gerungen. Er sucht die Nähe – auch die körperliche –, während sie immer wieder auf Distanz geht und die Liebe zu Gott über alles stellt. Zoske zitiert einen Brief vom Dezember 1940, den Hartnagel als Soldat aus dem besetzten Frankreich schrieb: „Wenn jeder von uns beiden seinen ganzen Trost und Halt im ‚Höheren‘ findet, dann ist der eine dem anderen wohl überflüssig geworden. Was wollen wir noch voneinander? Ich suchte in Dir einen Menschen, zu dem man immer kommen kann mit seiner Last. Und ich hoffte dasselbe für Dich zu sein.“ Die Reaktion Sophie Scholls erfolgte wenige Tage später. Könne man wirklich zwei Herren dienen, fragte die 19jährige: „Glaubst Du nicht, dass das Geschlecht könnte vom Geiste überwunden werden?“ Und Zoske kommentiert: „Sie sah Eros und Spiritualität unversöhnlich gegenüberstehen und wollte nur einem ‚Herren‘ dienen. Eine mönchisch-nonnenhafte Leibfeindlichkeit dominierte Sophies Denken.“
Welch Unterschied zur schon beschriebenen wilden Lebenslust Sophie Scholls. Und genau das macht die Qualität des Buches aus. Es schildert die Widerständige, wie sie im Untertitel genannt wird, in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit. Bloß nicht mitlaufen oder mitmachen bei dem, was die anderen machen, das hatten die Scholl-Kinder von ihren schwäbischen Eltern mit auf den Weg bekommen. „Die fröhliche Pietistin gab an ihre Kinder Gottvertrauen und Opferbereitschaft weiter, der skeptische Kulturprotestant lehrte sie politisches Bewusstsein und liberales Denken“, schreibt Zoske. Dabei war Robert Scholl, der spätere Mitbegründer der „Blätter“, keineswegs ein klassischer Liberaler. Er stand nach dem Krieg nicht nur der Westintegration Adenauers skeptisch gegenüber, sondern generell den westlichen Demokratien.
Identität durch Opposition
Für Hans und Sophie Scholl war etwas anderes ausschlaggebend. Ihre Begeisterung für den Nationalsozialismus – beide traten früh in die Jugendorganisationen des Regimes ein und übernahmen dort Führungspositionen – war auch ein Aufbegehren gegen den Vater, der aus seiner Ablehnung der Nazis keinen Hehl machte: Identität durch Opposition. Ein anderer Faktor war allerdings noch wichtiger. Zu Recht weist Zoske darauf hin, dass der Nationalsozialismus nicht nur reaktionär war, sondern auch revolutionär – und gerade für Jugendliche sehr attraktiv. Er zitiert das Gelöbnis, das Sophie Scholl bei ihrem Eintritt im Bund Deutscher Mädel (BDM) 1934 ablegte: „Stark und stolz wollen wir werden: Zu gerade, um Streber oder Duckmäuser zu sein, zu aufrichtig, um etwas scheinen zu wollen, zu gläubig, um zu zagen und zu zweifeln, zu ehrlich, um zu schmeicheln, zu trotzig, um feige zu sein.“ Das klingt nicht nach Vorbereitung auf die Rolle als Frau und Mutter, sondern nach Aufbruch und Leben. Die gemeinsamen Wanderungen, die Nähe zur Natur und das Gefühl, eine Elite zu bilden: Darin waren sich Hitlerjugend und BDM sowie die aus dem Wandervogel hervorgegangene bündische Jugend, in deren Tradition sich die Scholl-Kinder sahen, ähnlich.
Dass die Bünde schon 1933 verboten wurden – das Regime duldete keine Abweichung –, störte Hans und Sophie Scholl anfangs nicht. Doch die Forderung nach bedingungslosem Gehorsam legte den Grundstein für ihren späteren Bruch mit dem System. Wann dieser bei Sophie Scholl genau erfolgte, lässt sich schwer sagen. Vieles spricht dafür, dass die Entfremdung ein Prozess war und nicht auf einem einschneidenden Erlebnis beruhte. Über die Pogromnacht 1938 verlor Sophie Scholl kein Wort, obwohl die Juden in Ulm unweit ihrer Wohnung in einen Brunnen getrieben und dort mit Tritten und Schlägen traktiert wurden. Den Kriegsbeginn kommentierte sie in einem Brief an Hartnagel: „Ich kann es nicht begreifen, dass nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von andern Menschen. Sag nicht, es ist für‘s Vaterland.“ Aber dann folgte: „Wenn es Dir nur immer gut geht. Gelt, Du hast keinen so gefährlichen Posten?“ Das klingt besorgt, aber unpolitisch und noch nicht nach Widerstand.
Erst die wachsende Brutalität des Krieges bildete den Nährboden dafür. Und doch lässt sich kein „es musste so kommen“ daraus ableiten. Es bleibt ein Moment der Kontingenz: Hätte sie nicht im Sommer 1942 von den Flugblattaktionen der Weißen Rose um ihren Bruder Hans gehört, wäre Sophie Scholl vielleicht untätig geblieben, so wie sie den Reichsarbeitsdienst zwar unwillig, aber pflichtbewusst abgeleistet hatte. Nun aber zögerte sie nicht und schloss sich der Widerstandsgruppe an. Die Aufrufe an die Deutschen, sich gegen das verbrecherische Regime zu erheben, waren für Sophie Scholl eine Berufung: Man kann nur einem Herrn dienen. Hier war er wieder, der Wille zum richtigen Leben, das Bekenntnis zur Freiheit – und damit auch zur Schuld, mag sie auch noch so klein sein. Denn Schuld ist relativ, so Zoske, „und im Rahmen ihrer Möglichkeiten hatte sie jahrelang tatkräftig zur emotionalen Akzeptanz des Regimes beigetragen. Hinzu kam jetzt: Wer noch im Herbst 1942 angesichts eines millionenfachen Mordens tatenlos wegschaute, akzeptierte Unrecht, verstrickte sich – so sah es Sophie – Tag für Tag in Schuld.“
Der Rest ist bekannt: Am 18. Februar 1943 wurden Hans und Sophie Scholl beim Abwerfen von Flugblättern in der Universität München verhaftet, vier Tage später hingerichtet. „Ich bereue meine Handlungsweise nicht“, sagte Sophie Scholl am Ende der Vernehmung. Und nur weil sie das Regime zuvor lange unterstützt hatte, wird der Vorbildcharakter ihres Tuns nicht kleiner.
Robert M. Zoske, Sophie Scholl: Es reut mich nichts. Porträt einer Widerständigen. Propyläen, Berlin 2020, 448 S., 24 Euro.










