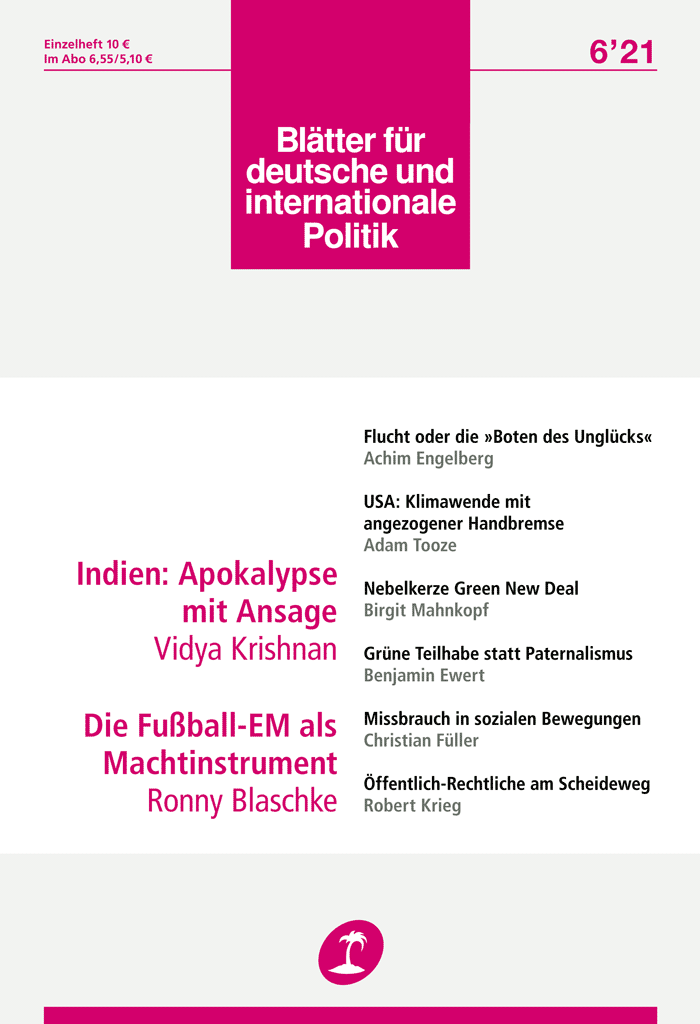Bild: Massenimpfung in der Kölner Zentralmoschee, 8. Mai 2021 (IMAGO / NurPhoto)
Wie sehr sich die Einkommens- und Vermögensungleichheit auf die Gesundheit der Menschen auswirken, zeigt sich derzeit in kaum einer anderen Stadt so deutlich wie in Köln. Als hier Anfang Mai die höchste Sieben-Tage-Inzidenz der 16 größten deutschen Städte vermeldet wurde, sorgte vor allem eines für Aufmerksamkeit: die lokale Ungleichverteilung der Inzidenzen. Während diese im linksrheinischen Villenviertel Köln Hahnwald bei null lag, kletterte sie auf über 700 im rechtsrheinischen Gremberghoven – einem Stadtteil in Flughafennähe, wo die Mieten deutlich niedriger, die Arbeitslosenquote, die Hartz-IV-Betroffenheit und der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte dafür aber umso höher sind.
Wenn auch spät, reagierte die Stadtregierung in dieser Situation durchaus angemessen: Mit mobilen Impfteams und mehrsprachigen „Anti-Corona-Scouts“ versorgte sie die Menschen direkt vor Ort, nachdem sie zuvor die Impfpriorisierung nach Lebensalter und Vorerkrankung in den „vulnerablen Sozialraumgebieten“ aufgehoben und zusätzliches Personal für Aufklärung und Information bereitgestellt hatte. Wenngleich mit dieser Art der „positiven Diskriminierung“ von Hochhaussiedlungen und sozial benachteiligten Wohnquartieren die Gefahr der Stigmatisierung einhergeht, ist dieses unkonventionelle Vorgehen zur Pandemieeindämmung sinnvoll. Allerdings gleicht die Kölner Strategie einem Feuerwehreinsatz: An der grundlegenden Problematik – nämlich den strukturellen Ursachen der extrem ungleichen Stadtentwicklung – änderte sie nichts. Und bislang zumindest steht eine nachhaltige Auseinandersetzung mit dieser auch nicht auf der kommunalpolitischen Agenda.
Dabei wäre ebendies dringend nötig. Denn wie selten zuvor wird in der Covid-19-Pandemie sichtbar, dass sich die Verteilungsschieflage bei Einkommen und Vermögen insbesondere auch in gesundheitlicher Ungleichheit niederschlägt. Dieser Zusammenhang zeigt sich auch auf der geographischen Ebene und damit in der Wohnsituation, wie schon vor fast einem Jahr die Auswertung von Covid-19-Meldedaten durch das Robert-Koch-Institut und das Institut für Medizinische Soziologie an der Universität Düsseldorf ergab: Sie zeigt eine deutliche Übereinstimmung der Verteilung des Infektionsrisikos mit regionalen Mustern sozioökonomischer Ungleichheit.[1]
Rassistische Kampagnen von »Bild« und AfD
So gab es zu Beginn der Pandemie höhere Inzidenzraten vornehmlich in sozioökonomisch bessergestellten Landkreisen und kreisfreien Städten. Denn das Virus wurde zunächst vor allem von Reisenden – insbesondere aus Skigebieten wie etwa dem österreichischen Covid-19-Hotspot Ischgl – ins Land gebracht und verbreitet. Allerdings wandelte sich diese Tendenz im weiteren Verlauf der Pandemie und kehrte sich in den am stärksten betroffenen Landesteilen Süddeutschlands (Bayern und Baden-Württemberg) bereits ab Mitte April 2020 um. Seitdem waren zunehmend Menschen betroffen, die in besonders beengten Verhältnissen leben. Dass sich darunter überdurchschnittlich viele Migrant*innen befinden, ist eigentlich keine Überraschung.[2] Ebenso wenig wie die Tatsache, dass deren Anteil unter den prekär beschäftigten Paketbot*innen, Pizzalieferant*innen oder Reinigungskräften, die allesamt nicht ins Homeoffice wechseln können, überproportional hoch ist. Dass sie dementsprechend auch häufiger schwer erkranken und einer intensivmedizinischen Behandlung bedürfen, nutzte die „Bild“-Zeitung im Februar dieses Jahres für eine Kampagne gegen Migrant*innen insbesondere muslimischen Glaubens, denen sie unterstellte, die Infektionszahlen durch ihr Verhalten in die Höhe zu treiben.[3] Für die AfD, die der Verfassungsschutz etwa zur selben Zeit als rechtsextremen Verdachtsfall einstufte, war der Bericht des Boulevardblatts eine Steilvorlage. Schon während der sogenannten Flüchtlingskrise 2015/16 hatten ihre Parlamentsabgeordneten geschickt das Streitthema „Asyl“ mit der angeblich von Geflüchteten ausgehenden Seuchengefahr verbunden, um Ängste bei der einheimischen Bevölkerung zu schüren und Stimmung gegen eine humanitäre Flüchtlingspolitik zu machen.[4] Und auch jetzt wird das Stereotyp des „Fremden“ als Krankheitsüberträger wieder zum Kristallisationspunkt eines rassistischen Diskurses. Dass ausgerechnet Sachsen und Thüringen – wo nur sehr wenige Migrant*innen, aber umso mehr Corona verharmlosende AfD-Wähler*innen leben – im Frühjahr 2021 die höchsten Covid-19-Inzidenzwerte aller Bundesländer aufwiesen, zeigt nur, wie absurd diese Argumentation ist.
Wenngleich kulturelle Faktoren wie beispielsweise große familiäre Gemeinschaften, aber auch Verständigungsschwierigkeiten für die Ausbreitung eines pandemischen Virus keineswegs bedeutungslos sind, kommt den ökonomischen und sozialen Bedingungen die Schlüsselrolle zu. Umso notwendiger ist es, sie endlich deutlicher in den Blick zu nehmen, um die Betroffenen besonders zu schützen, aber vor allem, um die bestehende Ungleichheit nachhaltig zu bekämpfen.
Verharmloste Armut
Daran aber scheint die Bundesregierung kein ernsthaftes Interesse zu haben. Jedenfalls geht sie in ihrem aktuellen Sechsten Armuts- und Reichtumsbericht auf den strukturellen Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit nicht ein. Stattdessen loben die Koalitionsparteien CDU/CSU und SPD die von ihnen getroffenen „Sozialschutz“-Maßnahmen, mit denen sie auf die sozialen Folgen der Pandemie reagierten. Wie sich die Coronakrise langfristig auf die Einkommensverteilung auswirken wird, sei hingegen nicht vorhersagbar: „Die umfangreichen Maßnahmen der Bundesregierung zur Stützung der Einkommen dürften aber negative Effekte gemindert haben“, so die beschönigende Einschätzung des Berichts.[5] Simulationsrechnungen hätten eine ungleichheitsmindernde Wirkung der Maßnahmen ergeben, insbesondere was den Kinderbonus betrifft, also die Auszahlung von 300 Euro pro Kind im Herbst 2020 und von 150 Euro im Frühjahr 2021. Das sozialpolitische Zwischenfazit der Bundesregierung fällt entsprechend positiv aus: „Sozialschutzpakete und weitere Unterstützungsmaßnahmen haben verhindert, dass es zu sozialen Verwerfungen gekommen ist. Arbeitslosigkeit konnte mittels Kurzarbeit weitgehend verhindert werden. Die sozialen Sicherungssysteme haben ihre stabilisierenden Aufgaben erfüllt und konnten durch die enge Abstimmung mit den Sozialpartnern schnell und zielgerichtet angepasst werden.“[6]
Doch wie überzeugend ist diese Einschätzung? Zwar hat sich der Wohlfahrtsstaat in der Tat als „systemrelevant“ erwiesen; seine Schwachstellen und Strukturmängel sind in der pandemischen Ausnahmesituation aber gleichfalls offen zutage getreten. Dem sozioökonomischen Polarisierungseffekt, den die hauptsächlich der Wirtschaft zugutekommenden Finanzhilfen des Bundes nur geringfügig abgemildert und teilweise sogar verstärkt haben,[7] wird im Regierungsbericht zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei gibt es inzwischen genügend Belege dafür, dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich während der Pandemie auch hierzulande weiter vertieft hat.
Verschleierter Reichtum
Zwar entgeht der Reichtum dieses Mal immerhin jenem Nischendasein, das er in den vorangegangenen Berichten fristete. Allerdings beginnt Reichtum für die Bundesregierung erstaunlich früh, während sie bei immens hohen Einkommen und Vermögen nach wie vor nicht so genau hinschaut: So bleibt fragwürdig, warum der Einkommensreichtum bereits bei einem monatlichen Nettoeinkommen von 3894 Euro[8] und Vermögensreichtum bei einem Nettovermögen von 500 000 Euro[9] beginnen soll. Denn man muss gar nicht zu den etwa 120 Multimilliardären im Land gehören, um es kurios zu finden, dass ein Oberstudienrat wegen seines Gehalts für einkommensreich und die Besitzerin einer relativ kleinen Eigentumswohnung in attraktiver Großstadtlage für vermögensreich erklärt wird.
Zwar geht aus dem diesjährigen Armuts- und Reichtumsbericht durchaus hervor, dass die Einkommen und vor allem die Vermögen in Deutschland ungleich verteilt sind. Allerdings wird behauptet, dass die Ungleichheit der Einkommen seit 2005 „relativ stabil“ geblieben sei – damit übernimmt die Regierung ein vom Institut der Deutschen Wirtschaft lanciertes Narrativ. Dieses deckt sich allerdings keinesfalls mit der realen Entwicklung: Am 1. Januar 2005 trat Hartz IV in Kraft, zugleich sank der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer auf 42 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit 1949. Das führte einerseits zu massiven Einkommensverlusten bei Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos oder im wachsenden Niedriglohnsektor beschäftigt sind, sowie andererseits zu höheren Einnahmen bei Spitzenverdienern, Unternehmern und Aktionären. Denn sinkende Löhne sind gleichbedeutend mit steigenden Gewinnen. Zwar sorgte vor allem die Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 dafür, dass die Schere beim Bruttoeinkommen nicht größer wurde. Allerdings wurde sie auch nicht kleiner – trotz einer wachsenden Wirtschaft.[10] Immerhin räumt der Bericht eine hohe Vermögenskonzentration ein, verschleiert aber noch immer deren wachsendes Ausmaß. So finden sich beispielsweise die aktuellen Ergebnisse eines Forschungsprojekts des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung nicht im Papier der Bundesregierung. Demnach entfallen 67,3 Prozent des Nettogesamtvermögens auf das oberste Zehntel der Bevölkerung, 35,3 Prozent konzentrieren sich beim reichsten Prozent und das reichste Promille verfügt immer noch über 20,4 Prozent des Nettogesamtvermögens.[11] Selbst unter den Vermögenden ballt sich der Reichtum also bei wenigen Personen an der Spitze zusammen. Von dieser Extremform sozioökonomischer Polarisierung steht aber im Bericht kein Wort.
Fehlende Tiefenschärfe
Anstelle der Betrachtung von Lebensphasen, die zuletzt im Zentrum der Armuts- und Reichtumsberichte stand und soziale Ungleichheit auf der Ebene biographischer Stationen (Kindheit, Jugend, Erwerbsphase und Ruhestand) erfasste – wodurch das Problem individualisiert und der Alterseffekt verabsolutiert wurde –, ist diesmal eine mehrdimensionale Längsschnittbetrachtung in Fünfjahresschritten getreten, die soziale Lebenslagen in den Mittelpunkt rückt.
Dafür wurde auf Basis eines Forschungsprojekts der Universität Bremen eine Typologie der sozialen Lagen gebildet, welche die Dimensionen Einkommen, Vermögen, Erwerbsintegration und Wohnraumversorgung umfassen. In eine Rangordnung gebracht ergeben sich acht Soziallagen, von „Armut“ ganz unten bis zu „Wohlstand“ und „Wohlhabenheit“ ganz oben. Mit den beiden zuletzt genannten Kategorien trifft man allerdings nicht bloß eine gekünstelt wirkende und sprachlich wenig überzeugende Unterscheidung, sondern lässt auch den Begriff „Reichtum“ – zusammen mit der Armut eigentlich Kern des Berichts – gänzlich verschwinden.
Dabei konstatiert der Bericht eine dramatische Entwicklung, ohne diese in ihrer Brisanz prominent herauszuheben. So heißt es: „Im Fall der Zugehörigkeit zu der im Forschungsvorhaben als ‚Armut‘ bezeichneten Lage ist die Wahrscheinlichkeit, ihr auch in der nächsten Fünfjahresperiode noch anzugehören, seit Ende der 1980er Jahre von 40 auf 70 Prozent angestiegen.“[12] Damit bestätigt der Bericht, dass die soziale Aufwärtsmobilität zuletzt nachgelassen hat, was in der Konsequenz nichts anderes heißt, als dass Armut immer stärker bis in die Mitte der Gesellschaft vordringt und sich verfestigt.
Hier liegt das wohl größte Manko des Sechsten Armuts- und Reichtumsberichts: Er bleibt rein deskriptiv und lässt wieder einmal analytische Tiefenschärfe vermissen, vor allem eine schlüssige Bewertung der Befunde. Nach den gesellschaftlichen, sozioökonomischen und politischen Ursachen der ausführlich beschriebenen Verteilungsschieflage wird gar nicht erst gefragt. Vielmehr geraten nur die Auslöser persönlicher Notlagen wie Erwerbslosigkeit, (Früh-)Invalidität oder Trennung vom (Ehe-)Partner ins Blickfeld. Die gesellschaftlichen Determinanten sozialer Auf- und Abstiege bleiben dagegen im Dunkeln – und mit ihnen die bestehenden Eigentums-, Macht- und Herrschaftsverhältnisse.
Diese aber gilt es langfristig zu verändern, denn sonst bleibt auch die gesundheitliche Ungleichheit bestehen – allen noch so gut gemeinten „Feuerwehreinsätzen“ gegen die Pandemie in Hochinzidenz-Stadtteilen zum Trotz. Viel wäre schon gewonnen, wenn die nächste Bundesregierung den Armuts- und Reichtumsbericht nicht mit einer Erfolgsbilanz ihrer Politik verwechseln, sondern die sozialen Problemlagen und Spaltungstendenzen schonungslos offenlegen würde.
[1] Vgl. Benjamin Wachtler u.a., Sozioökonomische Ungleichheit im Infektionsrisiko mit SARS-CoV-2. Erste Ergebnisse einer Analyse der Meldedaten für Deutschland, in: „Journal of Health Monitoring“, S 7/2020, S. 19 ff.
[2] Vgl. u.a. Felix Römer, Soziale Ungleichheit in der Pandemie. Warum Deutsche weniger darüber wissen als Briten, www.geschichtedergegenwart.ch, 3.3.2021; Das ungerechte Virus, www.sueddeutsche.de, 4.3.2021.
[3] Vgl. RKI-Chef: „Es ist ein Tabu“, in: „Bild“-Zeitung, 3.3.2021.
[4] Vgl. hierzu: Christoph Butterwegge, Gudrun Hentges und Gerd Wiegel, Rechtspopulisten in Parlamenten. Polemik, Agitation und Propaganda der AfD, Frankfurt a.M. 22019, S. 83 f.
[5] Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hg.), Lebenslagen in Deutschland. Der Sechste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Bericht, Bonn, Mai 2021, S. I f.
[6] Ebd. S. II
[7] Vgl. hierzu: Christoph Butterwegge, Ungleichheit in der Klassengesellschaft, Köln 2020, S. 148 ff.; ders., Die polarisierende Pandemie, in: „Blätter“, 3/2021, S. 47 f.
[8] Das entspricht dem zweifachen Medianeinkommen auf Basis des Sozio-ökonomischen Panels 2017.
[9] In Preisen von 2017
[10] Vgl. dazu ausführlich: Thomas Fricke, Deutschlands unterschätzte Spaltung, www.spiegel.de, 7.5.2021.
[11] Vgl. Carsten Schröder u.a., MillionärInnen unter dem Mikroskop: Datenlücke bei sehr hohen Vermögen geschlossen – Konzentration höher als bisher ausgewiesen, in: „DIW Wochenbericht“, 29/2020, S. 517.
[12] BMAS, a.a.O., S. XX.