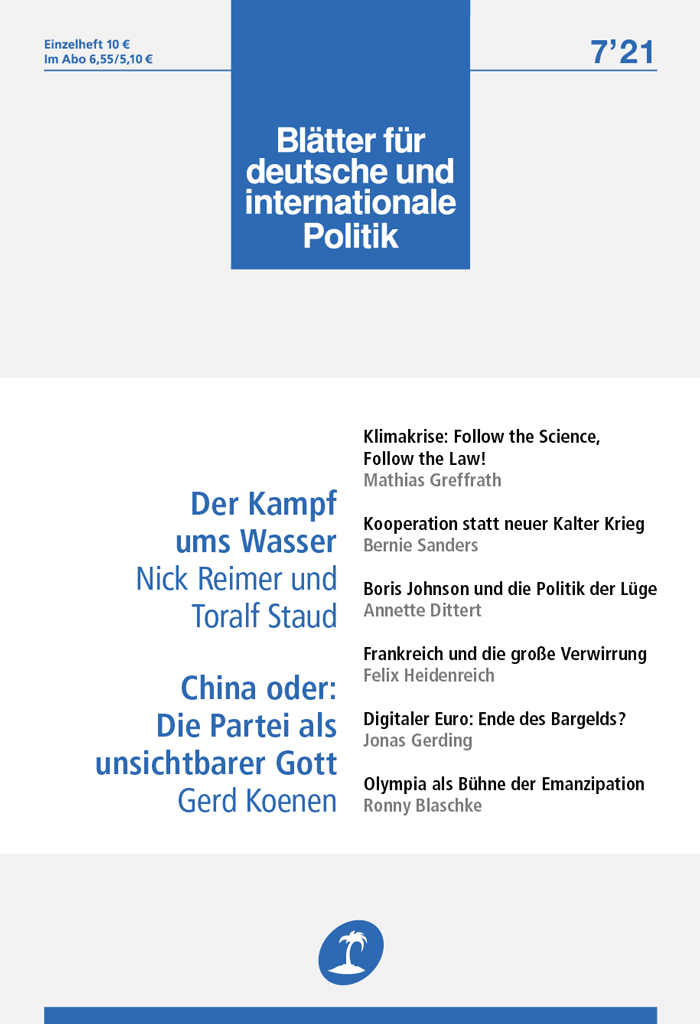Bild: Teilnehmer einer unangemeldeten Demonstration in München gegen die Eskalation der Gewalt in Nahost, 15.5.2021 (IMAGO / ZUMA Wire)
Es entspricht der Logik moderner Medien, das komplexe Weltgeschehen in hochemotionalen Bildern zu vereinfachen und zugleich zu ikonisieren. Von der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hamas im Mai 2021 stehen diese Bilder schon fest – etwa jenes, das die Zerstörung des Medienhochhauses in Gaza durch die israelische Luftwaffe zeigt, oder die 64 Porträtfotos getöteter palästinensischer Kinder auf der Frontseite der „New York Times“ vom 28. Mai.
Hierzulande sind es die Bilder von den Anti-Israel-Demonstrationen in Deutschland, etwa vor der Synagoge in Gelsenkirchen, wo Personen mit Türkei- und Palästinaflaggen „Scheißjuden“ brüllten, die sich im Zusammenhang mit dem jüngsten israelisch-palästinensischen Konflikt einprägen werden. In Bonn und Münster kam es zu ähnlichen Szenen, in Berlin-Neukölln wurden Juden verbal angegriffen und eine israelische Fernsehjournalistin mit Böllern beworfen.
Auf derartige Bilder reagiert die Öffentlichkeit erwartungsgemäß mit Entsetzen. Zugleich wiederholt sich dieses Mal, was auch nach den antiisraelischen Demonstrationen während des Gazakrieges 2014 sowie 2017 nach der Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu beobachten war: Politiker*innen beteuern gebetsmühlenartig, dass Antisemitismus keinen Platz in Deutschland habe. Antisemitismus- und Radikalisierungsexpert*innen werden in Fernsehstudios eingeladen; islamische Verbände aufgefordert, sich von Antisemitismus zu distanzieren. Und einmal mehr wurde auch dieses Mal wochenlang zum einen darüber gestritten, ob es im Land von Luther und Hitler einen „importierten Antisemitismus“ gebe, während zum anderen das Ausmaß des Antisemitismus unter Muslim*innen vielerorts mit der Floskel verschleiert wird, es handele sich dabei um ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und nicht zuletzt stand erneut jede Form der Solidarität mit Palästinenser*innen unter dem Verdacht, antisemitisch motiviert zu sein.
Die jüngste Eskalation im Nahen Osten lässt somit auf vielfältige Weise erneut die Probleme im Umgang mit dem Nahostkonflikt und dem Antisemitismus hierzulande aufscheinen – Probleme, die nur theoretisch gelöst sind, die sich aber praktisch immer wieder aufs Neue stellen: Wie lässt sich Kritik an israelischem Regierungshandeln und Solidarität mit Palästinenser*innen äußern, ohne in antisemitische Klischees zu verfallen? Wie kann man umgekehrt Solidarität mit Israel zeigen, ohne sich dem Leid der Palästinenser*innen zu versperren? Für viele Beobachter*innen zeigte der Konflikt im Mai in schockierender Deutlichkeit, dass diese Fragen allzu rasch von den Erregungsdynamiken nicht nur der sozialen Medien hinweggewischt werden – selbst da, wo man sich bisher einig wähnte.
So übten sich Organisationen, die sonst nicht müde werden, vor der Gefahr des Antisemitismus und Rassismus zu warnen, in groben Vereinfachungen: Der Koordinierungsrat der Muslime erklärte die Israelis kurzerhand zu den Schuldigen für die Eskalation, während der Zentralrat der Juden am gleichen Tag verkündete, die Verantwortung liege „ganz klar“ auf Seiten der Hamas. Routiniert ersetzten Aktivist*innen auf Instagram die Black-Lives-Matter-Slogans auf ihren Profilen mit Palästinaflaggen – meist ohne tiefgehende historische Kenntnis des Konflikts. Gleichzeitig hissten Rathäuser in zahlreichen deutschen Städten Israelfahnen. Auf den Kommentarseiten der großen Medienportale umkreisten und beschimpften sich „Zionisten“ und „Antisemiten“ in den immergleichen Erregungsschleifen.
Der linke Widerspruch
Einseitige Parteinahme scheint somit eine schnelle wie schmutzige Lösung für all jene zu bieten, die sich aus dem Dilemma befreien wollen, zugleich antisemitismussensibel und antirassistisch handeln zu müssen.
Das aber führt letztlich zu einem hochgradig verminten Diskursterrain: In einigen linken, postkolonial ausgerichteten Milieus gilt oft schon der Hinweis auf den historischen Kontext des Nahostkonflikts als relativierend. Das Bedürfnis, das Böse vom Guten zu trennen, ist dabei so groß, das komplexes Hintergrundwissen nur stört. Zionismus ist demnach schlichtweg Rassismus. Eine beeindruckende Volte: Denn wo sonst zu Recht jede Mikroaggression thematisiert und von transgenerationalem Trauma gesprochen wird, spielen jahrhundertelange Judenverfolgung und die Pogrome Europas plötzlich keine Rolle mehr. Selbst der internationale Instagram-Account von Fridays for Future teilte skurrile islamistische Sprachbilder vom „Blut der Märtyrer“.[1]
Auf diese Weise wird ein über Generationen währender militärischer Konflikt immer wieder auf „Rassismus“ heruntergebrochen, den es freilich in der israelischen Gesellschaft ebenso gibt wie in der kanadischen oder der deutschen. Der inflationär geäußerte Vorwurf, in Israel herrsche ein System der Apartheid, wird nicht einmal dann überprüft, wenn eine arabische Partei der israelischen Regierungskoalition beitritt.[2] Stattdessen avanciert eine faschistische Organisation wie die Hamas mit Hilfe eines linken Weichzeichners plötzlich zu einer antirassistischen NGO, gar zu einem Teil der „globalen Linken“ (Judith Butler).
Differenzierungen gehen bei all dem gnadenlos unter. Stattdessen kommt das eigene Unwissen und Desinteresse an der Geschichte des Nahostkonflikts, an der Historie von Israel und Palästina in aller Deutlichkeit zum Vorschein.[3]
Muslimische Solidarisierung
Während sich die proisraelischen und propalästinensischen Lager innerhalb des linken Milieus voneinander relativ klar abgrenzen lassen, erzeugt die Identifikation mit den Palästinenser*innen unter Muslim*innen einen breiten Konsens. Im Mai ließ sich einmal mehr beobachten, wie in sozialen Medien und auf der Straße die Grenzen zwischen legitimer Solidarität mit Palästinenser*innen und Antisemitismus verwischen und so Einheit zwischen verschiedensten Gruppierungen stiften. Oft genug instrumentalisieren dabei diverse politische und religiöse Akteure das palästinensische Anliegen für ihre Zwecke; und oft genug schwingen dabei Interessen mit, die im besten Fall nur am Rande etwas mit der Situation in Nahost zu tun haben. Insbesondere türkische Nationalisten, Graue Wölfe und Islamisten kochen auf solchen Veranstaltungen ihr jeweils eigenes Süppchen.
Schon vor längerem vollzog auch der türkische Premierminister Recep Tayyip Erdoğan einen Kurswechsel der traditionell eher israelfreundlich ausgerichteten Türkei. Dabei bedient er sich in seinen antiisraelischen Reden mittlerweile offen antisemitischer Ressentiments: „Terrorismus“ gegen die Palästinenser liege „in der Natur“ der Israelis, verkündete er beispielsweise im Mai: „Sie sind Mörder, sie töten Kinder, die fünf oder sechs Jahre alt sind. Sie sind erst zufrieden, wenn sie ihr Blut aussaugen.”[4] Der uralte antisemitische Topos vom Kindermord steht damit wieder im Raum, samt impliziter Ritualmordlegende – eindeutiger geht es kaum.
Auch deutsche Islamisten sind auf propalästinensischen Demonstrationen zu finden, etwa die Macher hinter reichweitenstarken Netzkampagnen wie „Realität Islam“ und „Generation Islam“, die ihre fundamentalistische Propaganda oftmals als Antirassismus tarnen.[5] Auch hier dient der gemeinsame Hass auf Juden und Israel als ideologischer Kitt, um versprengte islamische Milieus wieder zusammenzuführen.
Wie über den Hass auf Israel in bestimmten Milieus eine kollektive Identität hergestellt wird, kennen wir auch aus unserer Arbeit mit deutsch-muslimischen Jugendlichen in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main.[6] Muslimische Jugendliche sind keine homogene Gruppe, wie oft suggeriert wird. Ihre Migrationsgeschichten beginnen in verschiedenen Ländern, sie sprechen unterschiedliche Sprachen und gehören zu diversen Strömungen innerhalb des Islams. Dennoch werden sie von islamistischen Agitatoren aus dem In- und Ausland als Kollektiv adressiert und einer gemeinsamen Sache verpflichtet: und zwar der Solidarität mit Palästinenser*innen, die mit einem vereinfachten Feindbild von Israel einhergeht. Diese feindliche Stimmung wird von fremdsprachigen Medien aus islamisch geprägten Ländern angeheizt und im deutschsprachigen Raum vor allem über die sozialen Medien verbreitet.
Solidarität der falschen Freunde
Die Instrumentalisierung palästinensischer Anliegen ist allerdings nichts Neues, sie ist ebenso alt wie der Nahostkonflikt. Die vorgebliche Solidarität etwa der Arabischen Liga, von Ägypten oder Jordanien reicht dabei allerdings nie so weit, palästinensischen Geflüchteten dauerhaft Bürgerrechte zu gewähren oder auch nur ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Diese waren und sind meist lediglich als Faustpfand gegen Israel interessant. Auch das über Jahrzehnte verlängerte und institutionalisierte Elend in den Auffanglagern und die weltweit einzigartige Konstruktion eines vererbbaren Geflüchtetenstatus der Palästinenser ist mit Solidarität nicht zu vereinbaren.
Es ist daher auch kein Zufall, dass viele vermeintliche Pro-Palästina-Organisationen schweigen, wenn Palästinenser*innen einmal nicht unter israelischer, sondern beispielsweise unter der syrischen Politik leiden: So leben rund 91 Prozent der dortigen Palästinenser*innen in absoluter Armut.[7] Für die Öffentlichkeit ist das aber kaum ein Thema.
Um so wichtiger aber ist es, in den Diskursen rund um den Nahostkonflikt danach zu fragen, wer Solidarität übt und wie beide Seiten mit einseitigen Solidaritätsbekundungen ihrer vermeintlichen Freunde umgehen sollten.
Schon aus demokratietheoretischer Perspektive muss Solidarität mit den Palästinenser*innen als Form der Meinungsäußerung in Deutschland möglich sein. Diese Form der Solidarität existiert, sie hat ihre Berechtigung, und sie ist nicht per se antisemitisch. Ihre einseitige Sanktionierung kann jedoch auf Dauer das Vertrauen in staatliche Einrichtungen erodieren.
Denn die uneingeschränkte, wenn auch oft nur symbolische Solidarität der Bundesregierung mit Israel wirkt auf einer repräsentativen Ebene verdrängend, sie tabuisiert Solidarität mit den Palästinenser*innen und macht sie damit paradoxerweise für bestimmte politische Lager attraktiver: Wenn Palästinasolidarität nur in Schmuddelecken stattfinden kann, wenn Städte aufgrund eines bloßen Verdachts auf Antisemitismus propalästinensische Demos verbieten, wenn nur Aufrufe wie „Free Palestine“ oder die Kritik an dem militärischen Vorgehen Israels als Judenfeindschaft delegitimiert werden und wenn dieser Kritik nicht argumentativ, sondern institutionell begegnet wird – in all diesen Fällen hat antisemitische Agitation ein leichtes Spiel. Denn hier finden Judenfeinde dann einen vermeintlichen Beleg für das verbreitete Phantasma einer jüdischen Allmacht.
Auch die Israelsolidarität hat „falsche“ Freunde. Der AfD etwa bietet der Konflikt in Nahost vor allem einen willkommenen Anlass, um gegen Muslim*innen zu hetzen, das haben auch ihre Parteistrategen erkannt. Im antideutschen Teil der hiesigen Linken herrscht wiederum eine Kälte und Empathielosigkeit gegenüber der palästinensischen Seite vor, die dem gedanken- und geschichtslosen Israelhass des antiimperialistisch-postkolonialen Lagers in nichts nachsteht. Diese Haltung zeigte sich beispielsweise dann, wenn Antideutsche mit der Kampfansage „Palästina, halt’s Maul!“ zu Protestaktionen ausrufen oder wenn sie mit dem Slogan „Transform Gaza to Garzweiler“ darüber fantasieren, Gaza einzuebnen.[8] Opfer in der palästinensischen Zivilbevölkerung sind den Antideutschen gerade noch eine Randnotiz wert, die von allen Seiten bedrohte palästinensische Friedensbewegung fällt ebenso oft unter den Tisch, und über jüdische Rechtsradikale will man auch nicht reden.
Abschied von simplen Erklärungsmustern
Wie aber entkommen wir einem derart polarisierten und verhärteten Diskurs? Zunächst einmal sollten wir nicht zulassen, dass Islamisten und türkische Nationalisten auf der einen sowie Neue Rechte und Netanjahu-Fans auf der anderen Seite die Diskussion hierzulande dominieren. Wer Solidarität ernst meint, darf sich nicht mit fundamentalistischen und nationalistischen Kräften verbinden.
Das bedeutet aber auch, sich von simplen Erklärungsmustern zu verabschieden – auch wenn sich mit Differenzierungen schlecht mobilisieren lässt und dies der Eskalationslogik sozialer Medien widerspricht. Im Zentrum sollte nicht länger die Frage stehen, welche Seite recht hat oder die moralisch überlegenere ist, sondern wie moderate und friedliche Kräfte auf beiden Seiten unterstützt werden können. Wer hier bereits abwinkt, muss sich fragen, ob die eigene, vorgebliche Solidarität nicht im Zweifel doch nur eigene Bedürfnisse befriedigt. Bleibt eine solche kritische Selbstbefragung aus, gibt es kein Entkommen aus dem Teufelskreis der Vorurteile, der Anfeindungen und des Hasses – und letztendlich auch keinen gesellschaftlichen Frieden.
[1] Vgl. Fridays for Future Deutschland distanziert sich von antisemitischem Beitrag, www.spiegel.de, 19.5.2021.
[3] Exemplarisch zeigte sich diese Schieflage jüngst beim Antirassismusfestival „Dear White People“, an dem der Autor teilnahm: Vgl. Meron Mendel, Verhärtete Kommunikation, www.taz.de, 14.6.2021.
[4] USA werfen Erdoğan Antisemitismus vor, www.faz.net, 19.5.2021.
[5] Vgl. dazu Johanna Sagmeister, Radikale Muslime auf Instagram – Wenn der Schein trügt, www.zdf.de, 22.11.2020.
[6] Vgl. Saba-Nur Cheema, Antisemitische Narrative in deutsch-islamistischen Milieus, www.bpb.de, 21.1.2020.
[7] Vgl. Syria: 10 Years of Multiple Hardships for Palestine Refugees, Pressemitteilung der UNRWA, www.unrwa.org, 15.3.2021.
[8] Vgl. Königlich Bayerische Antifa, Vernichtungsfantasien sind keine Israelsolidarität…, www.facebook.com, 13.11.2018.