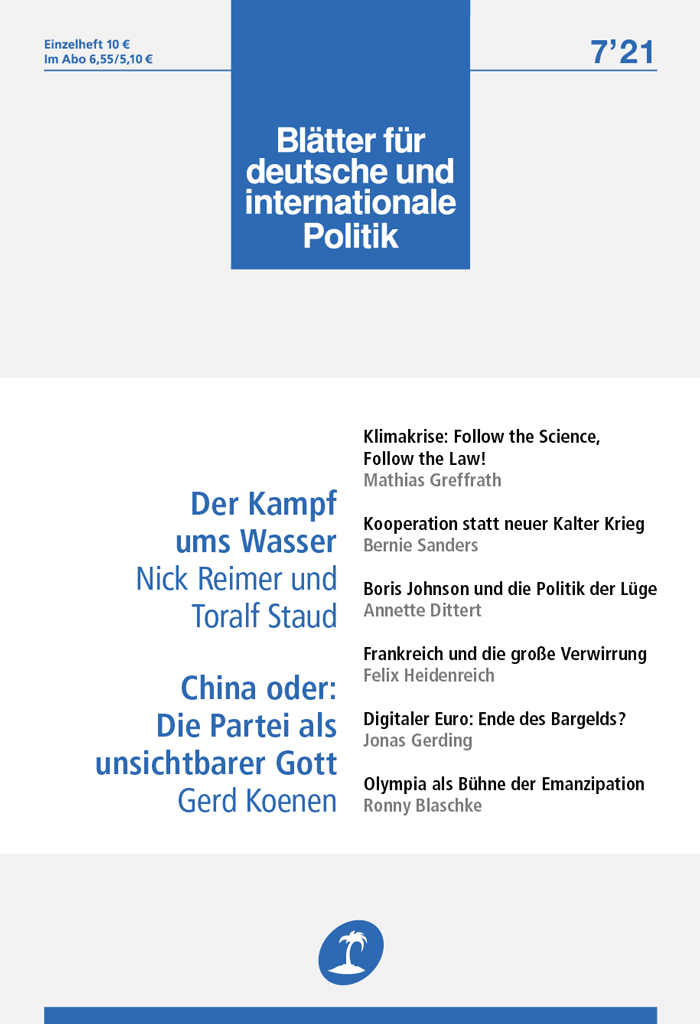Die Olympischen Spiele als Bühne der Emanzipation
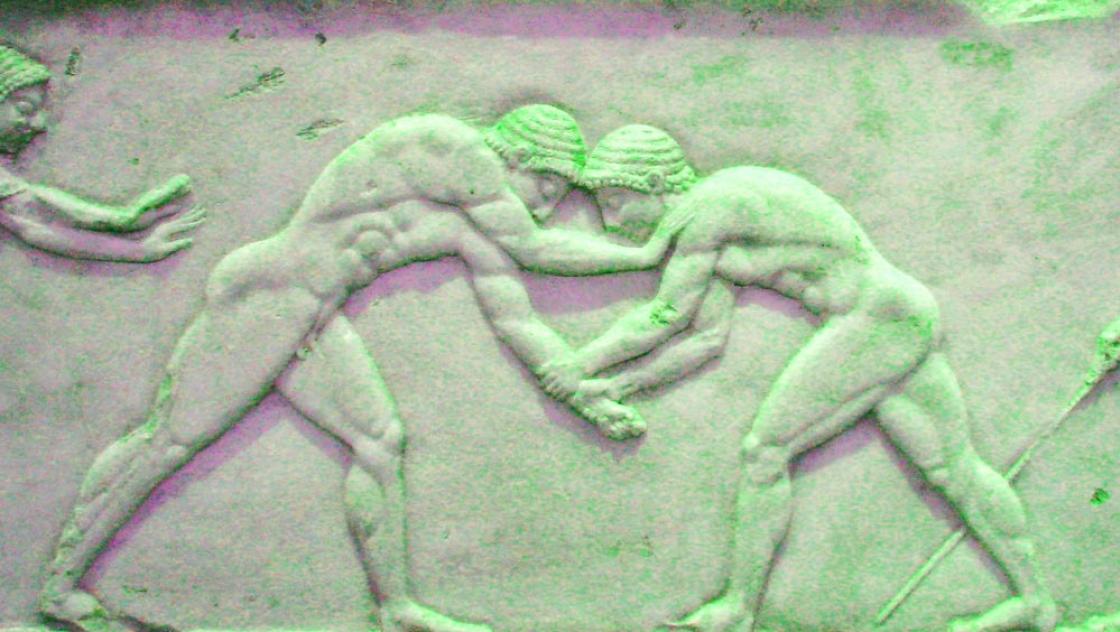
Bild: Statuenbasis eines Kouros in Athen in der Themistokleischen Mauer (Public Domain)
Eigentlich war das größte Sportereignis der Welt bereits für den Sommer 2020 geplant. Doch wegen Corona wurden die Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr verschoben, sie sollen nun zwischen dem 23. Juli und 8. August stattfinden. Die japanische Regierung erhofft sich von Olympia große Impulse für Stadtentwicklung, Tourismus und die Handelsbeziehungen. Doch die Pandemie ist weiterhin nicht besiegt. Und so ist aus einem Ereignis, das für Aufbruch und Optimismus stehen sollte, ein Symbol für Zweifel und Pessimismus geworden. In Japan wurde der Notstand mehrfach verlängert, etliche Krankenhäuser meldeten Überlastung, die Impfungen gehen nur langsam voran. Seit über einem Jahr lässt Japan keine Touristen ins Land – und nun sollen zehntausende Athleten, Betreuer und Journalisten einreisen. Mediziner warnen bereits vor einem Kollaps des Gesundheitssystems und vor einer weltweiten Verbreitung neuer Virusmutationen. Die Konsequenz: In Umfragen sprachen und sprechen sich zwischen 60 und 83 Prozent der Japaner für eine Absage oder erneute Verschiebung der Spiele aus. Rund 10 000 der 80 000 freiwilligen Helfer zogen bereits ihre Teilnahme zurück.
Warum aber halten die japanische Regierung und das Internationale Olympische Komitee (IOC) so hartnäckig an ihren Plänen fest? Die Antwort fällt leicht: Es geht ums Geld. Genauer gesagt: Es geht um viele Milliarden. Nach der Vergabe der Spiele an Tokio 2013 rechneten die Organisatoren mit Gesamtkosten von etwa 5,5 Mrd. Euro. Doch wie so oft wurden einige Sportstätten erheblich teurer; inzwischen gehen einige Schätzungen von Gesamtkosten von zwanzig Mrd. aus. Fallen die Spiele aus, lassen sich diese Summen so bald nicht refinanzieren. Rund um die letzten Olympischen Spiele – 2016 in Rio de Janeiro – nahm das IOC um die 5,7 Mrd. Euro ein, fast drei Viertel durch den Verkauf von Medienrechten. Als wichtigster Geldgeber zahlt das US-Sendernetzwerk NBC dem IOC mehr als sechs Mrd. für Übertragungsrechte bis zu den Spielen 2032. Für den Olympia-Sommer 2020 hatte NBC bereits Werbezeit im Wert von einer Mrd. Euro verkauft. So wie NBC mussten auch andere Sponsoren, darunter viele börsennotierte, ihre Jahreskalkulationen für 2020 völlig ändern.
Sollten die Spiele nun endgültig abgesagt werden, droht dem Gastgeber und seinen Sponsoren japanischen Medien zufolge ein Verlust von zehn Mrd. Euro. Aus Japan selbst haben sechzig Unternehmen fast 2,5 Mrd. Euro für Sponsoringrechte ausgegeben. Nie in der olympischen Geschichte haben private Sponsoren so viel Geld aufgebracht. „Die Chefs der größeren japanischen Konzerne, überwiegend betagte Personen, wissen ganz genau, dass gute Beziehungen zur Regierung wichtig für künftige Großaufträge sind“, sagt der Journalist Felix Lill, der für deutsche Medien über Japan berichtet. „Seit Ende des Zweiten Weltkrieges hat fast immer die konservative Liberaldemokratische Partei (LDP) regiert. Insofern ist die Erfolgsformel für Unternehmen einfach. Am besten stellt man sich mit der LDP gut. Dazu gehört auch, bei Olympia spendabel und unkritisch zu sein.“
Sport, Wirtschaft, Politik, dieses Geflecht rund um Olympia ist nicht neu, sondern besteht seit inzwischen 125 Jahren – seit am 6. April 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit eröffnet wurden. 241 Sportler gingen damals in Athen an den Start, weiße Europäer und Amerikaner mit europäischen Wurzeln, überwiegend christlich und gut situiert, außerdem keine Frauen und wenige Arbeiter. Gestattet waren sogenannte Amateure, die ihr Geld nicht mit Muskelkraft verdienten. „Olympia war ein elitärer Klub von Adligen und Großbürgern“, sagt der britische Publizist David Goldblatt. „Das Ethos englischer Privatschulen wurde in die Welt getragen: Auch Sport sollte den Charakter junger Männer formen, um über ein Imperium zu herrschen.“ Für Pierre de Coubertin, den Gründer der modernen Olympischen Spiele, war Sport eine spirituelle Angelegenheit mit Anleihen aus der Antike: ein Spielfeld für Tapferkeit und das Zusammenspiel von Körper und Geist. De Coubertin wollte keine Bühne für politische Debatten schaffen, und schon gar nicht über Rassismus, Sexismus oder soziale Ungleichheiten reden. Doch die Geschichte holte ihn schnell ein: Die Olympischen Spiele wurden zum Schauplatz für das gesellschaftliche Ringen um Emanzipation und Teilhabe – und sie sind es bis heute geblieben.
Republikanische Alternativen
Dabei hätte durchaus schon der Beginn der Spiele anders – nämlich egalitärer – ausfallen können. Bereits Ende des 18. Jahrhunderts, kurz nach der Französischen Revolution, versammelten sich in Paris zehntausende Menschen zu Volksfesten mit Pferderennen, Feuerwerken und Heißluftballons. Auf dem Marsfeld, wo heute der Eiffelturm steht, fanden Wettbewerbe im Laufen und Ringen statt, auch im Schießen auf Lebensmittel und im Klettern an Stangen. Mit dabei waren Männer aus allen Schichten, Metzger, Hutmacher, Soldaten, und vereinzelt auch Frauen.[1]
Einige Historiker bezeichnen diese Wettbewerbe denn auch als „Republikanische Olympiade“. „Die Menschen haben sich das Recht auf politische und auch auf sportliche Partizipation genommen“, sagt der Berliner Journalist Martin Krauß, der ein Buch über die Sportgeschichte mit dem Fokus auf Teilhabe verfasst. „Auch der Sport half den Menschen dabei, den öffentlichen Raum zu erobern.“ Zwischen dem 17. und späten 19. Jahrhundert griffen dutzende Sportbewegungen Elemente des antiken Olympia auf, vor allem in Großbritannien und in Griechenland, aber auch während der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung. „Viele Spiele waren von einer großen sozialen Offenheit geprägt“, sagt Krauß. „Doch diese Offenheit stieß meistens auf politische Widerstände und war nicht von Dauer.“
So setzte der französische Aristokrat de Coubertin ganz bewusst vor allem auf die Unterstützung der Ober- und gehobenen Mittelschicht; dabei halfen ihm seine guten Kontakte zu solventen Mäzenen und Monarchen.
Welche Folgen das daraus resultierende Überlegenheitsdenken haben konnte, zeigten die dritten Olympischen Spiele, die 1904 im Rahmen der Weltausstellung von St. Louis stattfanden. Zum Rahmenprogramm gehörten die „Anthropologischen Tage“. Ethnologen ließen indigene Menschen nach St. Louis bringen, auch aus Japan und den Philippinen. „Die Indigenen wurden rassistisch vermessen und bei Sonderwettbewerben vorgeführt“, sagt der amerikanische Olympiaexperte Jules Boykoff. Einige indigene Läufer überquerten bei einem Rennen zeitgleich die Ziellinie. Boykoff: „Man könnte das als Solidarität interpretieren. Aber die Organisatoren bewerteten die Geste als Rückständigkeit von Wilden.“
Im Zeichen eines kolonialen Weltbilds
In den Anfangsjahren Olympias dominierte ein koloniales Weltbild die Sportstrukturen. Doch dieses Weltbild wurde von großen Begabungen immer wieder herausgefordert. Bereits bei den Spielen 1912 in Stockholm gewann der indigene Amerikaner Jim Thorpe zweimal Gold. Sein Landsmann William Hubbard siegte 1924 in Paris als erster Afroamerikaner in einer Einzeldisziplin, dem Weitsprung. Zu jener Zeit mussten indigene und schwarze Amerikaner mit massiven Angriffen bis hin zum Lynchmord rechnen.[2]
In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg war keineswegs klar, dass die olympische Bewegung überleben würde. Die bereits angedachten Spiele 1916 in Berlin hatten wegen des Krieges ausfallen müssen. Und Olympia war damals noch keinesfalls ein Massenphänomen. Die Wiederaufnahme folgte dann jedoch schon wenige Monate nach dem Krieg, mit den Spielen 1920 in Antwerpen. Die Ausrichter verzichteten dabei auf eine Einladung an die Kriegsverlierer, und so fehlten Sportler aus Deutschland, Österreich, Ungarn, Bulgarien und dem Osmanischen Reich. Gleiches galt für Russland nach der Oktoberrevolution. Aber auch bei den teilnehmenden Sportlern hielt sich die Vorfreude in Grenzen. Die USA waren nach dem Krieg noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Passagierschiffe waren derart ausgebucht, dass Athleten den Atlantik auf der „Princess Matoika“ überqueren mussten, einem Militärschiff, das zuvor 1800 gefallene Soldaten in die USA transportiert hatte. Der Sportfunktionär Daniel Ferris berichtete: „Wir haben noch die Särge gesehen. Der ständige Geruch nach Formaldehyd war schrecklich. Die Sportler schliefen in Dreietagenbetten, dort gab es auch Ratten.“[3]
Zur Eröffnungsfeier strömten tausende Besucher durch das Stadiontor. Viele blieben an einer Statue stehen. Sie zeigte keinen Athleten, der einen Diskus warf, sondern einen Soldaten mit Granate. „Das IOC und die Gastgeber setzen auch 1920 auf kämpferische Symbole“, sagt der belgische Sporthistoriker Roland Renson, der mit „The Games Reborn“ das Standardwerk über die damaligen Spiele geschrieben hat. Im Innenraum des Stadions säumten belgische Soldaten das Feld. Salutschüsse, Friedenstauben, erstmals in der Geschichte erfolgte der olympische Eid: Victor Boin beschwor einen „ritterlichen Geist“ – im Krieg hatte der belgische Wasserballer feindliche U-Boote zerstört.
Ein Plakat mit dem Aufruf an freiwillige Helfer zierte einen Soldaten, darüber der Schriftzug: „Zusammen trainieren, zusammen aufbrechen, zusammen kämpfen.“ Besonders beliebt war der belgische König, der gegen das Vordringen der deutschen Armee lange Widerstand geleistet hatte. „König Albert trat während der Olympischen Spiele in Uniform auf, zwischen den Wettbewerben besuchte er Krankenhäuser“, sagt der belgische Sportpublizist Jasper Truyens. Der König legte Wert auf den Austausch mit Sportlern, zum Beispiel mit dem Langstreckenläufer Joseph Guillemot. Der Franzose hatte seit einer Senfgas-Vergiftung im Krieg mit Schmerzen in der Lunge zu kämpfen; trotzdem gewann er in Antwerpen Gold über 5000 Meter.[4]
Die emanzipatorische Lücke: Der Kampf der Frauen um Teilhabe am Sport
Obwohl in Antwerpen 1920 schon die siebten Olympischen Spiele der Neuzeit stattfanden, klaffte noch immer eine gewaltige emanzipatorische Lücke: Frauen durften nur vereinzelt und in wenigen Disziplinen mitwirken, bei Golf, Tennis oder Bogenschießen. Pierre de Coubertin hatte eine klare Haltung dazu: „Die Frau ist eine Gefährtin des Mannes und die zukünftige Mutter der Familie. Ihre Hauptaufgabe sollte darin bestehen, die Sieger zu krönen.“
Alice Milliat wollte das nicht akzeptieren. Die französische Lehrerin war im Schwimmen aktiv, nahm an Autorennen teil, bestritt ein Ruderrennen über achtzig Kilometer. Milliat lebte vorübergehend in London, wo sie sich mit den Suffragetten beschäftigte, einer der wichtigsten Frauenrechtsbewegungen im frühen zwanzigsten Jahrhundert. Sie lernte Sportlerinnen kennen, die von ähnlichen Erfahrungen berichteten: Von Trainingsübungen in langen Hosen, versteckt hinter Mauern und Büschen.
Mit einem Brief wandte sich Milliat 1919 an das Internationale Olympische Komitee, darin forderte sie die Gleichberechtigung von Frauen bei Olympia. Milliat dachte, dass die Zeit dafür endlich reif sei: Während des Ersten Weltkrieges hatten Millionen Frauen in Fabriken „ihren Mann stehen“ müssen. Inzwischen war in einigen Ländern das Frauenwahlrecht eingeführt worden. Doch das IOC lehnte die Gleichbehandlung weiter ab. Alice Milliat ging ihren eigenen Weg und gründete einen internationalen Frauensportverband. Vor hundert Jahren, im März 1921, organisierten sie die ersten Frauenweltspiele in Monte Carlo. Auf einem Platz für Tontaubenschießen nahmen sich Sportlerinnen aus fünf Ländern die Freiheit, in kurzen Hosen zu laufen, zu springen und zu werfen. Was für ein Skandal! Für die männlich geprägten Zeitungsredaktionen waren Sportlerinnen damals exotische Aussätzige. Beispielhaft dafür steht die italienische Radrennfahrerin Alfonsina Strada, die sich 1924 mit dem männlichen Vornamen Alfonsin an den Start des Giro d’Italia mogelte. Oder die Amerikanerin Gertrud Ederle, die 1926 als erste Frau den Ärmelkanal durchschwamm.[5] Doch Alice Milliat wollte über derartige Schlagzeilen hinaus Strukturen schaffen. Im August 1922 fanden die zweiten Weltspiele in Paris statt, dieses Mal als „Frauen-Olympia“ mit 20 000 Zuschauern. Im Zentrum: die Leichtathletik, die das IOC bei seinen Olympischen Spielen nicht für Frauen öffnen wollte. „Das IOC fürchtete Konkurrenz und untersagte Milliat die Nutzung des Namens Olympia“, erinnert die Sportsoziologin Petra Tzschoppe von der Universität Leipzig. „Die Sportfunktionäre wollten die Frauen wieder unter Kontrolle bringen.“
Arbeiterinnen und Arbeiter gegen Diktatoren
Bei den dritten Weltspielen 1926 in Göteborg waren dann bereits Frauen aus zehn Ländern vertreten. Alice Milliat schrieb unverdrossen weiter Briefe an die Sportfunktionäre – und irgendwann gab das IOC nach. 1924 taucht der Begriff Frauen erstmals in der Olympischen Charta auf. Die Olympischen Spiele 1928 in Amsterdam wurden dann in ihrem Kernbereich, der Leichtathletik, für Frauen geöffnet. Den Lauf über 800 Meter gewann die Deutsche Lina Radke. Doch viele Journalisten wollten sich nicht an erschöpfte Frauen gewöhnen, die Zeitung „De Maasbode“ notierte: „Es war ein erbarmungswürdiger Anblick, diese Mädchen nach dem Einlauf wie tote Spatzen zu Boden purzeln zu sehen.“ So kam es, dass Frauen bis 1960 keine Olympischen Rennen mehr über 200 Meter bestreiten durften.
Die Weltspiele der Frauen fanden bis 1934 noch zweimal statt. Doch als das IOC weitere Wettbewerbe öffnete, verzichtete der Frauenverband im Gegenzug auf eigene Veranstaltungen. Alice Milliat zog sich ernüchtert aus dem Sport zurück; den Weg zur Gleichstellung im Sport mussten andere Frauen fortsetzen: Die US-Läuferin Kathrine Switzer nahm 1967 als erste Frau am Boston-Marathon teil – gegen den Willen des Renndirektors, der Switzer von der Strecke drängen wollte. Ihre Landsfrau, die Tennisspielerin Billie Jean King, forderte Anfang der 1970er Jahre höhere Preisgelder und startete eine Turnierserie für Frauen. Die marokkanische Hürdenläuferin Nawal El Moutawakel gewann bei den Olympia 1984 als erste Muslimin Gold.[6]
Die Frauenweltspiele ab den 1920er Jahren waren nicht die einzige Bewegung, die das Establishment der Olympier herausforderte. „Die Arbeiter ermöglichten den Wirtschaftsaufschwung, trotzdem wurden sie aus wichtigen Organisationen herausgehalten“, stellt David Goldblatt fest, Autor des Olympia-Standardwerkes „Die Spiele“. Alternativ gründeten Arbeiter Gewerkschaften, Krankenhäuser und eben auch Sportvereine. Der 1920 gegründete Internationale Arbeitersportverband lehnte Rekorde und Kommerz bei Olympia ab. Stattdessen warb er für das Wohlbefinden von Fabrikarbeitern, die wenig Freizeit hatten. Mehr als 150 000 Zuschauer verfolgten die Eröffnungsfeierlichkeiten der ersten Arbeiterolympiade 1925 in Frankfurt; bei den Olympischen Spielen waren es bis dahin stets weniger gewesen. Ein Chor mit 1200 Mitgliedern trug die Internationale vor. Es folgten Großveranstaltungen dieser Art in Wien und Antwerpen. 1936 wollten sozialistische Politiker in Spanien ein Zeichen gegen Hitlers Olympische Spiele in Berlin setzen. 6000 Athleten hatten ihre Teilnahme an der „Volksolympiade“ in Barcelona angekündigt, auch deutsche und italienische Sportler aus dem Exil. Die Spiele mussten jedoch abgesagt werden, weil der Spanische Bürgerkrieg ausbrach.[7]
Es begann die Zeit, in der Diktaturen aus Deutschland, Italien oder Japan den Sport vereinnahmten. Der italienische Läufer Luigi Beccali, Sieger über 1500 Meter bei den Spielen 1932 in Los Angeles, war der erste Sportler, der bei einer olympischen Medaillenzeremonie den faschistischen Gruß zeigte. Doch etliche Athleten verkörperten eine andere Haltung, mit sportlichen Erfolgen und politischen Gesten. In Berlin 1936 wurde der schwarze US-Sprinter Jesse Owens mit vier Goldmedaillen zur Ikone. In seinem Schatten gewannen zahlreiche jüdische Athleten Medaillen; sie kamen aus Ungarn, Österreich und Kanada. Das wohl größte Risiko ging 1936 der Läufer Sohn Kee-chung aus Korea ein, damals eine besetzte Provinz Japans. Sohn verweigerte Unterschriften in der japanischen Schreibweise und nach seinem Sieg im Marathon wandte er bei der Medaillenzeremonie den Blick demonstrativ von der japanischen Flagge ab. In seiner Heimat stand er fortan unter ständiger Kontrolle und durfte während der japanischen Herrschaft seinen Sport nicht mehr betreiben.[8]
Die Olympischen Spiele 1940 in Tokio mussten wegen des Zweiten Weltkrieges ausfallen, und auch nach dem Krieg war es nicht klar, ob es für Olympia noch eine Chance geben würde. Besonders sichtbar wurde das in Großbritannien, dem planmäßigen Austragungsort der Spiele von 1948. Der Staat vor dem Kollaps, ein Viertel des Volksvermögens: vernichtet. London: eine Stadt in Ruinen. In dieser Atmosphäre strömten am 29. Juli 1948 mehr als 80 000 Menschen ins Wembley-Stadion zur Eröffnung der ersten Olympischen Spiele nach dem Krieg. „Ein ganzes Jahr teurer Vorbereitungen für den Empfang einer Armee von ausländischen Athleten“, schrieb der „Evening Standard“ und machte so Stimmung gegen den neuen Labour-Premierminister Clement Attlee, Nachfolger des abgewählten Kriegspremiers Winston Churchill.
An ein Olympisches Dorf war in London nicht zu denken. Die meisten Hotels waren zerstört. Bauarbeiter konzentrierten sich auf Krankenhäuser und Wohnungen. Innerhalb von drei Tagen wurden Klassenräume in Schlafsäle umgewandelt. Auch Kasernen, Jugendherbergen und Unterkünfte von Krankenschwestern hießen Athleten willkommen. Es mangelte an allem. Die Schweizer spendeten Turngeräte, die Finnen und Norweger Holz für das Basketballparkett. Aus einer Luftabwehrbasis wurde eine Radrennbahn. Bei den Organisatoren war eine Gruppe allein damit beschäftigt, Ansprechpartner und Flaggen der nach dem Krieg neu entstandenen Staaten zu finden. Ein Orchester sollte alle Hymnen einspielen, doch die Musiknoten aus Jugoslawien oder Rumänien waren nicht so schnell zu bekommen.[9]
Die Hoffnung vieler Briten war groß, dass ein reibungsloses Sportfestival wieder Touristen und Investoren ins Land locken würde. Premier Attlee setzte gegen Widerstände durch, dass Sportler eine höhere Essensration erhielten: 3900 statt 2600 Kalorien am Tag, so wie Arbeiter in der Schwerindustrie. Trotzdem reichte das für viele nicht aus: Sportler aus Frankreich verkauften Wettkampftickets ihrer Familien auf dem Schwarzmarkt. Andere gingen in ihrer Olympia-Kleidung von Imbiss zu Imbiss, dort gewährte man ihnen aus Bewunderung eine Extraportion.
Doch aus Skepsis wurde Stolz. Am Tag nach der Eröffnung wurden aus dem Postamt in Wembley 66 000 Briefe und Karten verschickt, ein Rekord. „Mit jedem Tag wuchs die Begeisterung“, sagt die Autorin Janie Hampton, die das wohl wichtigste Buch zu 1948 veröffentlicht hat: „The Austerity Olympics“, Spiele der Entbehrung. „Olympia“, so Hamptons Fazit, „entwickelte sich zu einem sinnstiftenden Ereignis.“
Nach 1945: Immer größere Spiele, immer mehr Politik
Nach den Spielen von London wuchs die olympische Bewegung denn auch rasant – und damit ihre politische Bedeutung. Immer mehr wurden die Spiele auch zu einer Bühne der Politik.
Dabei sprach sich der amerikanische IOC-Präsident Avery Brundage, im Amt von 1952 bis 1972, offiziell gegen eine Politisierung der Spiele aus. Dennoch akzeptierte das IOC unter seinen Mitgliedern faschistische Sympathisanten wie den italienischen General Giorgio Vaccaro oder den französischen Kollaborateur Marquis de Polignac. Auch Reginald Honey, ein Unterstützer der südafrikanischen Apartheidpolitik, wurde aufgenommen. Einst gegründet von europäischen Aristokraten, kooperierte das IOC auch mit autokratischen und diktatorischen Regimen, zum Beispiel im Jahr der globalen Studentenbewegung 1968: Wenige Tage vor Beginn der Sommerspiele in Mexiko City eröffnete das mexikanische Militär das Feuer auf demonstrierende Studenten, rund 300 Menschen starben. Oder auch 1988: Die Sommerspiele in Seoul sollten den Aufstieg Südkoreas zur Industrienation symbolisieren. Während der Wettkämpfe wurden öffentliche Plätze streng überwacht, und die Polizei ging mit Schlagstöcken und Tränengas auf Demonstranten los. [10]
Immer wieder fühlten sich gesellschaftliche Netzwerke von den IOC-Funktionären nicht wahrgenommen; immer wieder starteten sie für ihre Emanzipation und Selbstbehauptung eigene Bewegungen. So organisierte der deutsch-jüdische Neurologe Ludwig Guttmann im England der Nachkriegszeit Wettbewerbe für Kriegsversehrte – das Fundament für die späteren Paralympics. Der amerikanische Arzt und Olympiateilnehmer Tom Waddell rief Anfang der 1980er Jahre die „Gay Games“ ins Leben, die Weltspiele für Homosexuelle. Und seit 1932 treffen sich im Zuge der zionistischen Bewegung alle vier Jahre Tausende jüdische Athleten aus aller Welt in Israel zur Makkabiade. Alle diese Bewegungen griffen die Gemeinschaftsidee Olympias auf – und entwickelten diese mit politischem Anspruch in ihrem Sinne weiter.
Im Banne des Kalten Krieges
Das überragende Thema in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war auch im Sport der Kalte Krieg. Beim olympischen Fußballturnier 1952 in Helsinki trafen die Mannschaften aus Jugoslawien und der Sowjetunion aufeinander – ein symbolisches Ringen innerhalb des Kommunismus, da Tito wenige Jahre zuvor mit Stalin gebrochen hatte und einen eigenen Weg gehen wollte. Die UdSSR verlor und schied aus. Der Moskauer Armeeklub ZSKA, der das Gerüst des sowjetischen Olympiateams stellte, wurde daraufhin aufgelöst und erst nach Stalins Tod wiederbelebt.[11]
Vier Jahre später, 1956, war Melbourne als olympischer Gastgeber an der Reihe. Sportler aus Ungarn und der Sowjetunion gingen auf der gemeinsamen Schiffanreise aufeinander los, denn in Ungarn fand zur gleichen Zeit der Volksaufstand gegen die sowjetische Besatzung statt. Als später im Wasserballturnier die Teams der UdSSR und Ungarns aufeinandertrafen, begrüßten hunderte australische Zuschauer mit ungarischen Wurzeln die ungarischen Spieler mit selbstgemalten Bannern: „Bleibt in Australien!“ Und auch die anfänglich so heiteren Spiele von München 1972 wurden mit den brutalen Morden an elf israelischen Sportlern durch palästinensische Terroristen sehr bald von der Weltpolitik überschattet.
Olympia war eine der wenigen Bühnen, wo der Ostblock den Westen überholen konnte. Deshalb investierten etliche sozialistische Staaten sehr viel Geld in Training, Stadien und Doping. Besonders deutlich wurde dies bei den Spielen 1976 in Montreal: Sieben der ersten zehn Nationen im Medaillenspiegel wurden sozialistisch regiert. Jahrzehntelang wurden Gesten, Symbole und Kommentare bei Olympia genau gedeutet. In der Tschechoslowakei etwa unterstützte die Turnerin Věra Čáslavská 1968 den Prager Frühling. Nach dem Einmarsch von Truppen des Warschauer Paktes tauchte sie unter und trainierte vorübergehend in einem Wald. Trotzdem sollte Čáslavská bei Olympia Gold für den Ostblock gewinnen. Ihre sechs Medaillen von Mexiko City 1968 widmete sie prägenden Figuren des Prager Frühling. Nach ihrer Rückkehr wurde sie geächtet und erst 1989 rehabilitiert.[12]
Nach dem Höhepunkt des sportlichen Kalten Krieges – dem westlichen Boykott der Spiele in Moskau 1980 nach dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan und der Revanche sozialistischer Länder, ihrem Fernbleiben vier Jahre später in Los Angeles – entspannte sich die Lage ab 1989/90 und dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
Damit endete auch die Hochphase der Politisierung des Sports. Ab den 1990er Jahren dienten die Olympischen Spiele in erster Linie als lukrative Bühne für Sponsoren, aber auch als Anstoß für Stadtentwicklung und als Forum für gesellschaftliche Debatten. Die Spiele 1992 markieren den Wandel der grauen Industriestadt Barcelona zu einer pulsierenden Tourismusdestination. Der Olympiasieg der indigenen Läuferin Cathy Freeman bei den Spielen 2000 in Sydney warf ein Licht auf den Versöhnungsprozess zwischen der weißen Mehrheitsgesellschaft Australiens und seinen Ureinwohnern. Und die Spiele 2012 in London ermöglichten die Neugestaltung von teilweise chemisch kontaminierten Stadtbrachen.
Großer Kommerz und unmenschliche Kosten
Sportfunktionäre behaupten stets, dass die globale Aufmerksamkeit Olympias Gesellschaften öffnen könne. Doch der von Menschen zu entrichtende Preis für neue Flughäfen, Straßen und Hotels geht weit über die eigentlichen, monetären Kosten hinaus. Laut einer Studie von Schweizer Wissenschaftlern sind in den vergangenen vierzig Jahren mehr als zwei Millionen Menschen für Olympische Sommer- und Winterspiele vertrieben worden. In den Jahren 1986 bis 1992, rund um die Spiele von Seoul 1988, sind die Immobilienpreise in der südkoreanischen Hauptstadt um 240 Prozent gestiegen, der soziale Wohnraum verringerte sich um 76 Prozent. Im Jahr vor den Sommerspielen 1996 in Atlanta wurden hunderte Menschen festgesetzt; auf den rassistischen Arrestformularen gab es dafür einen schlichten Vordruck: „Afro-Amerikaner. Männlich. Obdachlos“. Und in Peking mussten vor den Sommerspielen 2008 mehr als eine Million Menschen ihre Wohnungen verlassen.[13]
Insbesondere die Winterspiele 2014 in Sotschi und die Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro machten deutlich: Von den Einnahmen profitieren vor allem Baukonzerne, Politiker und Funktionäre. Die Instandhaltungskosten für Sportstätten, die nach den Spielen nur noch selten gebraucht werden, müssen dagegen die Steuerzahler begleichen. Im Bundesstaat Rio de Janeiro flossen Milliarden in das Sportspektakel, während Krankenhäuser, Schulen und Polizeidienststellen unter Sparzwang leiden. Zugleich nutzten die Behörden die Spiele als Vorwand für Repressionen gegen sozial benachteiligte Gruppen. 2014 wurden im Bundesstaat Rio de Janeiro 580 Menschen von Polizisten getötet, 2015 waren es sogar 645 Personen. 99 Prozent der Opfer waren männlich, etwa achtzig Prozent schwarz – und zur Rechenschaft wurden die Polizisten fast nie gezogen.[14]
Diese Entwicklungen führten dazu, dass sich in westlichen Demokratien die Bevölkerung heute immer häufiger gegen die Bewerbung für Olympia entscheidet – oft auch gegen die eigene Regierung, ob in Graubünden, Oslo, Boston, Toronto oder Rom. So lehnten die Münchner in einem Bürgerbegehren eine Bewerbung für die Winterspiele 2022 ab, genauso wie die Hamburger für die Sommerspiele 2024. Dabei lagen in Deutschland zum Teil beachtliche Konzepte vor. Hamburg hätte vergleichsweise schnell einen komplett barrierefreien Stadtteil gebaut, mit einem großen Anteil an sozialem Wohnraum. Trotz dieser Rückschläge hat in Nordrhein-Westfalen eine private Kampagne die Spiele 2032 ins Visier genommen. In Berlin gibt es zudem eine Diskussion über eine Bewerbung für 2036, geschichtsvergessenerweise exakt hundert Jahre nach den Nazispielen. Allerdings haben beide Vorhaben nur geringe Aussicht auf Erfolg.
Heute, 125 Jahre nach ihrer Wiederbelebung, hat die olympische Idee in vielen Industriestaaten ihren Reiz verloren. Das liegt auch daran, dass das Internationale Olympische Komitee in wichtigen gesellschaftlichen Fragen wenig Substanzielles zu bieten hat. Bei den Sommerspielen dürfen Frauen erst seit 1996 Fußball spielen und seit 2012 in den Boxring steigen. Bei den Winterspielen dürfen sie erst seit 1998 im Eishockey und seit 2002 im Bobfahren starten. In vielen Winterdisziplinen sind Frauen auf kürzeren Strecken unterwegs, doch beim Skispringen von der Großschanze müssen sie noch immer zuschauen.
„Besonders deutlich wird die Ungleichheit auf der Entscheidungsebene“, sagt Alina Schwermer, die Sportjournalistin der „taz“ und Autorin der Kolumne „Erste Frauen“. „Das IOC nahm erstmals 1981 Frauen als Mitglieder auf, mehr als sechzig Jahre nach den Frauenweltspielen von Alice Milliat.“ Bei den vergangenen vier Olympischen Spielen, in Sommer und Winter, war in der Sportlerbetreuung nur jedes zehnte Mitglied weiblich. Und laut dem US-Magazin „Forbes“ sind unter den hundert bestbezahlten Sportlern nur zwei Frauen: die Tennisspielerinnen Naomi Osaka und Serena Williams.
Auch in anderen emanzipatorischen Fragen bleibt das IOC klare Antworten schuldig, zum Beispiel im Umgang mit erfolgreichen Sportlern mit Prothesen. So setzt sich der deutsche Leichtathlet und mehrfache Paralympics-Sieger Markus Rehm seit Jahren vergeblich für einen Start bei Olympia ein, also für Inklusion. Auch trans- und intersexuelle Sportler müssen um Anerkennung kämpfen.
„Olympia ist noch immer westlich dominiert“, sagt der Sportjournalist Martin Krauß. Mit Ausnahme des US-Amerikaners Avery Brundage kamen alle IOC-Präsidenten aus Europa. Die Wettkampfkalender internationaler Verbände nehmen auf christliche Feiertage Rücksicht, aber kaum auf muslimische oder jüdische. Krauß schreibt derzeit ein Buch darüber, wie sich Olympia durch den Druck von außen verändert hat. Ein zentrales Thema ist der politische Aktivismus im Sport, oft in Abgrenzung und Opposition zu den Funktionären der Verbände.
Weiß, männlich, westlich – die Kultur der Dominanz
In den USA unterstützten hunderte Spitzensportler die Bewegung Black Lives Matter. Die Basketballerinnen von Atlanta Dream stellten sich gegen Kelly Loeffler, eine Miteigentümerin ihres Klubs und treue Anhängerin von Donald Trump. Im Libanon mobilisierte der Basketballnationalspieler Fadi El Khatib für Proteste gegen Korruption. In Chile, Kolumbien oder Algerien gingen tausende Fußballfans gegen soziale Ungleichheit auf die Straße. Und in Myanmar erklärten prominente Sportler wie der Schwimmer Win Htet Oo einen Olympia-Boykott, aus Protest gegen den Militärputsch. Die Liste ließe sich sehr lange fortsetzen.
„Viele Sportler gehen inzwischen über symbolische Gesten hinaus und vernetzen sich mit Menschenrechtsorganisationen“, sagt Wenzel Michalski von Human Rights Watch in Berlin. „Sie wollen sich nicht mehr von Regimen instrumentalisieren lassen.“ Besonders deutlich wurde das in Belarus: Staatspräsident Alexander Lukaschenko, der lange auch dem Nationalen Olympischen Komitee als Präsident vorstand, platzierte Militärvertraute gezielt in Sportverbänden. Die staatlich finanzierten Sportler sollten dem international isolierten Regime positive Schlagzeilen bringen. Doch nach den manipulierten Präsidentschaftswahlen im August 2020 unterschrieben mehr als 2000 Sportler einen offenen Brief gegen Lukaschenko. Etliche von ihnen wurden bedroht, verhaftet, gefoltert. Einige gründeten im Exil eine Stiftung und sammeln nun Spenden für Sportler, die nach Demonstrationen ihren Job verloren haben. Von den großen Sportverbänden erwarten sie wenig. Erst nach Monaten des öffentlichen Drucks entzog die Internationale Eishockey-Föderation Belarus die Gastgeberrolle der Weltmeisterschaft 2021.
Die olympische Charta untersagt Athleten im Umfeld der Wettbewerbe politische Botschaften. Doch das Europäische Olympische Komitee hat Alexander Lukaschenko einst für seinen „herausragenden Beitrag zur olympischen Bewegung“ geehrt. Das verweist auf eine fatale Kontinuität: Seit Beginn der Olympischen Spiele vor 125 Jahren haben die Funktionäre mit Diktaturen zusammengearbeitet, denn sie wollten den Zugang zu Wachstumsmärkten nicht gefährden.
Aktuell öffnet sich das IOC – ebenso wie die Fußballverbände Fifa und Uefa – für chinesische Sponsoren. Kein Wunder: Die Winterspiele 2022 sollen schließlich in Peking stattfinden. Zur Verfolgung der Uiguren finden die Funktionäre bislang keinerlei angemessene Worte. Baron Pierre de Coubertin hätte an dieser vermeintlich „unpolitischen“ Haltung vermutlich seine Freude.
[1] Die Sieger erhielten Pistolen, Säbel oder Vasen, siehe: David Goldblatt, Die Spiele. Eine Weltgeschichte der Olympiade, Göttingen 2018.
[2] Dave Zirin, A People’s History of Sports in the United States, New York 2009.
[3] Roland Renson, The Games Reborn. The VIIth Olympiad: Antwerp 1920, Antwerpen 1996.
[4] Jasper Truyens, Antwerpen 1920, Leuven 2020.
[5] Helen Lenskyj, Out on the Field. Gender, Sport and Sexualities, Toronto 2003.
[6] Ebd.
[7] David Goldblatt, a.a.O.
[8] Helen Lenskyj, a.a.O.
[9] Janie Hampton, The Austerity Games. When the Games Came to London in 1948, London 2008.
[10] Jules Boykoff, Power Games. A Political History of The Olympics, London 2016.
[11] Stephan Felsberg, Tim Köhler und Martin Brand (Hg.), Russkij Futbol, Göttingen 2018.
[12] David Goldblatt, a.a.O.
[13] Jules Boykoff, a.a.O.
[14] The Deadly Side of the Rio 2016 Olympics, www.amnesty.org.