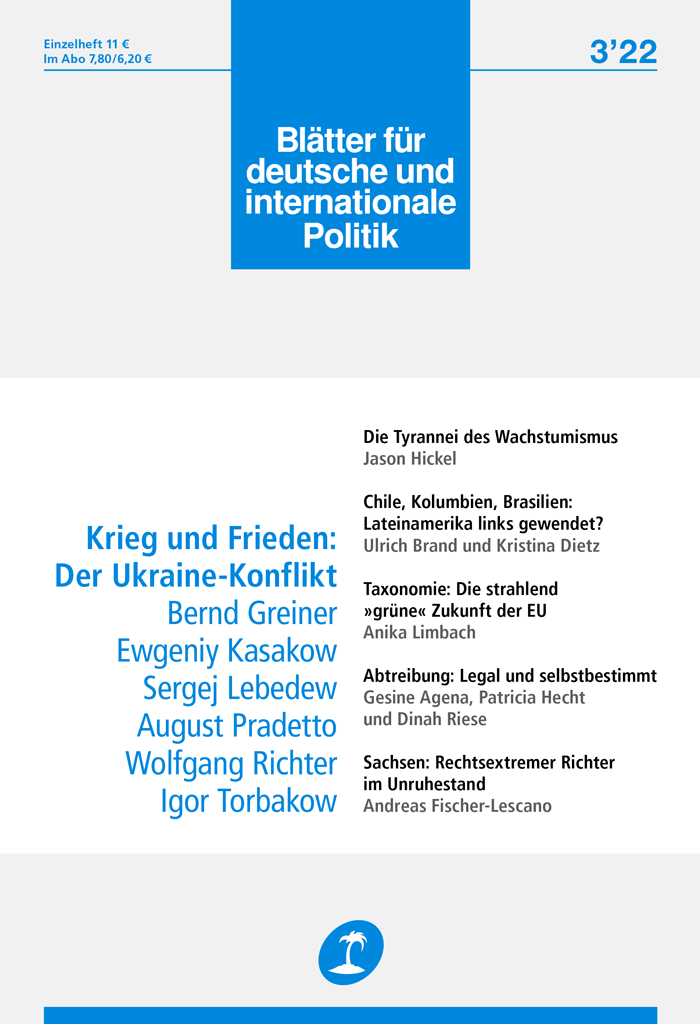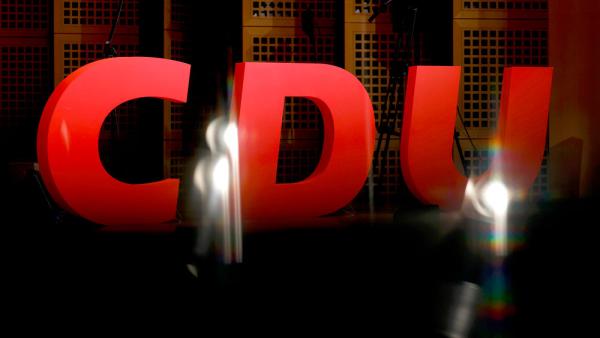Bild: IMAGO / Christian Ohde
Sexueller Missbrauch ist Marter, ein brutales Verbrechen an Leib und Seele. Die Missbrauchsskandale in der römisch-katholischen Kirche sind die Dornen in der Dornenkrone des Jesus Christus, sie sind der nicht mehr endende Karfreitag der Kirche. Und sie könnten auch zu ihrer Apokalypse werden, zu ihrem Untergang.
„Apocalypse now“ lautet jedenfalls die heimliche Überschrift des fast zweitausendseitigen sogenannten Münchener Missbrauchsgutachtens, das von der Erzdiözese München/Freising bei der Anwaltskanzlei Westpfahl, Spilker und Wastl in Auftrag gegeben und Ende Januar vorgestellt wurde. Es handelt von der sexualisierten Gewalt im katholischen Erzbistum München/Freising seit dem Jahr 1949, von einer unfassbar langen Zeit der Verharmlosung und Vertuschung – davon, wie die Kirche Sexualstraftäter völlig unbehelligt als Priester weiter arbeiten und weiter Straftaten begehen ließ.
Das Gutachten beschreibt das institutionelle und systemische Versagen der katholischen Kirche, aber auch das persönliche Versagen ihrer Spitzenrepräsentanten. Es beschreibt, wie sexualisierte Gewalt kleingeredet und als Kollateralschaden des Zwangszölibats betrachtet wurde. Und es analysiert die Verletzung jeglicher Aufklärungs-, Melde- und Fürsorgepflicht gegenüber den Betroffenen.
Das Gutachten handelt von fast 500 Opfern und 235 Tätern, denen „sexuell missbräuchliche Verhaltensweisen“ vorgeworfen werden; 173 dieser Täter sind Priester. Es listet Empörendes auf, aber dabei ist es nur ein Steinchen in einem Urbi-et-orbi-Puzzle der kirchlichen Abgründe.
Gewiss, in der Kirchengeschichte gab es immer wieder Zeiten der Finsternis. Aber kaum je war die ecclesiale Finsternis so groß wie heute. Das Grundvertrauen in Kirche hat sich mit den Missbrauchsskandalen in Grundmisstrauen gegen Kirche verwandelt. Und der Dreckhaufen, der mit den Vergehen und Verbrechen an Kindern und Jugendlichen angehäuft wurde, ist so groß, dass er auch vor den Türen anderer Konfessionen liegt. Die Unwürdigkeit und Gemeinheit der Priester, die Gewalttäter geworden sind, entehrt die Kirchen. Und das ist die weitergehende Gemeinheit: Auch so viele völlig untadelige, hochengagierte Seelsorger sind unter Generalverdacht geraten. Ihnen begegnen Misstrauen, Verdrossenheit und Spott.
Nein, die sexualisierte Gewalt ist nicht wie ein 11. September über die katholische Kirche gekommen. Sie kam von innen und sie wurde gefördert durch Kleinreden und Vertuschen. Der heutige Papst Franziskus weiß, dass nicht der Teufel der Kirche Schmutz ins Gesicht geworfen hat, wie das noch sein Vorgänger Benedikt behauptet hat. Es waren Kirchenmänner, die den Schmutz geworfen haben. Die Strukturen, in denen dies geschah, beschreibt das Münchner Missbrauchsgutachten sehr anschaulich. Es hat keinen literarischen Anspruch; es hat einen juristischen Grundsound; der ist nüchtern. Das Gutachten ist aber wie ein Blick ins Herz der Finsternis, weil es lehrt, wie geschehen konnte, was geschehen ist.
Besonders peinlich und beschämend ist der Blick auf Joseph Ratzinger, den emeritierten Papst Benedikt XVI. Seine Antworten auf die Fragen der Gutachter liegen auf 82 Seiten dem Gutachten bei. Die Antworten sind eine Abwimmelorgie. Es geht hier vor allem um den bekannten Fall des pädophilen Priesters Peter H., der 1980 nach sexuellen Übergriffen auf Minderjährige aus Essen nach Bayern, ins Bistum München/Freising versetzt wurde, wo er sich weiter an Jungen verging.
Joseph Ratzinger war damals Münchner Erzbischof. Er hat in seiner Stellungnahme bestritten, bei der entscheidenden Ordinariatssitzung im Januar 1980 dabei gewesen zu sein, in der die Übernahme und Einsetzung dieses Priesters beschlossen wurde. Er hat in diesem wie in allen anderen Fällen seine Verantwortung zurückgewiesen und behauptet Unkenntnis. Das liest sich so: „Somit ergibt sich aus der Aktenlage [...], dass ich keine Kenntnis hatte.“ Zu einer belastenden Aktennotiz: „keine Erinnerung, so dass ich davon ausgehe, dass sie mir nicht zur Kenntnis gebracht wurde“. Zum Einsatz des pädophilen Priesters: „Aber selbst wenn ich davon Kenntnis gehabt haben sollte, gab es keinen Grund, einen solchen Einsatz zu hinterfragen.“
Es ist dies eine Suada des Nichtwissens und der schriftlichen Lügen. Eine Falschaussage hat der emeritierte Papst mittlerweile korrigiert. Die 82 Seiten hat er kaum selbst formuliert. Sie tragen die Züge seiner juristischen Berater. Die haben ihm damit, wie nicht nur sein späteres Eingeständnis belegt, doch an der in Rede stehenden Sitzung teilgenommen zu haben, einen schlechten, einen furchtbaren Dienst erwiesen. Sie haben formuliert, als müssten sie Benedikt XVI. aus einem Strafprozess heraushauen, sie haben eine blamable, beschämende und fatale Verteidigungsschrift verfasst – wo Gewissenserforschung, Schuldbekenntnis, Zerknirschung, Reue und Umkehr notwendig gewesen wären.
„In Demut und Reue bekenne ich meine Sünden“ – mit diesem Satz beginnt die Beichte im Beichtstuhl, ihr folgt die Auferlegung einer angemessenen Buße. Von dieser Zerknirschung liest man in der 82seitigen Stellungnahme nichts. „Ego te absolvo“ heißt die Losung, die der katholische Priester bei der Beichte spricht: „Ich spreche dich frei von deinen Sünden.“ Die Erklärung, die seine Berater Benedikt geschrieben haben, läuft darauf hinaus, dass er sich selbst freispricht: Ego me absolvo. Es ist dies eine Verhöhnung des Bußsakraments.
Wer immer das formuliert hat: Das Dokument wirft dunkle Schatten auf den deutschen Papst. Es verdüstert die Erinnerung an den beglückenden Besuch des Papstes in seiner bayerischen Heimat im Spätsommer 2006, der damals in seinen Predigten im vertrauten pastoralen Singsang die naive Frömmigkeit des Dorfpfarrers mit der theologischen Raffinesse des Kirchenlehrers vereinte. Die Weltkirche, so erschien es den stolzen Gläubigen damals, hat ihr Herz in Bayern. Die törichte juristische Erklärung bringt nun auch den großen Theologen Joseph Ratzinger und sein Werk in Verruf.
Eine Jahrtausendreform tut not
Die entscheidende Frage aber ist eine andere: Wie wird die Kirche, die römisch-katholische Kirche, weiterleben? Verbrennt sie an und in diesem Skandal?
Längst hat ein Prozess der galoppierenden Entweihung der Hierarchie eingesetzt, den die katholische Kirche nur mit Demut beenden und wieder umkehren kann. Wir erleben einen Jahrtausendskandal, auf den mit einer Jahrtausendreform reagiert werden muss. Dazu gehört eine Abkehr vom zölibatären Zwang, den es nun seit tausend Jahren gibt. Das hat viel Unheil angerichtet. Der Zwang diskreditiert auch die Priester, die in freier Entscheidung zölibatär leben wollen; sie haben ein Recht auf ein Leben ohne Verdächtigungen. Zur Jahrtausendreform gehört auch der Abschied von den patriarchalen klerikalen Machtstrukturen. Die Vertreibung der Frauen aus aller Macht, die die katholische Kirche seit zweitausend Jahren betreibt – sie muss ein Ende haben. Es reicht.
In vielen Heiligengeschichten war eine Katastrophe der Anlass zur Umkehr. Warum sollte es – „Apocalypse now“ – in der Geschichte der katholischen Kirche nicht auch so sein? Dafür kommt es aber nicht zuletzt darauf an, das Verhältnis von Kirche und Staat in Deutschland auf eine neue Basis zu stellen. Der Sturm, den der Missbrauchsskandal ausgelöst hat, ist zum Orkan angewachsen. Viele Dogmen der Bequemlichkeit und auch die guten Traditionen, die vor Kurzem noch für bestandskräftig gehalten wurden, zusammengefasst im sogenannten Staatskirchenrecht, werden nicht mehr halten. Das Klima ist sehr kirchenkritisch geworden. Das einstige Grundwohlwollen gegenüber den Kirchen hat sich in ein Grundmisstrauen verwandelt; es wird wie eine Abrissbirne gegen das noch geltende sogenannte Staatskirchenrecht schlagen (das in der Juristerei seltsamerweise so heißt, obwohl es ja keine Staatskirche gibt; es sollte daher Religionsverfassungsrecht heißen).
So viel Gewicht und Umfang wie bisher werden die Religionsgemeinschaften in Zukunft nicht mehr haben. Der Missbrauchsskandal stellt die noch immer monumentale Rolle der Kirchen in Deutschland massiv in Frage. Und auch die noch geltenden Konkordate, die die Sonderrechte, Sonderregeln und Privilegien der Kirche definieren, werden nicht standhalten. Das Verhältnis von Kirche und Staat in Deutschland wird gern als „freundliche Trennung“ beschrieben – im Gegensatz etwa zum französischen System des Laizismus, in dem diese Trennung sehr strikt und scharf ist. Freundliche Trennung ist freilich eine beschönigend-verhüllende Bezeichnung für einen Zustand des innigen Mit- und Durcheinanders. Der Gordische Knoten war, verglichen damit, ein übersichtliches Gebilde.
Kernschmelze der Zivilgesellschaft?
Der staatliche Einzug der Kirchensteuer ist das bekannteste Exempel für das, was freundliche Trennung genannt wird. Ein weniger bekanntes Beispiel ist die staatliche Alimentation von Bischöfen. Parteivorsitzende werden von ihrer Partei bezahlt, Gewerkschaftssekretäre von ihrer Gewerkschaft, Chefredakteure von ihrer Zeitung. Bei leitenden geistlichen Herren ist das anders: In Bayern werden die Bischöfe nicht von ihrer Kirche, sondern vom Staat bezahlt – also nicht von den Kirchensteuern, die die Kirchenmitglieder entrichten, sondern aus allgemeinen Steuermitteln. In anderen Bundesländern, ausgenommen Hamburg und Bremen, zahlt der Staat Pauschalen, die die Kirchen dann für „kirchenregimentliche Zwecke“ verwenden.
Die Konkordate zwischen dem Staat und den Kirchen regeln das so. Begründet wird das mit der Enteignung der Kirchen im Reichsdeputationshauptschluss von 1803. In der Tat hat die Kirche damals viele Besitztümer verloren; es wurden durch den Reichsdeputationshauptschluss die Fürsten entschädigt, die ihre linksrheinischen Gebiete an Napoleon abtreten mussten. Seitdem zahlt der Staat Entschädigung, derzeit eine halbe Milliarde Euro pro Jahr an die evangelische und katholische Kirche. Im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung ist die Ablösung dieser Staatsleistungen angekündigt. Das ist nicht so sensationell, wie es scheint, darüber wird schon seit Längerem verhandelt – weil auch Kirchenvertretern klar ist, dass es nicht so weitergeht.
Mit dem Missbrauchsskandal wird sich auch das Drängen der Gesellschaft auf Entkirchlichung beschleunigen. Über all das freuen sich die Kirchengegner; das befriedigt viele zu Recht zornige Menschen, die das als gerechte Strafe betrachten. Die prekäre Zukunft der Kirchen ist aber auch Anlass zur Sorge bei denen, die wissen, dass Kirche viel mehr ist als ein Missbrauchsverein, die also die geistliche und soziale Kraft der Kirchen kennen, und die es zu schätzen wissen, wie viel die Kirchen bisher mit einer riesigen Ehrenamtsleistung zum Gemeinwesen beitragen. Sollen wir, so fragt man sich etwa an der theologischen Fakultät in Greifswald, das Land den rechten Kameradschaften Anklam und Wolgast überlassen? Sollen die Kirchen als zivilgesellschaftliche Kristallisationskerne aufgegeben werden? Es wäre fatal. Es wäre dies eine Kernschmelze der Zivilgesellschaft.
Gleichwohl: Es muss und wird vieles auf den Prüfstand gestellt werden. Die Kirche muss endlich mit sich selbst ins Gericht gehen. Sie muss sich selbst schuldig bekennen – und sich dann aus dieser Schuld zu befreien versuchen. Es ist also Zeit für eine neue Reformation. Dabei geht es natürlich nicht nur um die Kirchensteuer und ihre staatliche Einziehung, da geht es, zum Beispiel, auch um das Arbeitsrecht in kirchlichen Kindergärten, Krankenhäusern und Altersheimen. Die Kirchen gehören zu den größten Arbeitgebern in Deutschland. Das soziale Netz in Deutschland wird von den Kirchen und ihren Wohlfahrtsverbänden entscheidend mitgeknüpft und mitbestimmt; deren soziale Einrichtungen werden zum größten Teil aus staatlichen Mitteln finanziert. Lässt sich also das Verbot noch halten, in kirchlichen Einrichtungen für Lohn und gute Arbeitsbedingungen zu streiken? Und müssen es sich Gesellschaft und Staat weiter gefallen lassen, dass in den Einrichtungen der katholischen Kirche leitende Angestellte wegen einer homosexuellen Beziehung oder eines sonst angeblich nicht gottgefälligen Lebenswandels gekündigt werden können – während diese Kirche Missbrauchs-Priester in ihren Reihen behält?
Das alles hätte schon bei der Vereinigung diskutiert werden sollen und müssen. Aber damals, 1990/91, nach dem Beitritt, wurde den neuen Bundesländern ohne langes Fackeln die gesamte Religionsverfassung und das Kirchensteuersystem übergestülpt; es war der zum Scheitern bestimmte Versuch, dort ein Volkskirchensystem aufzubauen und so auch die Rolle der Kirchen als Akteure der friedlichen Revolution zu würdigen. Das Verhältnis von Kirche und Staat hätte zu den Fragen gehört, die „mit der Einheit aufgeworfen“ waren. Diese Fragen sollten eigentlich 1992/1993 in der Gemeinsamen Verfassungskommission von Bund und Ländern diskutiert werden. Man hat sich davor gedrückt.
Das verweist auf eine ungute Tradition: Schon im Grundgesetz waren 1949 einfach die Vorschriften der Weimarer Verfassung zum Verhältnis von Kirche und Staat übernommen worden. Als der evangelische Theologe Wolfgang Ullmann, Abgeordneter der Bundesgrünen, ein ausgesprochen kluger, damals schon älterer Herr aus Ostberlin, in der Verfassungskommission die Trennung von Kirche und Staat forderte, wurde er angeschaut wie ein Revoluzzer. Heute ist die Zeit gekommen, die Arbeit nachzuholen, die damals sträflich versäumt wurde. Das aber ist auch im Interesse der Kirchen, die erst zum Teil verstanden haben, dass der gordische Zustand ihnen weit mehr schadet als nützt.
Die Kirchen, und zwar nicht nur die katholische, sondern auch die evangelische, stehen vor einer historischen Aufgabe: Sie müssen lernen, dass das Ende der Volkskirche nicht das Ende der Kirche ist. Gut wäre es, wenn dieses Lernen ein ökumenisches Lernen, ein Miteinanderlernen wäre. Das könnte letztlich sogar der Anfang vom Ende der fünfhundertjährigen Spaltung sein – und ein neuer Beginn.