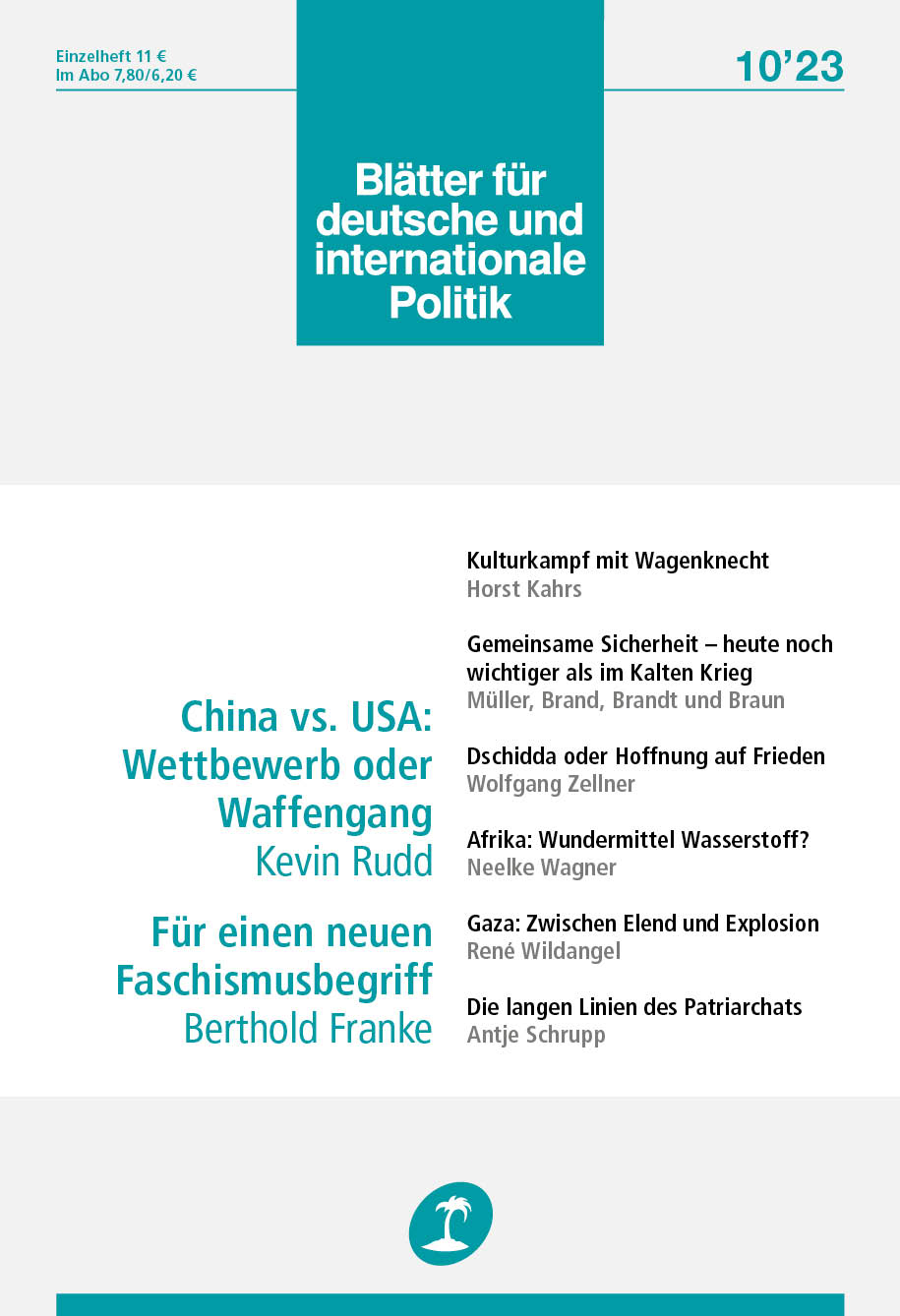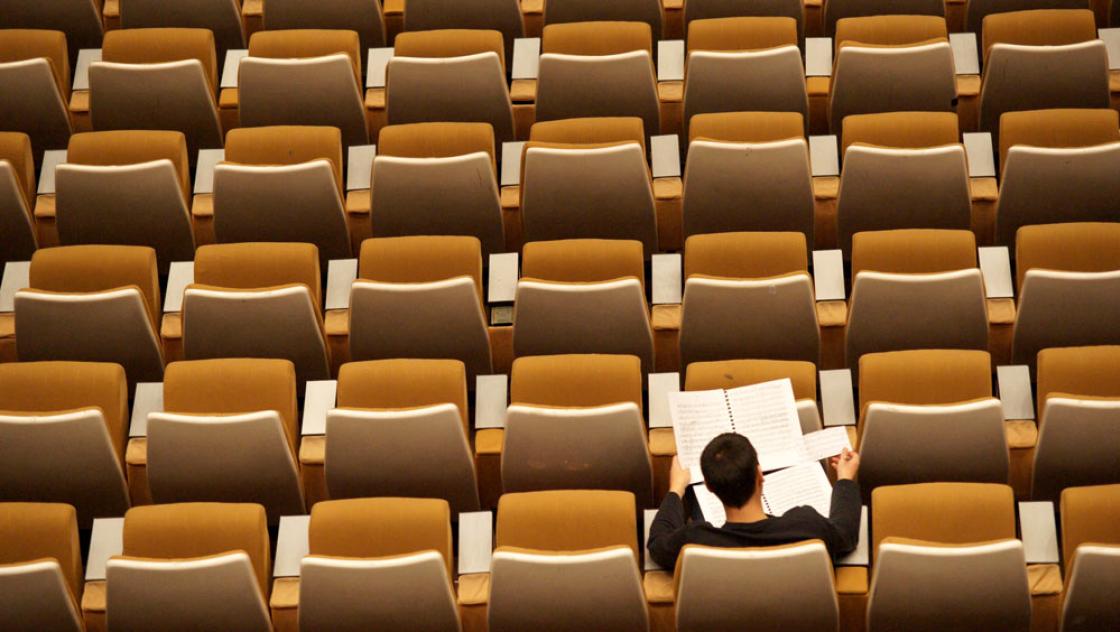
Bild: Ein Student alleine im Hörsaal, 14.9.2018 (Philippe Bout via unsplash)
Die Hörsäle sind wieder voll, die Tische der Mensen und Bibliotheken wieder besetzt, nur hier und da erinnert noch eine alte, in der Jackentasche wiedergefundene Maske an die Einschränkungen der vergangenen vier Jahre – kurzum: Die „Normalität“ scheint an die Hochschulen zurückgekehrt zu sein. Doch unterhalb der Oberfläche setzt sich die Krise für viele Studierende fort, nicht ganz so offensichtlich wie zuvor, aber mit kaum weniger Ängsten und Sorgen.
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene haben schon während der Pandemie besonders unter den Einschränkungen zu deren Bekämpfung gelitten[1], und anders als die alten Masken lassen sich die psychischen Belastungen aus dieser Zeit oftmals nicht so einfach wegstecken. Hinzu kommen heute der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und dessen Folgen sowie die sich zuspitzende Klimakrise, die das mentale Wohlbefinden junger Menschen beeinflussen.[2] Sie befänden sich im „Dauerkrisenmodus“, konstatiert angesichts dessen der Jugendforscher Klaus Hurrelmann.[3] Dieser äußere sich in einer Zunahme von Stress und psychischen Belastungen wie Erschöpfung, Selbstzweifel und Gereiztheit, die auf Dauer zu einem erhöhten Risiko für Depressionen, Suchtverhalten und Isolation führen könnten.
Doch trotz der anhaltenden Belastungen muss der Unialltag weitergehen. Viele der Studierenden, die kurz vor oder während der Pandemie ihr Studium begonnen haben, stehen nun vor dem Abschluss – wenn sie ihn denn in der Regelstudienzeit erreichen können. Das aber ist eben nicht die Regel: Im Jahr 2021 schaffte dies nur knapp ein Drittel der Studierenden, und auch für die Folgejahre wird mit längeren Studienzeiten gerechnet.[4]
Das liegt beispielsweise daran, dass Studierende Nebenjobs nachgehen müssen, an Auslandssemestern oder zusätzlichem Engagement aber auch an einer zu hohen Studienbelastung, mangelnden Seminar- und Praktikumsplätzen oder an Krankheit und Vereinbarkeitsproblemen.[5]
Hinzu kommt: Zu einem erfüllten Studium gehört mehr, als nur den Leistungspunkten hinterherzujagen und still die Seminarlektüre abzuarbeiten. Studieren bedeutet auch, sich auszuprobieren, sich zu engagieren und neue Erfahrungen zu sammeln – das aber kam in den Pandemiejahren eindeutig zu kurz: Prägende Erlebnisse wie die Abiturfeier, das Auslandsjahr, Erstsemesterpartys, ein Unistreik und nicht zuletzt das gemeinsame Lernen auf dem Campus blieben vielen verwehrt. Die rein digitale Lehre und der fehlende Kontakt zu Kommiliton:innen hat vielen Studierenden stark zugesetzt – und das in einem Alter, in dem das Sozialleben für die persönliche Entwicklung enorm wichtig ist.[6] Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sich dies in längeren Studienzeiten und höheren Abbruchquoten niederschlägt. Eine flexiblere Handhabung der Vorgaben zur Regelstudienzeit wäre daher dringend angeraten – nicht zuletzt auch wegen der massiven finanziellen Probleme, vor denen immer mehr Studierende angesichts von Inflation und horrenden Mieten in den Unistädten stehen.
Hohe Mieten, wenig Geld
Ein Drittel der Studierenden wohnt deshalb noch bei den Eltern. War dies während der Pandemie eine Möglichkeit, um Geld zu sparen und soziale Kontakte zur Familie oder zu Schulfreund:innen zu pflegen, anstatt allein in eine neue Stadt zu ziehen, erweist sich dies nun für viele Studierende als Notlösung ohne Ausweg. Denn der in den meisten Universitätsstädten ohnehin schon überlaufene Wohnungsmarkt ist durch den doppelten Zulauf nach der Pandemie nun noch angespannter. Sofern man überhaupt ein WG-Zimmer findet, muss man es auch bezahlen können: Ein Zimmer in der Universitätsstadt Münster kostet in diesem Jahr im Schnitt 440 Euro und somit sechs Prozent mehr als im Vorjahr. In anderen Städten sind die Preise prozentual sogar noch stärker gestiegen, beispielsweise in Essen (plus 10,8 Prozent), Leipzig (plus 14,1 Prozent) und wenig überraschend in Berlin (plus 16,4 Prozent). Am teuersten wohnt es sich nach wie vor in München mit durchschnittlich 720 Euro für ein Zimmer (plus 2,9 Prozent).[7]
Rund ein Drittel der Studierenden wohnt deshalb nicht am eigentlichen Studienort, muss also pendeln oder sich digital zu den Veranstaltungen zuschalten.[8] Deshalb wünscht sich ein Großteil der Studierenden, die Vorteile, die sich aus der Coronakrise ergaben, beibehalten zu können: So wurde die Digitalisierung der Hochschulen zwangsläufig vorangebracht, wovon auch der Präsenzbetrieb profitiert: Heute gibt es mehr Onlinezugriff auf Literatur und Zeitschriften, mehr Möglichkeiten, Verwaltungsakte digital auszuführen oder (Lehr-)Veranstaltungen digital oder hybrid beizuwohnen.
Trotz dieser Verbesserungen stellen die exorbitanten Mietpreise sowie die gestiegenen Lebenshaltungskosten viele Studierende vor große finanzielle Herausforderungen. Zwar wurden der BAföG-Höchstsatz im letzten Jahr von 861 auf 934 Euro und die Wohnkostenpauschale von 325 auf 360 Euro erhöht[9], doch angesichts der realen Kosten ist dies in vielen Fällen nach wie vor nicht ausreichend. Zudem muss man trotz der BAföG-Novellierung den Höchstsatz überhaupt erst einmal zugesprochen bekommen – aktuell erhalten ihn lediglich 43 Prozent der BAföG-Berechtigten, rund 89 Prozent aller Studierenden müssen dagegen gänzlich ohne BAföG auskommen. Und auch nach der letzten Reform sind die Bemessungsgrenzen der Elterneinkommen weiterhin viel zu niedrig angesetzt.[10]
Energiekrise und Inflation verschärfen die finanzielle Notlage weiter. Zwar hat der Bund verschiedene Entlastungszahlungen auf den Weg gebracht, wie den Heizkostenzuschuss in Höhe von 230 Euro und die Einmalzahlung von 200 Euro für Studierende, die Anfang des Jahres beantragt werden konnte; zusätzlich soll es nochmals einen Zuschuss in Höhe von 345 Euro geben. Doch zum einen haben diese Zahlungen sehr lange auf sich warten lassen und zum anderen sind sie nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Mehr Arbeit, weniger Studium: ein Teufelskreis
Gerade Studierende, die keinen finanziellen Rückhalt aus dem Elternhaus zu erwarten haben, können von ungeplanten Kosten, wie einer hohen Stromnachzahlung oder für die Reparatur bzw. den Neukauf des dringend benötigten Laptops, in massive finanzielle Nöte geraten. Und diese wirken sich auf die physische und psychische Gesundheit aus und damit wiederum auf den Erfolg im Studium – das wissen wir nicht erst seit der Pandemie.[11]
Zwar sind klassische studentische Nebenjobs in der Gastronomie und im Einzelhandel, anders als noch während der Pandemie, nun wieder verfügbar. Doch angesichts des Arbeitspensums, das nötig ist, um mit dem Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde die gestiegenen Lebenshaltungskosten zu decken, ist ein Vollzeitstudium kaum möglich. Ein solches aber ist Voraussetzung, um in der Regelstudienzeit zu bleiben, alle vorgesehenen Creditpoints pro Semester zu erlangen und damit weiter BAföG zu erhalten. Wer nach dem Ende des BAföG-Bezugs gezwungen ist, sich alleine weiter zu finanzieren, muss noch mehr arbeiten und hat noch weniger Ressourcen für ein gelungenes Studium – ein Teufelskreis. Diese Zeit fehlt nicht nur für den Austausch mit Kommiliton:innen, sondern auch beim Engagement der Studierenden und bei außercurricularen Möglichkeiten zur (beruflichen) Qualifizierung. Denn wer das Studium (anteilig) selbst finanzieren muss und in der Regelstudienzeit fertig werden möchte, hat nicht unbedingt Zeit, sich hochschulpolitisch, in der örtlichen Geflüchtetenhilfe oder im Sportverein zu engagieren. Und eben auch nicht, um in den Semesterferien ein unbezahltes Praktikum zu absolvieren, welches einem hinterher den Berufseinstieg erleichtert. Das sind alles keine neuen Erkenntnisse – dass sich soziale Ungleichheit auch im Studium abhängig vom familiären Hintergrund reproduziert, war auch schon vor der Pandemie bekannt, aber die Effekte haben sich durch diese nochmals verstärkt und wirken weiter fort. Denn aktuell sind eine Verbesserung der finanziellen Lage, sinkende Lebenshaltungskosten und eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt nicht in Sicht. Und da ist es geradezu zynisch, dass Finanzminister Lindner (FDP) künftig an den Ausgaben für das BAföG sparen will.[12]
Promovierend und armutsgefährdet
Nicht BAföG-berechtigt, aber ebenfalls im Krisenmodus befindet sich die Gruppe der Promotionsstudierenden. 2021 erfasste das statistische Bundesamt rund 200 300 Promovierende in Deutschland, davon 26 Prozent im Bereich der Humanmedizin und den Gesundheitswissenschaften. Etwa die Hälfte aller Promovierenden ist an Hochschulen eingeschrieben. Die Debatten um #Ichbinhanna und #ichbinreyhan sowie zuletzt die Diskussion um die angekündigte Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes haben die prekäre Situation vieler sogenannter Nachwuchswissenschaftler:innen ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt.[13] Bei den Promovierenden handelt es sich um eine verhältnismäßig kleine und vor allem heterogene Gruppe, die zu ganz unterschiedlichen Konditionen promoviert und entsprechend unterschiedlich von den gegenwärtigen Krisen belastet ist. Etwa 56 000 aller Promovierenden hierzulande sind an einer Hochschule beschäftigt, in der Regel befristet. Der Rest finanziert sich durch anderweitige Beschäftigungsverhältnisse oder freiberufliche Tätigkeiten, über Stipendien, Darlehen und Ersparnisse, aber auch den Bezug von Arbeitslosengeld I und II.
Die meisten von ihnen, auch diejenigen mit einer Anstellung oder entsprechender Anbindung an Forschungsinstitute, hatten auf ähnliche Weise mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen wie die Studierenden im Grundstudium – auch ihnen fehlte der direkte Zugang zu Laboren, Arbeitsplätzen und wissenschaftlichem Austausch und somit auch zum Netzwerken.
Zwar hat auch hier die Umstellung auf Onlineveranstaltungen große Vorteile mit sich gebracht, der Zugang zu internationalen Tagungen beispielsweise wurde auf einmal ohne Reisekosten von zu Hause aus möglich, aber auch hier gibt es zwei Seiten einer Medaille. Die auf einmal schier unendlichen Möglichkeiten, an Konferenzen, Workshops und Kolloquien teilzunehmen, löst bei vielen auch Stress aus: die Sorge davor, etwas zu verpassen, nicht präsent genug zu sein und zugleich auf die Vorteile von Präsenzveranstaltungen zu verzichten, denn das besonders Interessante an Konferenzen sind und bleiben schließlich nicht zuletzt die sozialen Begegnungen in den Kaffeepausen. Zudem sorgt die Umstellung auf hybride bzw. digitale Lehre für eine Mehrbelastung der in der Lehre tätigen Promovierenden und zusätzliche Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Neben dem Druck, sich angemessen wissenschaftlich zu qualifizieren, zu publizieren, Erfahrungen in der Lehre und bei Drittmitteleinwerbungen zu sammeln und sich um die nächste Anschlussfinanzierung zu kümmern, kommen auch bei den Promovierenden die gestiegenen Lebenshaltungskosten und Engpässe beim Wohnen hinzu. Mit einem Promotionsstipendium von aktuell 1450 Euro leben einige Promovierende, nach Abzug der freiwilligen Kranken- und Sozialversicherung, rechnerisch an der Grenze der Armutsgefährdung, die im Jahr 2022 für Alleinstehende mit einem Nettoeinkommen von 1250 Euro beziffert wurde.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat nun für diesen Herbst eine schrittweise Erhöhung der Promotionsstipendien von 100 Euro jährlich bis zum Wintersemester 2025/26 angekündigt. Außerdem soll die Förderzeit auf drei Jahre angehoben werden mit der Möglichkeit, diese um ein halbes Jahr zu verlängern.[14] Das ist zu begrüßen, angesichts der durchschnittlichen Promotionsdauer von fast sechs Jahren (ohne Humanmedizin und Gesundheitswissenschaften) ist hier aber, genauso wie bei der angekündigten Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, gewiss noch Luft nach oben.[15]
Viele Studierende und Promovierende werden daher mit gemischten Gefühlen ins kommende Wintersemester starten – und schon angesichts des bereits bestehenden und weiter drohenden Fachkräftemangels hierzulande sollten deren Nöte und Bedürfnisse nicht länger ignoriert werden.
[1] Vgl. Sabine Andresen, Anna Lips et al., Verpasst? Verschoben? Verunsichert? Junge Menschen gestalten ihre Jugend in der Pandemie, Hildesheim 2022.
[2] Caroline Hickmann und Elizabeth Marks, Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey, in: „The Lancet“, 12/2021, S. 863-873.
[3] Klaus Hurrelmann, Sechste Trendstudie Jugend in Deutschland: Aktuelle Krisen belasten Jüngere stärker als Ältere, doch Generationenkonflikt bleibt aus, hertie-school.org, 16.5.2023.
[4] Vgl. Statistisches Bundesamt, Absolventinnen und Absolventen in der Regelstudienzeit, destatis.de, 22.12.2021.
[5] Vgl. Elena Weber, Regelstudienzeit: Das solltest du wissen, unicum.de, 11.1.2023.
[6] Vgl. Michelle Boden und Pia Stendera, Einsam und verstummt: Studierende in der Pandemie, in: „Blätter“, 4/2022, S. 37-40; Kathrin Müller-Lancé, „Wir waren gefühlt die Letzten, an die man gedacht hat“, sueddeutsche.de, 14.8.2023.
[7] Vgl. Studis Online, Über 100 Städte in der Übersicht: Wo kostet ein WG-Zimmer aktuell wie viel?, studis-online.de, 1.8.2023.
[8] Vgl. CHE gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwicklung, Wohnsituation und Mobilität von Studierenden in Deutschland 2023, Gütersloh 2023.
[9] Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung, BAföG-Reform 2022: Die wichtigsten Änderungen, bmbf.de, 10.1.2023.
[10] Vgl. Andreas Keller, Jubiläum im Allzeittief: 50 Jahre BAföG, in: „Blätter“, 9/2021, S. 13-16.
[11] Vgl. Marion Sonnemoser, Psychologische Hilfe: Stressfaktor Geld, in: „Deutsches Ärzteblatt“, 4/2009, S. 178.
[12] Vgl. Stephanie Gebert, BAföG-Kürzungen: Was die Bundesregierung plant, deutschlandfunk.de, 7.7.2023.
[13] Vgl. Amrei Bahr, Kristin Eichhorn und Sebastian Kubon, #IchBinHanna: Promoviert, habilitiert, perspektivlos, in: „Blätter“, 8/2021, S. 21-24.
[14] Vgl. Studienstiftung des deutschen Volkes, Förderdauer und Stipendienhöhe steigen ab Herbst 2023: Promotionsstipendien ermöglichen exzellente Forschung, studienstiftung.de, 11.7.2023.
[15] Vgl. Kai E. Schubert, Prekär beschäftigt: Die Deformation der Wissenschaft, in: „Blätter“, 6/2023, S. 39-42.