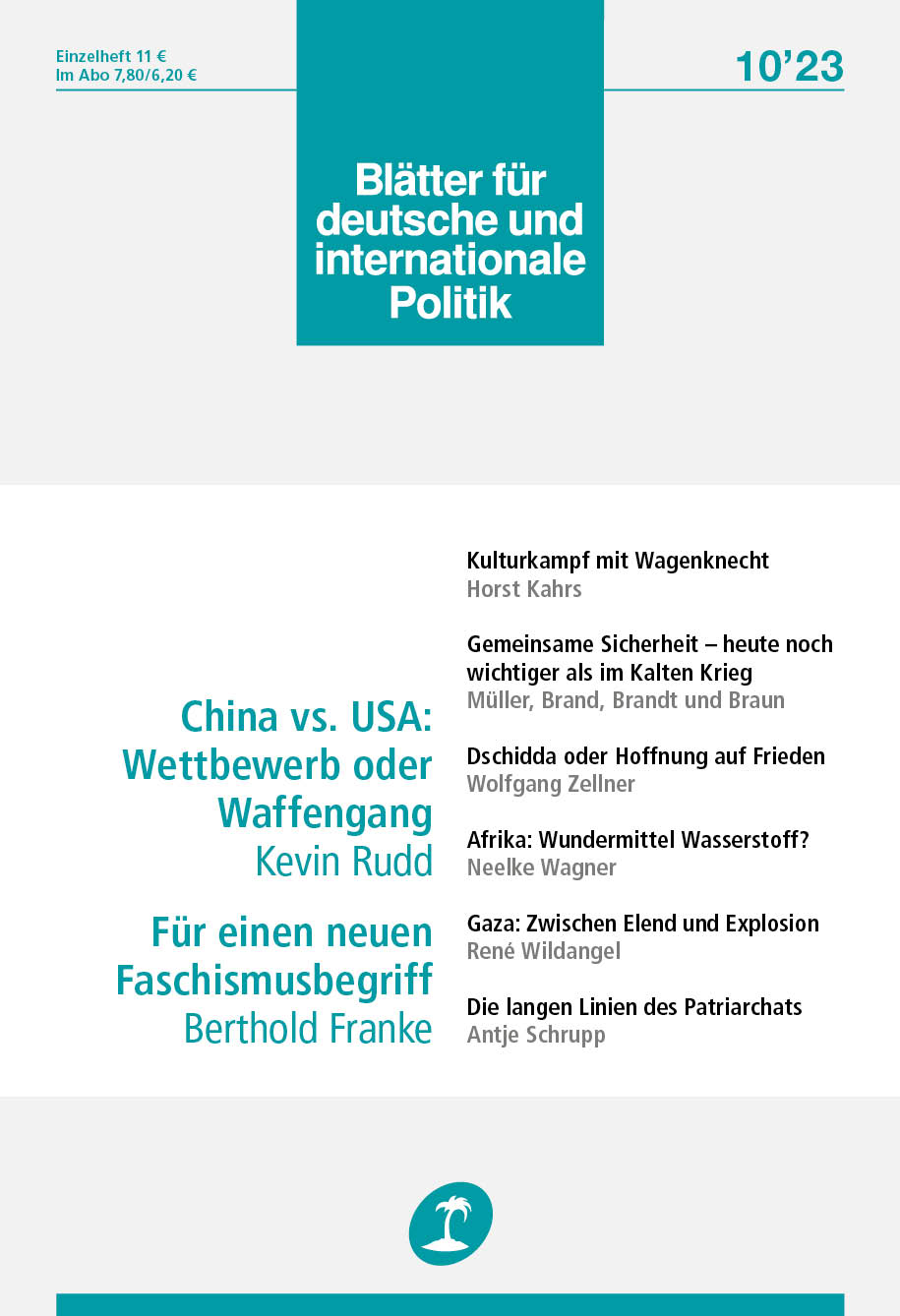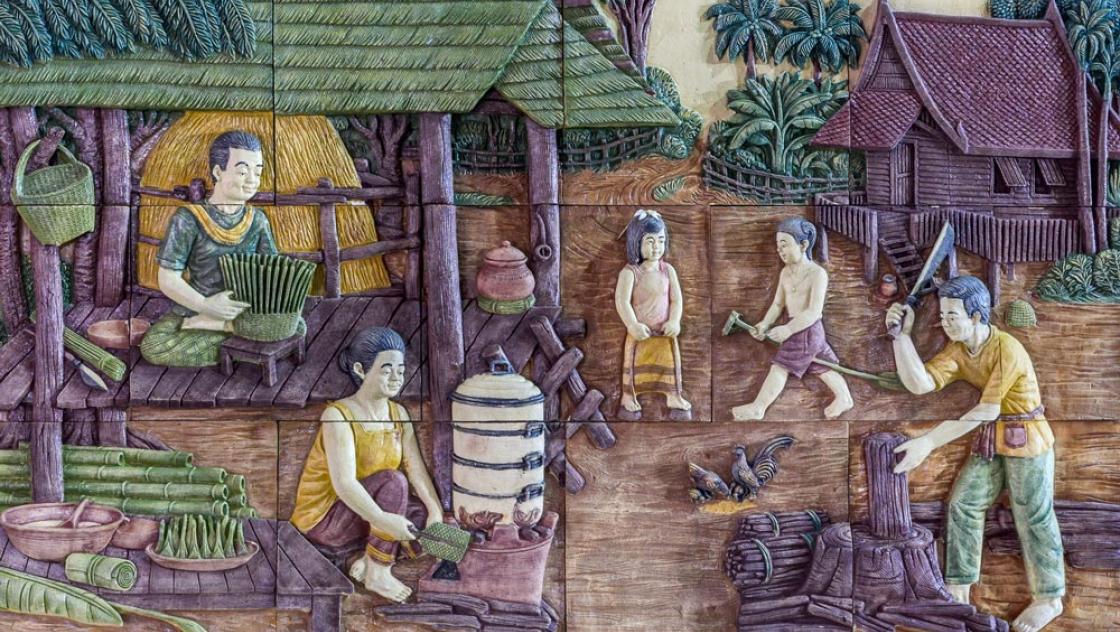
Bild: Steinschnitt an einer Tempelwand im Wat Pho in Bangkok, Thailand ( IMAGO / Pond5 Images)
Es dauert noch 131 Jahre, bis wir alle gleichberechtigt leben können”, vermeldete kürzlich das feministische Portal „Pinkstinks” und berief sich dabei auf Zahlen des „Global Gender Gap Reports 2022“ des Weltwirtschaftsforums. Solche Berechnungen sind so alt wie die Gleichstellungspolitik und illustrieren das Mindset, in dem wir häufig über Geschlechterverhältnisse und Frauenemanzipation sprechen: Wir stellen uns die Geschichte als kontinuierlichen Fortschritt vor, an dessen Ende unweigerlich die Gleichberechtigung der Geschlechter steht.
Doch ob es so kommt, ist fraglich. Länder wie Iran, Afghanistan, die Türkei oder Russland zeigen, dass frauenpolitische Errungenschaften auch wieder rückgängig gemacht werden können. Womöglich leben wir – bzw. die kommenden Generationen – im Jahr 2154 also nicht in einer gleichberechtigten Welt, sondern in einer deutlich patriarchaleren als heute. Eine ganze Reihe von Ländern und Regionen verbinden zurzeit eine antiwestliche Politik mit dem Versprechen einer Rückkehr zu angeblich natürlichen Geschlechterrollen. Innerhalb der etablierten Demokratien Europas und der USA haben rechtsautoritäre Bewegungen ebenfalls den Kampf gegen Feminismus und geschlechterpolitische Freiheit als verbindendes Element entdeckt, auf das sich ansonsten stark divergierende rechte Strömungen einigen können.
Dass frauenfeindliche Positionen keineswegs auf einem kontinuierlichen Rückzug sind, zeigte schließlich eine Onlineumfrage von Plan International diesen Sommer, nach der in Deutschland ein Drittel der befragten jungen Männer Gewalt gegen ihre Partnerinnen zumindest gelegentlich in Ordnung finden. Die erschrockene Verwunderung über solche „Rückschritte” zeigt, wie tief die Vorstellung verankert ist, dass es sich bei der Frauenemanzipation um eine zwangsläufige Begleiterscheinung zivilisatorischen Fortschritts handelt, dass also nur zu fragen ist, wann, aber nicht, ob sie irgendwann eintritt. Niemand formulierte das so schön wie Karl Marx, der 1868 schrieb: „Der gesellschaftliche Fortschritt lässt sich exakt messen an der gesellschaftlichen Stellung des schönen Geschlechts (die Häßlichen eingeschlossen)“.
In solchen Überzeugungen drückt sich auch das kolonialistische Selbstverständnis Europas aus, das sich selbst in jeglicher Hinsicht an der Spitze der sozialen Evolution sah und damit auch die binäre Geschlechterphilosophie des bürgerlichen 19. Jahrhunderts mit seiner Ideologie der „getrennten Sphären“ für Frauen und Männer für besonders zivilisiert und fortschrittlich hielt. Die britische Journalistin Angela Saini analysiert in ihrem aktuellen Buch „Die Patriarchen”, welche fatalen Folgen das insbesondere für Frauen in den Kolonien hatte.[1] Zwar gab es auch in den meisten (aber nicht allen) indigenen Gemeinschaften damals irgendeine Form der Dominanz von Menschen ohne Gebärmutter (Uterus) über solche, die schwanger werden konnten. Aber wie das konkret aussah und welche Geschlechterkonzepte damit verbunden waren, variierte ganz erheblich, angefangen bei der Frage, wie viele Geschlechter eine Kultur kennt, über die Organisation von Generationen- und Sexualbeziehungen bis hin zu sozialen Rollenzuschreibungen an Menschen mit und ohne Uterus.
Die Diversität männlicher Vorherrschaft
„Die männliche Vorherrschaft”, schreibt Saini, „ist universal, aber sie sieht so unterschiedlich aus, dass es kaum eine universelle Ursache geben kann.” Sie schließt damit an die Arbeiten des Kulturanthropologen David Graeber und des Archäologen David Wengrow an, die 2021 in ihrem Buch „Anfänge” gezeigt haben, dass sich die Entwicklung der Menschheit nicht als Fortschrittsgeschichte erzählen lässt, sondern eher als gegenseitige Beeinflussung und Abgrenzung, wobei nicht so ohne weiteres klar ist, welche Lebensform „fortschrittlich” ist und welche „rückschrittlich”.[2] Ein Verzicht auf bestimmte Technologien etwa kann, wenn diese unerwünschte soziale Nebenwirkungen haben, durchaus die klügere Entscheidung sein. Beispiele dafür gibt es etliche, etwa Gemeinschaften, die auf die bereits erfundene Landwirtschaft wieder verzichteten, weil sie das Leben als Sammler:innen und Jäger:innen vorzogen. Zivilisationsentwicklung, schreiben Graeber und Wengrow, verläuft als Abfolge von Begegnungen unterschiedlicher Kulturen, die sich sowohl durch gegenseitige Inspiration, etwa in der Übernahme von Technologien und Gebräuchen, als auch durch Abgrenzung und Konkurrenz verändern. Es ist deshalb nicht möglich, aus bestimmten äußeren Umständen wie Klimaveränderungen oder der Erfindung von Technologien automatisch auf eine bestimmte Kultur und Lebensweise zu schließen. Gegen das simplifizierende Motto „Das Sein bestimmt das Bewusstsein” machen sie die absichtsvolle Wahl und das Aushandeln von kulturellen Konzepten stark. Dass eine Gemeinschaft so und nicht anders lebt, wirtschaftet, sich regiert oder regieren lässt, sei zwar von einer Vielzahl externer Faktoren beeinflusst, aber eben nicht determiniert: Während die einen es so machen, machen es die anderen unter ganz ähnlichen Umständen anders.
Den Geschlechterbeziehungen widmen Graeber und Wengrow bei ihrer ansonsten sehr detaillierten Analyse leider keine systematische Beachtung, doch es gibt Hinweise darauf, dass es sich mit Strukturen männlicher Dominanz ähnlich verhält: Wo die einen auf eine Herausforderung mit patriarchalen Geschlechternormen reagieren, wählen andere egalitäre Formen. Und wenn es sich um zwei benachbarte Gemeinschaften handelt, können sie sich genau darin voneinander abgrenzen und so eine je eigene Identität definieren. Womöglich ist dies im Fall von Sparta und Athen geschehen, jedenfalls haben archäologische Forschungen laut Saini gezeigt, dass die Geschlechterideologien in Athen anfangs nicht so starr und patriarchal waren, wie sie dann später wurden.
Männliche Dominanz als Folge der Staatenbildung?
Wenn aber die menschlichen Kulturen auf der Erde über Jahrtausende hinweg vielfältig waren und in allen möglichen Kombinationen auftraten – von friedfertig bis kriegerisch, von egalitär bis hierarchisch, zentral organisiert oder dezentral, mit allen möglichen Regierungs- und Wirtschaftsformen, mit den unterschiedlichsten Formen von Religion und einer großen Bandbreite von Technologien – warum ergibt sich dann im Hinblick auf Geschlecht ein doch recht eindeutiges Bild, nämlich eine Dominanz der Männer? Patriarchale Strukturen haben sich offenbar unabhängig von Geschlechterkonzepten entwickelt, denn auch Gesellschaften, die intersexuelle Körper anerkennen, die mehr als zwei binäre Gender kennen, wo Frauen einen größeren Aktionsradius haben und mehr Einfluss nehmen können als im Europa des 19. Jahrhunderts – auch dort ist männliche Dominanz die Regel, ein egalitäres Geschlechterverhältnis die Ausnahme und weibliche Dominanz praktisch nicht existent. Konservative Verfechter traditioneller Geschlechterordnungen ziehen daraus den Schluss, dass männliche Vorherrschaft zumindest bis zu einem gewissen Grad eben doch nicht menschengemachte soziale Konstruktion, sondern in der Natur vorgegebene Ordnung sei. Sie führen das auf körperliche Unterschiede zurück, die zwangsläufig zu irgendeiner Form von Arbeitsteilung führen mussten. Oder sie sehen das Patriarchat als zwangsläufige Folge der neolithischen Revolution, also der Entstehung sesshafter, Getreide produzierender Lebensweisen, die die Herausbildung einer „häuslichen“ Sphäre und einen Anstieg der Geburtenraten begünstigt und so die Frauen in einen Nachteil gebracht hätte. Jedenfalls seien menschliche Zivilisationen nicht für eine vollkommene Gleichheit der Geschlechter geeignet.
Angela Saini widerspricht: Weder die körperlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen noch die Einführung der Landwirtschaft und die damit einhergehende Umstellung der Ernährung auf Getreide stehen ihrer Ansicht nach am Beginn der Herausbildung männlicher Dominanz. Sondern eine sozial relevante Unterscheidung von Menschen mit und ohne Uterus sei erst im Kontext von Staatenbildung aufgekommen, also erstmals um 3200 vor Christus im Gebiet des „fruchtbaren Halbmonds” zwischen Euphrat und Tigris. Damals seien Menschen mit Uterus „frauisiert“ worden, also in eine eigene Kategorie des Menschseins geraten. Ein Indiz dafür sei, dass sich im Indogermanischen danach, etwa um 2500 vor unserer Zeit, ein grammatisches Femininum herausgebildet habe. Notwendig geworden ist die soziale Unterscheidung von Menschen in Hinblick auf ihre Gebärfähigkeit nach Sainis Analyse aus bevölkerungspolitischen Gründen, denn die Macht von Staaten habe nicht auf der Größe ihres Territoriums beruht, sondern auf der Anzahl von Menschen, die unter ihrer Herrschaft lebten. Staatliche Machthaber, argumentiert sie, hatten Interesse an hohen Geburtenzahlen und damit an einer Differenzierung zwischen Menschen, die Kinder gebären können, und solchen, die für andere Aufgaben wie Verteidigung und Kriegsführung eingesetzt werden sollten.
Der Soziologe Jürgen Kaube, der sich in seinem 2017 erschienenen Buch „Die Anfänge von allem” ebenfalls mit der Entstehung menschlicher Zivilisationen beschäftigt hat, definiert Staatlichkeit als „zentrales Entscheiden durch Gruppen, die privilegierten Zugang zu Gütern und Göttern und Gewaltmitteln haben und selbst nicht von anderen Weisungen abhängig sind”.[3] Voraussetzung für ihre Entstehung sei die Verhinderung von Migration, denn nur wenn diejenigen, die mit getroffenen Entscheidungen nicht einverstanden sind, nicht einfach weggehen und woanders siedeln können, müssen sie sich unterwerfen, und nur dann können staatliche Gebilde entstehen. Getreideanbau sei ein begünstigender Faktor, da er die Möglichkeit der Lagerhaltung bietet und damit eine Kontrolle des Zugangs zur Nahrung. Allerdings sei dies weder notwendig noch hinreichend: Auch in Regionen ohne Getreideanbau – wie etwa in Hawaii – habe es Staaten gegeben und nicht überall, wo Getreide die Nahrungsgrundlage war, seien auch Staaten entstanden.
Die staatlich erwünschte Zufuhr von Menschen als Untertanen erfolgte auch durch Kriege, schreibt Saini. Dabei sei das Ziel nicht in erster Linie die Eroberung von Land gewesen, sondern die Gefangennahme von Menschen zwecks Ausbeutung ihrer Arbeitskraft, und zwar weltweit. Schätzungen zufolge machten Gefangene zeitweise bis zu einem Drittel der griechischen Bevölkerung in der Antike aus und 10 bis 20 Prozent des römischen Italiens.
Die gemeinsamen Wurzeln von Patriarchat und Sklaverei
Dass Patriarchat und Sklaverei gemeinsame historische Wurzeln haben, schrieb schon 1986 die feministische Historikern Gerda Lerner in ihrem Buch „Die Entstehung des Patriarchats” (dessen englischer Originaltitel „The Creation of Patriarchy” es besser trifft).[4] Lerner glaubte, dass die Unterdrückung von Frauen in der patriarchalen Familie das Modell für die Sklaverei und andere Formen der Unterdrückung geliefert habe. Angela Saini hält hingegen in der Menschheitsgeschichte die Versklavung fremder Volksgruppen für ursprünglicher: „Vielleicht war es die Praxis der Sklaverei, die nach und nach die Institutionen der Ehe prägte.”
Tatsächlich lässt sich anhand neuerer DNA-Untersuchungen zeigen, dass in Europa, aber auch in Teilen Asiens und Afrikas etwa zwischen 5000 und 3000 vor unserer Zeit ein „genetisches Nadelöhr“ existierte: Nur vergleichsweise wenige Männer zeugten eigene körperliche Nachkommen, die übrigen hatten offenbar kaum Gelegenheit, sich fortzupflanzen. Saini schließt daraus, dass sich nicht einfach eine Herrschaft „von Männern über Frauen” herausbildete, sondern eine Herrschaft von wenigen Männern (und womöglich einigen Frauen) über so gut wie alle Frauen und die Mehrzahl der anderen Männer. Erst im Lauf von Jahrhunderten habe die Differenzierung von Menschen entlang der Gebärfähigkeit verfestigte Formen angenommen und sich in patriarchalen Familienstrukturen niedergeschlagen. „Die Kategorisierung durch den Staat”, schreibt Saini, „war das Instrument, mit dem Frauen sowohl klassifiziert als auch systematisch entrechtet wurden. Durch die allmähliche Einführung umfassender Regeln und Gesetze konnte eine ganze Gruppe von Menschen in all ihrer individuellen Komplexität effektiv an den Rand gedrängt und unterdrückt werden.”
Staatliche Herrschaftsgefüge entstanden nicht nur in Mesopotamien, wo sie später in die ägyptisch-jüdisch-griechisch-römische Antike mündeten, sondern unabhängig davon auch in Amerika (die Maya, die Azteken), in der Karibik und in Asien (Indien, China). Allerdings gab es, wie Graeber und Wengrow herausgearbeitet haben, gleichzeitig immer auch Kulturen, die sich nicht staatsförmig organisiert haben. Angela Saini warnt zudem davor, sich diese Veränderungen als immer gewaltsam, als große Umwälzung oder außerordentliches Ereignis vorzustellen. Die in der Geschichtswissenschaft geläufige Beschreibung solcher Entwicklungen als „Revolutionen” lässt ein falsches Bild von den Abläufen entstehen. Es sind in der Regel Prozesse, die sich über Generationen hinweg entfalten, eine Summierung von vielen kleinen Veränderungen, von denen jede für sich unscheinbar aussieht. Die großen Umwälzungen lassen sich erst in der Rückschau erkennen.
Die Entstehung des Abendlandes aus vedrängten matrilinearen Kulturen?
Das schließt nicht aus, dass zuweilen auch besondere Ereignisse Prozesse beschleunigten. Ein besonders kontrovers diskutiertes hat die Archäologin Marija Gimbutas in die Debatte gebracht. Die Harvard-Professorin erforschte in den 1950er und 1960er Jahren bei großen Ausgrabungen neolithische Kulturen in Südosteuropa und kam zu der Überzeugung, dass es im „Alten Europa”, wie sie es nannte, ursprünglich matrilinear organisierte, friedliche Kulturen mit einer Religion der „Großen Göttin” gegeben habe, die zwischen 4300 und 2800 vor Christus von patriarchalen Kriegerkulturen aus dem Osten verdrängt worden seien. Gimbutas‘ Thesen wurden in den 1980er und 1990er Jahren von Teilen der Frauenbewegung begeistert aufgegriffen. Die Idee, dass das Patriarchat gar nicht universell und von Alters her die natürliche Gesellschaftsform gewesen sein könnte, sondern dass es womöglich Kulturen gegeben hatte, in denen Mütterlichkeit und Weiblichkeit zentrale Grundlagen der Kultur gewesen waren, inspirierte vor allem jene Feministinnen, die sich nicht mit einer bloßen Gleichstellung innerhalb historisch männlicher Institutionen zufrieden geben, sondern die Verhältnisse grundsätzlich aus einer weiblichen Perspektive hinterfragen und umwälzen wollten.
Die Mehrheit ihrer Universitätskollegen wies Gimbutas’ Thesen jedoch zurück, und je lauter ihre Arbeiten von Feministinnen bejubelt wurde, umso vehementer ging das akademische Establishment in Abwehrstellung. Inzwischen ist Gimbutas, die 1994 starb, allerdings weitgehend rehabilitiert. Neue Erkenntnisse stützen ihre These zumindest im Grundsatz. Denn seit Mitte der 1990er Jahre können archäologische Funde mit Hilfe von DNA-Analysen untersucht werden, was es ermöglicht, Skelette geschlechtlich zuzuordnen, also zu entscheiden, ob die betroffene Person einen Uterus hatte oder nicht. Zuvor waren archäologische Thesen häufig eher von Vorurteilen als von wissenschaftlichen Beweisen bestimmt, nach dem Motto: Wenn in einem Grab Waffen oder Machtinsignien liegen, muss darin ein „Mann“ begraben sein. Solche Zirkelschlüsse sind in jüngster Zeit in mehreren spektakulären Fällen korrigiert worden. Wellen schlug etwa ein berühmtes „Wikingergrab” aus dem 10. Jahrhundert im schwedischen Birka, das 1878 entdeckt worden war und sich 2017 als Grab einer Frau herausstellte. Auch verschiedene herrschaftliche Gräber in Europa aus der Kupfer- und Bronzezeit waren, wie man heute weiß, Begräbnisstätten von Menschen mit Uterus.
Aus dem Osten nach Europa: Die große Wanderung junger Männer
Aber nicht nur das Geschlecht einzelner Personen, auch genetische Verwandtschaftsbeziehungen können mittels DNA-Analyse nachgewiesen werden. Und dabei stellte sich heraus, dass tatsächlich etwa um 2200 vor Christus (also etwas später als von Gimbutas vermutet) in großer Zahl Menschen von Osten kommend nach Europa eingewandert sind, und dass es sich dabei ganz überwiegend um junge Männer handelte – der schwedische Archäologe Kristian Kristiansen schätzt, dass auf eine Frau 5 bis 14 Männer kamen. Sie mischten sich mit den lokalen Bevölkerungen, und ihre Nachkommen übertrafen die indigene Bevölkerung bald zahlenmäßig.
Doch wie muss man sich diesen Wandel vorstellen? Fest steht, dass daraus jene Kultur hervorgegangen ist, die später die „abendländische” genannt wurde und in deren Tradition Europa sich heute noch sieht. Aber was genau wurde damals von wem verdrängt? Wie hatten europäische Kulturen vor dieser Beeinflussung ausgesehen? Auskunft auf diese Frage erhoffen sich Archäolog:innen aus Fundstätten in Anatolien, insbesondere der Großsiedlung Çatalhöyük, die ihre Blütezeit um 7000 vor unserer Zeit erlebte und als erste Stadt der Weltgeschichte gilt. Die Funde von Çatalhöyük sind für viele Feministinnen der Beweis für die Existenz einer religiösen Huldigung von Weiblichkeit, einer „großen Mutter”. Die niederländische Historikerin Annine van der Meer etwa, die in ihrem 2009 erschienenen Mammutwerk „Die Sprache unserer Ursprungs-Mutter MA” sämtliche historischen Funde von Darstellungen weiblicher Körper katalogisiert hat,[5] ist sich sicher, dass „das Weibliche in dieser neolithischen Siedlung im sakralen Kontext verankert war”. Zeitweise wurde die Ausgrabungsstätte von Çatalhöyük ein regelrechter Wallfahrtsort für Frauen auf der Suche nach matriarchalen Wurzeln.
Doch es ist keineswegs zwingend, Figurinen mit Brüsten und Vulven als Muttergottheiten zu interpretieren. Womöglich stellen sie auch einfach Menschen dar, ohne dass deren Gebärfähigkeit eine spirituelle Bedeutung hat. Denn nur in einem patriarchalen Mindset, das Frauen als „zweites Geschlecht“ ansieht, ist es überhaupt bemerkenswert, dass ein Körper Brüste und Vulva hat. Angela Saini jedenfalls interpretiert die Ausgrabungen von Çatalhöyük eher als Hinweis auf eine egalitäre Gesellschaft, in der Geschlecht keine große Rolle spielte.
Wiederum ganz anders sehen es Carel van Schaik und Kai Michel, die sich in ihrem 2020 erschienenen Buch „Die Wahrheit über Eva” ebenfalls intensiv mit Çatalhöyük beschäftigen.[6] Der Evolutionsbiologe und der Historiker datieren die kulturelle Ungleichheit von Frauen und Männern bereits auf die Zeit um 10 000 vor unserer Zeit zurück und führen als Indiz die Ausgrabungsstätte Göbekli Tepe an, ebenfalls in Anatolien gelegen, wo zahlreiche Penisdarstellungen gefunden wurden. Van Schaik und Michel sehen darin Hinweise auf eine frühe männlichkeitsverehrende Religion, die ihrer Ansicht nach den Reputationsverlust ausgleichen sollte, die Menschen mit Penis nach dem Aussterben großer Tiere erlitten hätten (die sie dann nicht mehr jagen konnten). Letzten Endes sind aber alle Thesen über Ereignisse, zu denen es noch keine schriftlichen Zeugnisse gibt, Spekulationen. „All unsere Bemühungen, die Ursprünge des Patriarchats zu finden, sagen vielleicht weniger über die Vergangenheit als über die Gegenwart aus”, schreibt Angela Saini und ergänzt: „Aber vielleicht ist es ohnehin die Gegenwart, die wir verstehen wollen.”
Die Zerstörung matrilokaler Familienstrukturen
Von der Gegenwart aus gedacht ist die Frage, wie genau das Patriarchat entstanden ist, tatsächlich weniger von Interesse als die, auf welche Weise und mit welchen Dynamiken sich Geschlechterkonzepte und Geschlechterhierarchien verändern: Was führt dazu, dass sich soziale Erwartungen an Frauen oder Männer verändern? Wie kommt es, dass die Unterscheidung qua Geschlecht manchmal wichtig wird und dann aber auch wieder unwichtig? Welche Faktoren tragen dazu bei, dass sich Machtverhältnisse zwischen Menschen, die Kinder gebären können, und solchen, die es nicht können, verändern? Aber auch, historisch gefragt: Warum haben eigentlich die Frauen ihre Zurücksetzung und Absonderung zugelassen? Welche Mechanismen wurden wirksam, um sie zu entmachten? Und lässt sich daraus etwas für heute lernen?
Ein zentraler Faktor für die Verbreitung und Stabilisierung patriarchaler Kulturen ist laut Angela Saini die Verdrängung matrilokaler Familienstrukturen durch patrilokale. Patrilokalität bedeutet, dass Frauen mit Eintritt der Gebärfähigkeit ihre Familien verlassen, um in die Familien ihrer Männer zu ziehen. In matrilokalen Gesellschaften, von denen es auch heute noch einige gibt, bleiben Menschen hingegen ihr ganzes Leben im Haus ihrer Mutter ansässig. Aus vielen Regionen der Welt ist belegt, dass Gesellschaften sich lange gegen die Abschaffung der Matrilokalität wehrten. Die Praxis des Brautraubs kann als Indiz dafür gelesen werden, dass der Wandel hin zur Patrilokalität oft nicht einvernehmlich stattfand und sich an der Grenze zwischen Sklaverei und Ehe bewegte. Junge Frauen wurden durch die patrilokale Ehe zu Außenseiterinnen ohne soziales Unterstützungsnetz. Sie verloren jegliche soziale Machtposition, was sich im Lauf der Zeit unweigerlich auf das Kräfteverhältnis zwischen den Geschlechtern auswirkte. Für die in der Fremde auf sich allein gestellten Frauen waren Anpassung und Unterwürfigkeit oft die rationale Art, sich zu verhalten, eine Dynamik, die noch einmal dadurch verstärkt wurde, dass Mädchen in immer jüngerem Alter verheiratet wurden und somit ihren Ehemännern auch aufgrund ihrer geringeren Lebenserfahrung unterlegen waren.
Angela Saini zeigt, dass nicht nur in der Bronzezeit, sondern alle seitherigen Jahrtausende hindurch und besonders auch im Zuge der von Europa ausgehenden Kolonialisierung die Zerstörung matrilokaler Familienstrukturen ein wesentliches Mittel zur Durchsetzung patriarchaler Gendernormen war. Sehr häufig haben sich die betroffenen Gemeinschaften lange und zäh dagegen gewehrt; im indischen Bundesstaat Kerala zum Beispiel wurde die Mutterfolge erst im Jahr 1976 endgültig per Gesetz abgeschafft. Gleichzeitig gab es immer auch Kollaboration seitens derer, die von dem System profitieren. Denn auch das ist wohl eine Konstante der menschlichen Natur: Wenn man jemandem Macht anbietet, wird sie angenommen. „Die Männer” haben das Patriarchat vielleicht nicht erfunden, aber viele haben davon profitiert, ebenso wie übrigens Schwiegermütter, die Macht über die jungen weiblichen Neuankömmlinge in der Familie ausüben konnten. Es gehören eben immer mehrere gesellschaftliche Kräfte dazu, um eine Bevölkerungsgruppe zu entrechten und zu unterdrücken. Aber nichts davon ist zwangsläufig oder alternativlos. Auch heute leben wir wieder in einer Zeit, in der weibliche Freiheit und geschlechtliche Selbstbestimmung umstritten sind und von vielerlei Seiten bekämpft werden. Auch heute nehmen Standpunkte zu Geschlechterfragen identitätspolitischen Charakter an, das heißt, sie beschreiben nicht nur eine persönliche inhaltliche Meinung, sondern markieren Zugehörigkeit zu einem bestimmten Lager.
Doch stehen uns heute auch Analysen zur Verfügung, die helfen, solche Dynamiken zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken. Eine intersektionale Perspektive etwa erkennt die Verwobenheit von geschlechtlicher Unterdrückung mit anderen Herrschaftsformen und verhindert, dass sich benachteiligte Gruppen gegeneinander ausspielen lassen. Jetzt kommt es darauf an, sich mit diesem Handwerkszeug in die politische Auseinandersetzung zu begeben und für die Abschaffung von Sexismus und Frauenfeindlichkeit zu streiten. Einfach die Hände in den Schoß zu legen und auf die Gleichstellung zu warten, ist jedenfalls keine Option.
[1] Angela Saini, Die Patriarchen. Auf der Suche nach dem Ursprung männlicher Herrschaft, München 2023.
[2] David Graeber und David Wengrow, Anfänge. Eine neue Geschichte der Menschheit, Stuttgart 2021.
[3] Jürgen Kaube, Die Anfänge von allem, Hamburg 2017.
[4] Gerda Lerner, Die Entstehung des Patriarchats, Berlin 2022 (Neuauflage).
[5] Annine van der Meer, Die Sprache unsrer Ursprungs-Mutter MA. Die Entwicklung des Frauenbildes in 40 000 Jahren globaler „Venus”-Kunst, Rüsselsheim 2020.
[6] Carel van Schaik und Kai Michel, Die Wahrheit über Eva. Die Erfindung der Ungleichheit von Frauen und Männern, Hamburg 2020.