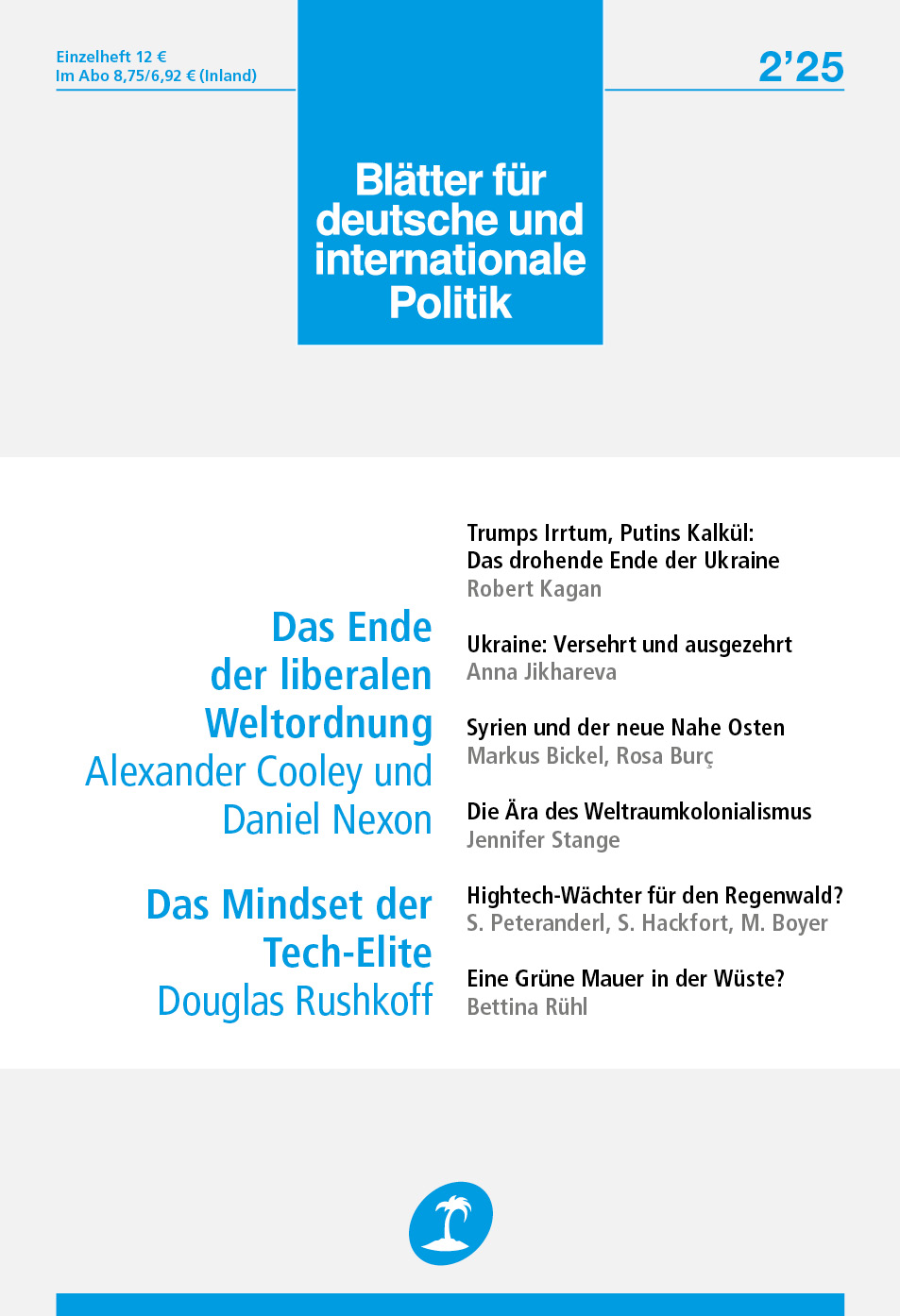Bild: YPG-Soldatinnen in Raqqa, 3.7.2017 (Chris Huby / Le Pictorium / IMAGO)
Die Bilder kurdischer Kämpferinnen, die im Januar 2015 in Kobanê die schwarze Fahne des Islamischen Staates (IS) niederrissen und an ihrer Stelle die Fahne der Frauenverteidigungseinheiten (YPJ) hissten, gingen damals um die Welt. Sie wurden zum Symbol des Sieges über den Islamischen Staat (IS) und des widerständigen Überlebenskampfes der Kurden in Syrien. Aufgenommen wurden diese Bilder von Nazim Daştan, einem kurdischen Journalisten, der Momente wie diese für die Nachwelt dokumentierte. Zehn Jahre später, am 20. Dezember 2024, wurde Daştan nun zusammen mit der Journalistin Cihan Bilgin durch einen gezielten türkischen Drohnenangriff getötet. Beide waren mit dem Auto unterwegs, um von den anhaltenden Kämpfen zwischen den von der Türkei unterstützten Söldnertruppen der Syrischen Nationalarmee (SNA) und den Demokratischen Kräften Syriens (SDF) – ein multiethnisches Bündnis, dem auch die kurdischen Selbstverteidigungseinheiten YPG und YPJ angehören –, am Tişrîn-Damm und an der Qereqozaq-Brücke in Nordsyrien zu berichten.[1] Seit dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad am 8. Dezember 2024 versucht die SNA dort mit türkischer Luftunterstützung, ihren Einfluss bis nach Kobanê und entlang der türkisch-syrischen Grenzregion auszuweiten. Seit Anfang Dezember steht bereits das Zentrum der Stadt Manbidsch unter Kontrolle der SNA. Die Miliz versucht, die SDF östlich des Euphrats zurückzudrängen und weitere Gebiete in der autonomen Region Nord- und Ostsyrien zu besetzen.
Während im Inneren der Türkei Versuche für erneute Friedensgespräche zwischen türkischer Regierung und „kurdischer Arbeiterpartei“ PKK den politischen Diskurs dominieren[2] und kurdische Anführer wie Mazloum Abdi in Syrien und Masoud Barzani im Irak bei einem historischen Treffen über eine mögliche gemeinsame Position zur Neuordnung Syriens sprechen, greift die Türkei zusammen mit der SNA ungestört strategische Verbindungspunkte zwischen Manbidsch und Kobanê an, tötet Zivilisten und versucht, auf ihren langjährigen Partner, die jetzt in Damaskus regierende HTS, Einfluss auszuüben, ganz im Sinne des türkischen Expansionismus der vergangenen Jahre. Dabei drohte der türkische Außenminister Hakan Fidan der SDF und forderte, dass ausländische Kämpfer in deren Reihen ausreisen müssten und die SDF sich den neuen Machthabern der HTS angliedern solle.
Ohne Zweifel markiert der Sturz Assads einen historischen Wendepunkt – auch für die kurdische Bevölkerung. Jahrzehntelang war sie der systematischen Unterdrückung durch die Herrschaft der Assad-Familie ausgesetzt, wurden auch die Kurden entrechtet, enteignet, verfolgt und kollektiv staatenlos gemacht. Doch im Schatten der Freude über das Ende der Diktatur eskaliert der nördliche Nachbar Türkei mit Angriffen und stärkt seine dschihadistischen Verbündeten durch gemeinsame Offensiven gegen die mehrheitlich kurdische Bevölkerung der teilautonomen Region. Während der eine Teil des Landes die Befreiung von Damaskus feiert, lebt der andere Teil in dauernder Angst um das eigene physische und gesellschaftliche Überleben, kämpft das teilautonome Rojava – wie die Region auch genannt wird – um seine Existenz. Dabei geht es nicht nur um die militärische Bedrohung durch die Türkei, die dschihadistische SNA und andere Milizen, nicht nur um IS-Gefangene, die bald entlassen werden könnten, oder um die neuen Machthaber der HTS, die trotz ihres jüngst gemäßigteren Auftretens vor noch nicht allzu langer Zeit als islamistische Miliz Idlib regierten und dabei Kritiker, Minderheiten und Frauen verfolgten und unterdrückten. Sondern es geht auch und vor allem um die Frage, was aus den politischen Errungenschaften im Nordosten Syriens, der Heimat der Jin Jiyan Azadi-Bewegung, werden wird: Frauenbefreiung, Minderheitenschutz, Basisdemokratie, Selbstbestimmung.
Die ideologische Kluft zwischen HTS und kurdischer Selbstverwaltung
Die HTS, die sich seit ihrer Machtübernahme als vermeintlich gemäßigte Kraft präsentiert, verspricht religiösen und ethnischen Minderheiten Schutz und versucht, ihre Herrschaftsansprüche durch eine Rhetorik der „multinationalen Einheit“ zu legitimieren. Der Imagewechsel des HTS-Anführers Ahmed al-Scharaa, weg vom Bild des ehemaligen Al-Qaida-Kämpfers und hin zu einem legitimen Regierungsvertreter in den Reihen der internationalen Staatengemeinschaft, soll seine ideologische Nähe zu islamistischen, zentralistischen und misogynen Systemen verbergen, wie sie etwa von den Taliban vorgelebt werden. Diese wiederum zog al-Scharaa selbst in der Vergangenheit als Vorbild heran. Doch das moderate Auftreten der HTS scheint vor allem ein taktisches Manöver zu sein, das erst diplomatische Beziehungen zu demokratischen westlichen Staaten ermöglicht. Zwischen den islamistischen Milizen auf der einen Seite und der kurdisch geprägten Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens auf der anderen Seite liegen indes ideologische Welten, die diplomatische Lösungen für den Aufbau eines gemeinsamen Syriens nach Assad auf lange Sicht erschweren dürften und die weit über die Frage hinausgehen, ob al-Scharaa Frauen bei der Begrüßung die Hand gibt.
Die Selbstverwaltung in Rojava vertritt ein radikal anderes Gesellschaftsmodell als die HTS und stützt sich auf feministische Prinzipien und basisdemokratische Strukturen. Seit 2011 – zunächst inmitten des syrischen Bürgerkrieges, dann als gelebte Antithese zur Schreckensherrschaft des IS – hat die Bevölkerung im Nordosten des Landes die Region Rojava als Projekt einer pluralistischen Gesellschaft etabliert, in der unterschiedliche gesellschaftliche, ethnische und religiöse Gruppen gleichberechtigt in basisdemokratische Strukturen integriert sind. Die Ideologie der kurdisch geprägten Selbstverwaltung beinhaltet ein emanzipatorisches Verständnis von Freiheit, das Unabhängigkeit nicht im territorial und ethnisch nationalistischen Sinne versteht, sondern die Gleichstellung von Frauen und gesellschaftlichen Minderheiten in den Vordergrund stellt. Durch die Institutionalisierung dieser Prinzipien wurde in Nordostsyrien ein umfassender gesellschaftlicher Wandel angestoßen. So operiert die Selbstverwaltung mit zwei parallelen institutionellen Strukturen: einerseits gemischten Institutionen, in denen Männer und Frauen gleichermaßen vertreten sind, andererseits autonomen Fraueninstitutionen. Letztere werden durch Kongreya Star repräsentiert – eine Frauenkonföderation, die alle Frauenorganisationen in Rojava umfasst und deren Rolle in der Selbstverwaltung strategisch begleitet. Alle Frauen, die in den Institutionen der Selbstverwaltung tätig sind – sei es in Räten, Kommunen, kulturellen Kollektiven, Arbeiter:innenkomitees oder sozialen Einrichtungen –, sind automatisch Mitglied dieser Konföderation, auch die neben den multiethnischen Frauenstrukturen bestehenden ethnisch homogenen Frauenorganisationen, etwa von Araberinnen oder Suryoye-Frauen. Die Beschlüsse der Frauenstrukturen sind für die gesamte Selbstverwaltung bindend, und Frauenorganisationen verfügen über ein Vetorecht gegenüber Entscheidungen der gemischten Gremien. Darüber hinaus wird in allen institutionellen Strukturen – von Kommunen über Kollektive bis zu Parteien – das Prinzip des Ko-Vorsitzes angewandt: Während der männliche Ko-Vorsitzende von der geschlechtergemischten Versammlung gewählt wird, wird die Ko-Vorsitzende allein durch die Frauenversammlung bestimmt. Gleichberechtigte Repräsentation ist damit ein inhärenter Bestandteil des politischen Systems.
Die Idee der demokratischen Autonomie in Rojava ist es, lokale und gemeinschaftliche Selbstorganisation entsprechend den spezifischen Bedürfnissen der jeweiligen Region und Gesellschaftsgruppe zu ermöglichen, während sie zugleich in ein übergreifendes Rahmenwerk gemeinsamer Werte und Prinzipien eingebettet bleibt. Dabei spielen in Rojava auch Frauenräume eine wichtige Rolle. Dazu gehören etwa die „Mala Jin“ (Frauenhäuser) in jeder Kommune sowie geschützte Räume wie das von Frauen organisierte und verwaltete Frauendorf. Diese autonomen Räume dienen als Zufluchtsorte für Frauen, die geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt sind, und fungieren überdies als Kollektive für Bildung, die Dekonstruktion vorherrschender Geschlechternormen und zur Förderung der ökonomischen Unabhängigkeit von Frauen. Letztere wird auch durch selbstverwaltete Frauenkooperativen in der Landwirtschaft, dem Sicherheitssektor, der Textil- und Nahrungsmittelproduktion gewährleistet. Die institutionalisierte Autonomie von Frauen in Rojava stärkt nicht nur ihre gesellschaftliche Sichtbarkeit, sondern auch ihre Selbstständigkeit und Anerkennung innerhalb der Gemeinschaft.
Während Syriens Nordosten im geopolitischen Diskurs oft als strategisch bedeutsames Gebiet angesehen wird – vor dem jüngsten Machtwechsel umfasste die dortige Selbstverwaltung bis zu 40 Prozent des Landes und spielt zudem eine zentrale sicherheitspolitische sowie wirtschaftliche Rolle –, erfahren die gesellschaftlichen Errungenschaften Rojavas kaum Aufmerksamkeit. Stattdessen wird die Türkei auch von der deutschen Bundesregierung als Stabilitätsfaktor für Syrien dargestellt, etwa bei einem Treffen von Außenministerin Annalena Baerbock mit ihrem türkischen Amtskollegen Fidan im Dezember. Doch diese Perspektive verkennt die Realität.
Stabilität durch Vertreibung: Die türkischen Interessen in Nordsyrien
Bereits mit der türkischen Besetzung der syrischen Region Afrin 2018 zeigte sich, dass die Türkei in Nordostsyrien eine umfassende demografische Veränderung anstrebt. In Afrin beinhaltete Ankaras Verständnis von Stabilität die Vertreibung und Enteignung der kurdischen und jesidischen Bevölkerung, das Verbot der kurdischen Sprache in Schulen sowie die Entfernung von Frauen aus Regierungsämtern. Letztlich geht es der türkischen Regierung bei all dem um die Zerstörung jeglicher kurdischer Selbstverwaltung in der Region, und das aus zwei Gründen: Zum einen betrachtet sie die emanzipatorischen Prinzipien speziell Rojavas als eine innen- wie außenpolitische Bedrohung ihrer Hegemonie. Zum anderen sind die ressourcenreichen kurdisch dominierten Gebiete für sie von großem geopolitischen Interesse; eine autonome Verwaltung in der Region aber würde das türkische Einflussgebiet geographisch unterbrechen. In einer Onlinevorlesung an der Universität Rojava im April 2024 betonte der Historiker Hamit Bozarslan, dass das System Rojavas vor allem als ein „Regime des Überlebens“ verstanden werden müsse. Diese Einschätzung gewinnt angesichts der gegenwärtigen, im Stabilitätsdiskurs eingebetteten Bedrohungen durch die Türkei derzeit an Bedeutung.
Für die Rechte der Frauen in Syrien bedeutet das nichts Gutes: Bereits unter der Assad-Herrschaft hatten Frauen kaum politische Mitbestimmungsmöglichkeiten und wurden, wenn sie sich engagierten, vielfach in Foltergefängnissen inhaftiert. Mit dem Aufstieg dschihadistischer Kräfte verschlechtert sich ihre Lage nun weiter. Die Kolonialisierung der Frauenkörper zählt stets zu den ersten Projekten der islamistischen Rechten, was sich bereits in vorherigen Gebietsbesetzungen durch extremistische Gruppen gezeigt hat.
In den bisher von der SDF kontrollierten Gebieten befinden sich zudem viele der wichtigsten Weizenfelder und Ölvorkommen Syriens – Ressourcen, ohne die die HTS langfristig nicht regieren kann. Über deren Nutzung könnten die neuen Machthaber in Damaskus mit der Selbstverwaltung in Rojava verhandeln; wahrscheinlicher aber ist, dass der Zugang zu den Ressourcen über die militärische Präsenz der Türkei im Nordosten gewaltsam durchgesetzt werden wird – die türkische Regierung könnte dann künftig wohl auch über deren Verteilung mitentscheiden. Fest steht: Die SDF befände sich in einer stärkeren Position, wenn sie nicht den kontinuierlichen und massiven Angriffen der Türkei ausgesetzt wäre, die die Selbstverwaltung seit Jahren durch wirtschaftliche Blockaden und die Unterbrechung der Wasserversorgung substanziell zu schwächen versucht. Doch allen Angriffen zum Trotz bleibt die Verankerung der SDF in der Bevölkerung groß, nicht zuletzt aufgrund der Attraktivität ihres plurinationalen Gesellschaftsmodells. Auch deshalb wird die Selbstverwaltung nicht nur von Kurden, sondern auch von arabischen, feministischen und progressiven Gruppen mitgetragen. Sie ist zwar angreifbar, aber keineswegs politisch machtlos.
Rojava als gesellschaftlicher Gegenentwurf zum Islamismus der HTS
Dennoch werden die kurdischen Akteure international weiterhin nicht als eigenständige Verhandlungspartner anerkannt, dabei würde genau das ihre höchst unsichere Lage verbessern. Dabei ginge es nicht nur um ihr Recht auf Selbstbestimmung, sondern auch um die Stabilisierung einer politischen Ordnung, die auf Gleichberechtigung und Demokratie aufbaut – und damit ein Gegenmodell bildet zu den islamistischen Herrschaftsansprüchen der HTS, der Gewalt anderer Milizen und den Expansionsinteressen der Türkei. Während die Selbstverwaltung in Rojava ihren politischen und militärischen Handlungsspielraum in den kommenden Wochen und Monaten, auch mittels diplomatischer Bemühungen, zu verteidigen versuchen wird, bleibt offen, ob Rojava als autonomes Projekt Bestand haben kann – oder ob es zwischen den Interessen regionaler und globaler Akteure zerrieben werden wird.[3] Ungewiss ist zudem, ob die HTS nach dem Machtwechsel in Damaskus ihre Ziele auch unabhängig von ihrem bisherigen Unterstützer Türkei verfolgen können wird. Die Furcht davor könnte auch erklären, warum sich die Türkei mit der SNA weiterhin eine eigene Miliz im Land hält – ein Instrument, um ihre unmittelbaren geopolitischen Interessen in Syrien mit Gewalt durchzusetzen.
Über diese strategischen Überlegungen hinaus zeichnet sich auch eine tiefere rhetorische Verschiebung ab: Indem die Türkei demonstriert, „ihr Kurdenproblem“ innenpolitisch zu lösen, versucht Ankara sich als legitimer Partner in Syrien und insbesondere in den kurdischen Gebieten zu positionieren und damit die eigene Präsenz dort zu legitimieren. Ein Ausdruck dieser Rhetorik ist die zunehmende Rede türkischer Politiker von „unseren Kurden“. Mit diesem Narrativ wird kurdischen Positionen ihre Eigenständigkeit abgesprochen, erscheint die Türkei gar als Schutzmacht der Kurden – eine Darstellung, die ihre Rolle in der gewaltsamen Repression der kurdischen Strukturen schlicht ausblendet. Die entscheidende Frage bleibt: Kann ein Frieden im Nordosten Syriens, bei dem die türkische Vormachtstellung als gegeben vorausgesetzt und sogar als Stabilitätsfaktor verkauft wird, überhaupt als gerecht betrachtet werden? Die Antwort lautet: „Nein.“ Die Realität zeigt vielmehr, dass auf Basis der anhaltenden Marginalisierung und Entrechtung der Kurden keine nachhaltige und gerechte Ordnung entstehen kann.
[1] Bei den Gefechten wurden weitere Menschen durch türkische Luftangriffe getötet oder verletzt, darunter der kurdische Comedian und Schauspieler Juma Khalil, bekannt als Bave Teyar.
[2] Ende Dezember trafen sich zwei Politiker der prokurdischen DEM-Partei mit dem inhaftierten PKK-Führer Abdullah Öcalan. Ihnen zufolge soll letzterer bereit sein, die PKK zur Niederlegung der Waffen aufzurufen.
[3] Vgl. dazu auch den Beitrag von Markus Bickel in dieser Ausgabe.