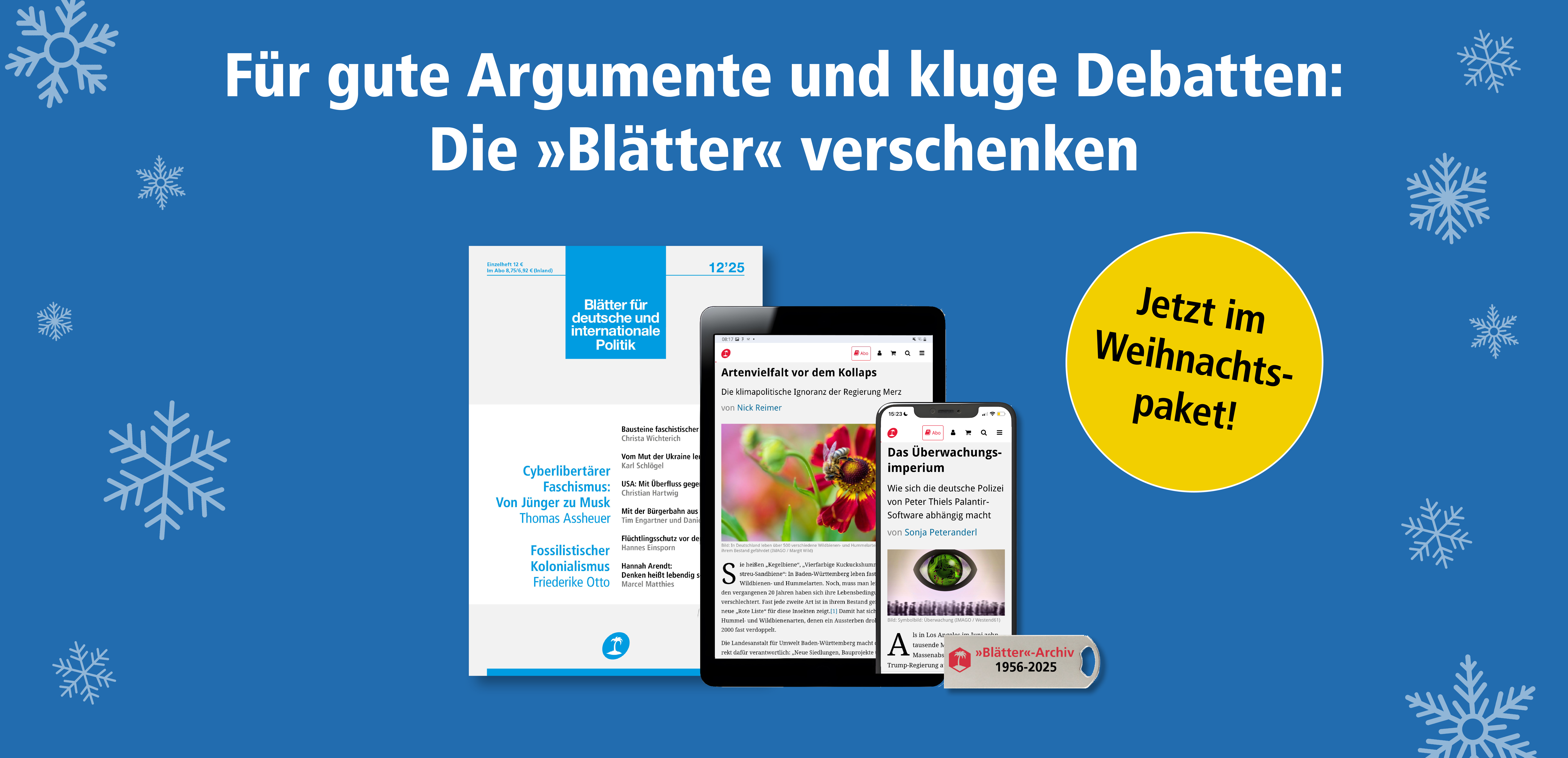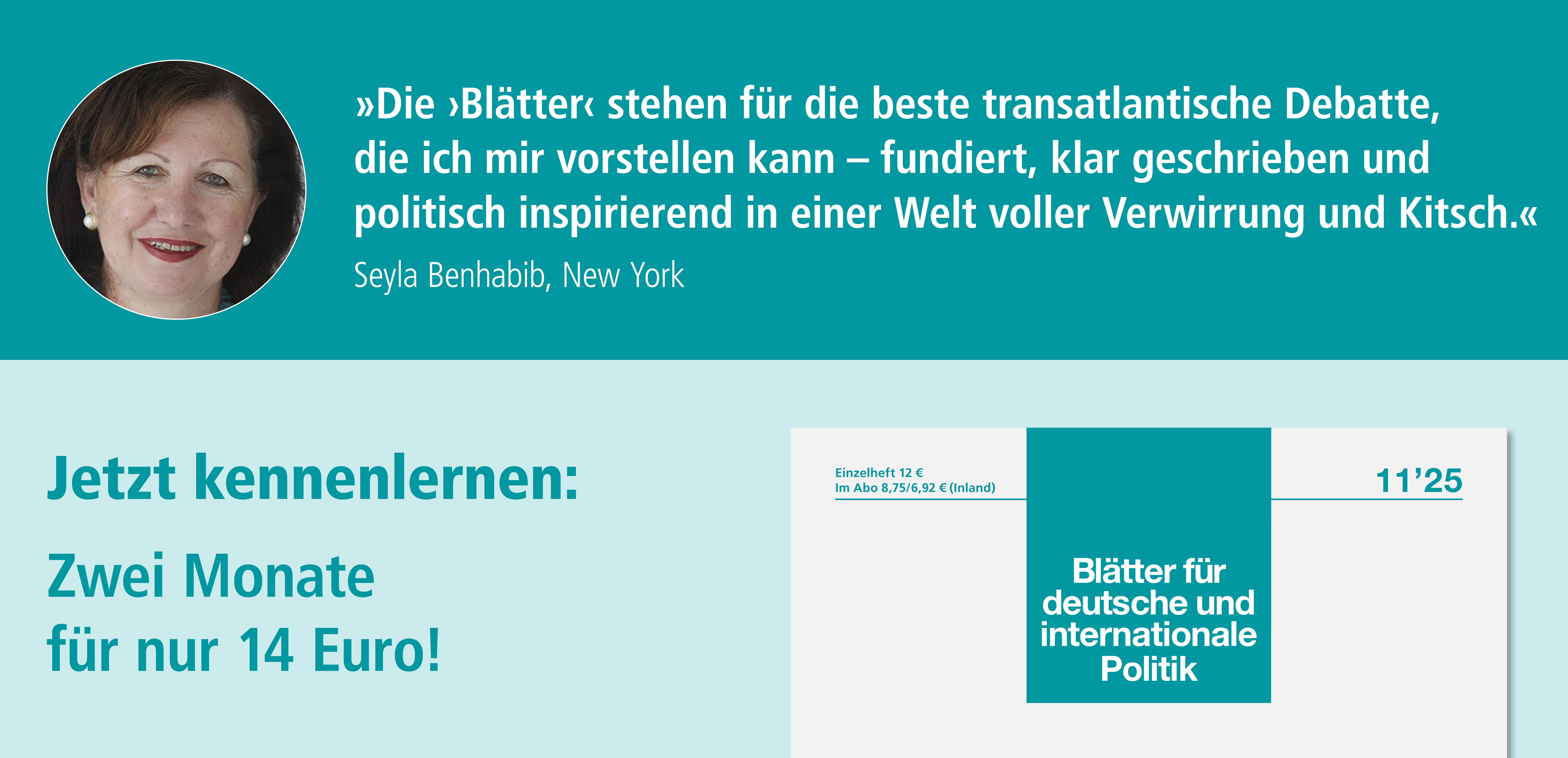Bild: Fotos der Opfer in der Völkermord-Gedenkstätte in Murambi (S Schlindwein)
Der Geruch von Verwesung hängt noch immer in der Luft – auch 30 Jahre nach dem Massenschlachten von 1994. Rund 800 mumifizierte Leichen sind aufgebahrt in den Klassenzimmern der ehemaligen Sekundarschule von Murambi, viele davon Kinder. Es ist ein schauerlicher Anblick: Einige strecken den Arm aus zum Schutz gegen die Machetenhiebe. Einige weibliche Körper haben noch immer die Beine gespreizt von der Vergewaltigung; einer Kinderleiche fehlt der Kopf. Vielen Gesichtern sieht man den Horror an, den sie vor ihrem Tod erlebt haben. Die Völkermord-Gedenkstätte im Südwesten Ruandas, rund 160 Kilometer von der Hauptstadt Kigali entfernt, ist bis heute einer der bedrückendsten Erinnerungsorte in dem kleinen Land im Herzen Afrikas. Nirgendwo wird das schier unvorstellbare Grauen von 1994 so sichtbar wie hier. Damals wurden in nur 100 Tagen über eine Million Menschen landesweit brutal ermordet, die meisten von ihnen Angehörige der Tutsi-Ethnie, aber auch moderate Hutu.
Der Tatort ist bis heute fast unangetastet. Von weitem wirkt das Gelände mit den einstöckigen Backsteinhäusern wie ein Internat während der Sommerferien. Als der Völkermord im April 1994 begann, war die Schule noch nicht ganz fertiggestellt. Die Betonmischer stehen noch immer im Hof wie stille Zeugen, verrostet vom Tropenregen. Es wirkt, als wäre die Zeit stehengeblieben. Murambi ist mehr als nur eine Gedenkstätte. Diesen Horror aus der Vergangenheit der Welt auch noch 30 Jahre später zu präsentieren, ist ein fundamentaler – wenn auch umstrittener – Aspekt von Ruandas Erinnerungspolitik. Die aufgebahrten Leichen sind Beweise, dass der Völkermord tatsächlich stattgefunden hat. Denn bis heute fühlt sich Ruanda von der Weltgemeinschaft alleingelassen.
Das weitläufige Gelände ist umringt von Hügeln, von wo aus das Internat gut einsehbar ist. Im April 1994 suchten hier fast 50 000 Tutsi Schutz vor den Gefechten. Die Politiker dieser Gegend hatten den Tutsi versprochen, dass sie in den Schlafsälen sicher seien. Doch auf den umliegenden Hügeln hatten sich bereits die Hutu-Milizen und Einheiten der Hutu-Armee postiert. Sie zerstörten die frisch verlegten Wasserleitungen, um die Menschen, die in dem Schulgelände Schutz gesucht hatten, mit Durst zu quälen.
Ausgelöst wurde das Massenschlachten am Abend des 6. April 1994 durch den Absturz eines Flugzeuges, in welchem der ruandische Präsident Juvénal Habyarimana sowie sein burundischer Amtskollege Cyprien Ntaryamira ums Leben kamen, beide Hutu. Die Maschine war beim Landeanflug auf den Flughafen in Kigali von einer Boden-Luft-Rakete abgeschossen worden. Wer diese abgefeuert hatte, ist bis heute umstritten.
Ein von langer Hand geplanter Massenmord
In jenem April 1994 herrschte bereits seit vier Jahren Bürgerkrieg. Hutu-Präsident Habyarimana hatte in den Jahren seiner Präsidentschaft eine zunehmend auf ethnischer Teilung basierende Gewaltherrschaft errichtet und den Rassenhass institutionalisiert: Tutsi durften nicht mehr in der Armee dienen, kaum Schulen und Universitäten besuchen, keine Posten in Verwaltung, Wirtschaft oder Politik mehr einnehmen. Als Folge waren bereits weit vor dem eigentlichen Völkermord die Mehrheit der Tutsi-Familien aus Ruanda geflohen, die meisten ins Nachbarland Uganda. Dort formierten sie eine Guerilla-Einheit, die Ruandische Patriotische Front (RPF), die im Oktober 1990 in ihr Heimatland einmarschierte, um das Hutu-Regime zu stürzen.
In den Jahren des darauf folgenden Bürgerkrieges rollte die RPF das Land von Osten her auf und drängte die Hutu-Armee zurück. Diese wiederum formierte Milizen – die Interahamwe –, die dem Militär im Kampf helfen sollten. Die Tutsi-Bevölkerung wurde zu Verrätern erklärt und in Schulen und Kirchen zusammengetrieben, so auch in Murambi. Als Präsident Habyarimana am späten Abend des 6. April mit dem Flugzeug vom Himmel fiel, bezichtigte seine Leibgarde die RPF, die zu jener Zeit bereits Teile der Hauptstadt kontrollierte, die Maschine abgeschossen zu haben. Noch in derselben Nacht griffen die Interahamwe zu Macheten, um die Tutsi restlos auszulöschen.
Knapp zwei Wochen später, als sich der Krieg auch im Südwesten des Landes ausbreitete, stürmten am 21. April 1994 Tausende Milizionäre frühmorgens um drei Uhr die Berufsschule in Murambi. Schüsse und Granaten wurden von den umliegenden Hügeln abgefeuert. Bei Sonnenaufgang ging ihnen die Munition aus. Da griffen sie zu Spitzhacken und anderen Gartengeräten. Gegen Mittag waren bis zu 50 000 Menschen tot.
Im Hauptgebäude ist heute ein Museum eingerichtet, in welchem die Vorgeschichte des Völkermordes erklärt wird: Die zehn Hutu-Gebote sind dort angeschlagen, welche Hutu-Männern untersagten, Tutsi-Frauen zu heiraten, die Hutu-Händlern verboten, mit Tutsi Geschäfte abzuwickeln. Die Hassreden, die damals landesweit über die Radiosender ausgestrahlt wurden, dröhnen aus alten Radiogeräten. All diese historischen Quellen sollen Zeugnis ablegen, dass der Völkermord kein spontaner Gewaltausbruch war, sondern von langer Hand geplant worden war.
An den Wänden hängen auch die Fotos der fünf verantwortlichen Politiker und Militärs, die das Massaker vor Ort befohlen hatten: darunter Laurent Bucyiabaruta, Präfekt des Bezirks Gikongoro, in welchem Murambi liegt. Dieser hatte den Milizionären später in einer Radioansprache für ihre „gut erledigte Arbeit“ gratuliert, dann floh er vor den anrückenden RPF-Soldaten in den Kongo und von dort aus weiter nach Europa. Wie zahlreiche weitere mutmaßliche Täter lebte er jahrzehntelang unbehelligt in Frankreich.
Die Suche nach den Tätern geht weiter – weltweit
Bis heute sucht eine ruandische Ermittler-Einheit nach den noch immer flüchtigen Völkermördern – und zwar weltweit. Dass viele in Europa, den USA, Kanada und gar in Australien als Flüchtlinge anerkannt sind, trägt nachhaltig dazu bei, dass sich die Ruander von der Weltgemeinschaft hintergangen fühlen. Es ist ein maßgeblicher Grund, warum Ruandas Regierung unter Langzeitpräsident Paul Kagame, einem Tutsi, in ihren außenpolitischen Beziehungen die Welt in „Freunde“ und „Feinde“ einteilt.
Ganz oben auf der Liste der geflüchteten Täter stand bislang Félicien Kabuga, einer der reichsten Geschäftsmänner Ruandas jener Zeit und ein enger Vertrauter des damaligen Präsidenten Habyarimana. Fast dreißig Jahre lang schien er verschwunden zu sein. Letztlich wurde er im Jahr 2020 nahe Paris geschnappt. Frankreichs Behörden überstellten ihn an das für Ruanda zuständige UN-Sondertribunal in Den Haag. Das dortige internationale Gericht erklärte den mittlerweile 90-jährigen „Finanzier des Völkermordes“ im Juni 2023 für verhandlungsunfähig. Immerhin: Frankreich hatte seine Pflicht getan. In Kigali wurde dies als erster Schritt zur Versöhnung gewertet.
Die umstrittene Rolle der Franzosen 1994 ist in der ruandischen Erinnerungskultur bis heute präsent, vor allem in Murambi. Lediglich 34 Menschen überlebten das Massenschlachten in der Berufsschule vom April 1994, die meisten bewusstlos im Leichenberg. Nach dem Massaker wurden die Toten verscharrt, die Klassenzimmer gereinigt. Keine acht Wochen nach dem Blutbad quartierten sich im Juni im Rahmen der von den Vereinten Nationen beschlossenen Militäroperation „Turquoise“ über tausend französische Soldaten in den Schlafsälen ein. Abends spielten sie auf den Massengräbern Volleyball. Dabei muss es auch damals, noch vielmehr als heute, nach Verwesung gestunken haben.
Für das heutige Tutsi-Regime in Kigali galten die Franzosen damit als Komplizen der Hutu-Mörder. Die Rolle Frankreichs war bislang auch in Paris ein gut gehütetes Geheimnis. Dokumente und Beweise lagen fast 30 Jahre lang sicher verwahrt in den Archiven, darunter auch der Flugschreiber von Habyarimanas Maschine, der Aufschluss über die Ursache des Absturzes bieten könnte. Er wurde nach dem Absturz von französischen UN-Soldaten geborgen und nach Paris ausgeflogen – dort liegt er bis heute unangetastet. Kein Ermittlerteam hat ihn je auswerten dürfen.
Erst 2021 hat der französische Präsident Emmanuel Macron bei einem Staatsbesuch in Ruanda eine Zeitenwende angekündigt. Am Massengrab der Völkermordgedenkstätte in Kigali hielt er eine berührende Rede: „Der Geschichte ins Auge sehen und den Anteil des Leids anerkennen, den es [Frankreich] dem ruandischen Volk zugefügt hat, indem es zu lange das Schweigen der Wahrheitsfindung vorgezogen hat“, hatte er den Ruandern versprochen. Sein Besuch sollte einen Schlussstrich unter „27 Jahre Entfremdung und Verständnislosigkeit“ ziehen. Seither hat sich in Frankreich vieles getan. Ein von Macron in Auftrag gegebener Untersuchungsbericht enthüllte im März 2021 das Ausmaß der französischen Verstrickung. Im Juni vergangenen Jahres hat ein Gericht in Paris angeordnet, ein Verfahren wegen mutmaßlicher Komplizenschaft der französischen Militärs und Regierung mit den Mördern in Ruanda wieder aufzunehmen. Konkret geht es um die Rolle der französischen Soldaten beim Massaker von Bisesero im Westen Ruandas, wo ebenfalls fast 50 000 Menschen in nur wenigen Wochen ermordet wurden. Bisesero liegt unweit der Sekundarschule von Murambi im damaligen Stationierungsgebiet der französischen Truppen.
Aus anderen Provinzen und benachbarten Orten, auch aus Murambi, hatten sich im Mai 1994 Abertausende Tutsi nach Bisesero gerettet, weil dort die Franzosen die Kontrolle innehatten. Hoch oben auf einem Hügel suchten sie in einer kirchlichen Einrichtung Schutz vor den Hutu-Milizen. Diese umstellten den Hügel und bombardierten ihn wochenlang mit Mörsern und Granaten. Als die französischen Soldaten am 27. Juni 1994 nach Bisesero vordrangen, um den Völkermord im Auftrag der Vereinten Nationen zu stoppen, versprachen sie den überlebenden Tutsi, dass sie nach drei Tagen zurückkehren würden, um sie zu retten. Dann zogen sie ab. Als sie zurückkamen, war jedoch fast niemand mehr am Leben.
2015 strebten ruandische Überlebende in Frankreich einen Prozess an. Nach sieben Jahren Ermittlungen wurde er im September 2022 jedoch eingestellt. Das Gericht entschied: Es gebe keine ausreichenden Beweise. Doch ein Revisionsgericht hat letztlich die Entscheidung gekippt und klargestellt, dass nicht alle relevanten Beweise gesichtet worden seien. Nun muss das Verfahren neu aufgerollt werden. Die unaufgearbeitete Rolle Frankreichs hat dessen Beziehungen zu Ruanda stets schwer belastet. Immerhin: Im Juli 2022 verurteilte ein Gericht in Paris Ex-Präfekt Bucyibaruta zu 20 Jahren Haft wegen seiner Rolle beim Massaker in Murambi. Der heute 79-Jährige, der nach 1994 als Flüchtling in Frankreich anerkannt war, hatte wegen seines Alters zunächst Haftverschonung genossen. Seit dem Urteil sitzt er nun im Gefängnis. Im März beging Frankreich dann eine große Geste der Versöhnung. Frankreichs oberster Staatsanwalt, verantwortlich für Terrorismus- und Völkermordverfahren, flog eigens nach Ruanda und legte auf den Massengräbern in Murambi einen Kranz nieder. Er versprach öffentlich, in Frankreich weitere Ermittlungen gegen mutmaßliche Täter anzustrengen, und bekräftigte: „Es darf keine Straflosigkeit in dieser Angelegenheit geben.“
Ein Wettlauf gegen die Zeit
Um solche Verfahren überhaupt noch durchführen zu können, sind Tatorte wie Murambi von wesentlicher Bedeutung. Sie liefern Beweise: zur Zahl der Toten bis hin zu den Tatwaffen. Unter dem Volleyballfeld in Murambi befinden sich noch immer die Massengräber, die bisher nur teilweise ausgehoben wurden. Blutgetränkte Kleidungsstücke, Schuhe, Schmuck und Tatwaffen wie Äxte sind in den Schlafsälen als Beweisstücke ausgestellt. Doch nach 30 Jahren nagt der Zahn der Zeit an den Gebeinen und Textilien: „Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit“, erklärt Jean Damascene Gasanabo, der ehemalige Chef der Dokumentationsabteilung von Ruandas Genozid-Kommission (CNLG), die für den Erhalt und die Pflege der über 200 Gedenkstätten im Land zuständig war. 2021 wurde die Kommission in das neu gegründete Ministerium für Nationale Einheit integriert.
Um die Beweisstücke vor dem Verfall zu retten, haben in den vergangenen Jahren unter Gasanabos Anleitung 120 Archivare Tag und Nacht an Scannern gestanden: Über 45 Mio. Dokumente haben sie digitalisiert. Auch die Bundesregierung in Berlin hat dieses Unterfangen unterstützt und Scanner aus Deutschland beschafft. Seit 2010 lagen tonnenweise Schriftstücke, die aus allen Landesteilen zusammengetragen worden waren, in Säcken verpackt in den feuchten Kellern der Kommission, berichtet Gasanabo. Bei den meisten handelte es sich um handgeschriebene Beschlüsse, wie der Völkermord ausgeführt werden sollte, Befehle zur Bewaffnung von Milizen, Briefverkehr zwischen der Zentralregierung und den Distriktvorstehern – Beweismittel, die bis heute in vielen Verfahren in Ruanda selbst, aber auch bei Ermittlungen anderer Behörden weltweit relevant sind.
T für Tutsi, H für Hutu
Denn aus jenem Schriftverkehr zwischen Habyarimanas Zentralregierung in Kigali und den örtlichen Bezirksvorstehern lässt sich ableiten, dass der Völkermord bereits weit im Vorfeld geplant worden war. In den Gemeinden hatten die lokal gegründeten Milizen schon Jahre vor April 1994 auf Befehl aus Kigali Listen angelegt, in welchem Haus wie viele Tutsi leben. Die Hutu-Armee hatte im Vorfeld massenweise Macheten, Spitzhacken und andere Gartengeräte beschafft und sie systematisch an die Interahamnwe-Milizen in den Bezirken ausgegeben. Diese errichteten Straßensperren, an welchen die Passanten ihre Personalausweise vorzeigen mussten. Dort war die ethnische Zugehörigkeit vermerkt: T für Tutsi, H für Hutu. All diese Dokumente sind bei internationalen Verfahren als Beweise für den Tatbestand Völkermord ausschlaggebend.
Auch die Ermittler der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gingen jahrelang in diesen Archiven in Ruanda ein und aus. Denn 2019 begann in Kigali ein Prozess gegen den Völkermordtäter Jean Twarigamungu. Er war 2015 in Deutschland verhaftet und zwei Jahre später nach Ruanda ausgeliefert worden. Der ehemalige Lehrer einer Veterinärschule von Gikongoro – dem Bezirk, in welchem auch Murambi liegt – hatte dort die örtliche Interahamwe-Miliz befehligt. Im Februar vergangenen Jahres verurteilte das ruandische Gericht ihn wegen Völkermords zu 25 Jahren Haft.
Die Beweisstücke für dieses Verfahren waren auch für die deutschen Ermittler von Bedeutung. Bislang mussten die deutschen Staatsanwälte stets persönlich nach Ruanda reisen und die verfahrensrelevanten Dokumente aus den Archiven der lokalen Rathäuser zusammensuchen, eine mühsame Arbeit. Seit alle Dokumente mit Hilfe von Stichworten digital in einer Datenbank online abrufbar sind, erleichtert dies Ermittlern die Suche nach Beweisen erheblich. Die Regierung in Kigali erhofft sich dadurch mehr internationale Zusammenarbeit bei der Suche nach den noch immer weltweit flüchtigen Tätern, bevor sie für einen Prozess zu alt sind.
Einige Anführer des Völkermordes verstecken sich nicht weit von Ruandas Grenze – im dichten Dschungel der benachbarten Demokratischen Republik Kongo. Gesucht wird beispielsweise der mutmaßliche Völkermörder General Ezéchiel Gakwerere, bekannt unter seinem Kriegsnamen Stany. Er soll im April 1994 in die gezielte Ermordung von Ruandas Premierministerin Agathe Uwilingiyimana involviert gewesen sein. Die einflussreiche Frau, eine moderate Hutu, hatte sich für Verhandlungen mit der Tutsi-Guerilla eingesetzt. Nur wenige Stunden nach dem Absturz der Präsidentenmaschine wurde sie von Habyarimanas Leibwächtergarde gezielt ermordet. Man fand ihre Leiche mit einer Kugel im Kopf und einer Bierflasche in der Vagina. General Stany war laut ruandischen Ermittlungsakten Teil dieser Exekution.
Die FDLR im Kongo: Die Völkermordideologie lebt fort
Dennoch sind er und weitere Anführer des Völkermordes für Ruandas Justiz unerreichbar. Als die RPF Ruanda im Juli 1994 vollends erobert hatte, floh die Hutu-Armee in den Kongo. Sie nahmen alles mit: Waffen und Munition, Regierungsdokumente sowie die Staatskasse. Aus Angst vor der Rache der Tutsi-Guerilla flohen auch Millionen Hutu, ein Großteil der noch verbliebenen ruandischen Bevölkerung, in den Ostkongo. In den dortigen Flüchtlingslagern gründeten die Hutu-Kommandanten später die FDLR, die Demokratischen Kräfte zur Befreiung Ruandas, in deren Reihen auch General Stany kämpft. Diese agierten wie ein Staat im Staate, allerdings im Exil.[1] Nach der Machtergreifung rückte die RPF, jetzt als offizielle Armee der neuen Tutsi-Regierung in Kigali, 1996 auch in den Kongo vor, um die Völkermörder zu jagen. Es kam zu panischen Fluchtbewegungen von Millionen ruandischer Hutu tief in den kongolesischen Dschungel hinein, wo die meisten an Hunger und Erschöpfung grausam verendeten. Um sich zu verteidigen, stellten die Völkermörder eine Hutu-Miliz mit rund 20 000 Kämpfern auf. Ihr erklärtes Ziel: Ruanda zurückzuerobern. Seitdem greift die FDLR immer wieder Ruanda an und begeht Gräueltaten auch an Kongos Bevölkerung.
Lange Zeit wurden die FDLR auch von Deutschland aus befehligt. FDLR-Präsident Ignace Murwanashyaka und dessen Stellvertreter Straton Musoni waren bereits vor dem Völkermord in der Bundesrepublik als Flüchtlinge anerkannt. Beide studierten in Deutschland, als in ihrer Heimat der Bürgerkrieg begann. Per Telefon und E-Mail kommandierten die beiden Hutu, die in ihren Gemeinden gut integriert waren und fließend Deutsch sprachen, jahrelang von Mannheim und Neuffen aus ihre Truppen im Kongo.
Als UN-Ermittlungen die Bundesanwaltschaft auf die FDLR-Führer aufmerksam machten, wurden sie 2009 verhaftet und 2011 vor Gericht gestellt. 2015 verurteilte das Stuttgarter Oberlandesgericht die beiden wegen Rädelsführerschaft in einer Terrorvereinigung und Beihilfe zu Kriegsverbrechen. FDLR-interne Dokumente, die in Stuttgart als Beweise dienten, zeigen klar, dass sich die FDLR-Führung auch zu diesem Zeitpunkt noch auf die Fahnen schrieb, den „Job in Ruanda zu Ende zu bringen“, wie sie es selbst formulierte.[2] Die Völkermordideologie von 1994 lebt also offenbar auch heute noch fort. FDLR-Chef Murwanashyaka verstarb 2019 in Haft, sein Vize Musoni wurde 2022 nach Beendigung seiner Haftstrafe nach Ruanda überstellt, wo er jetzt frei lebt. Bis heute ist Ruandas Regierung dankbar, dass Deutschland den beiden den Prozess gemacht hat.
Denn auch 30 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda ist die FDLR Hauptursache für Konflikte in der Region; so auch für den derzeitigen Krieg im Ostkongo, in dem bereits über sechs Millionen Menschen vertrieben worden sind. Die kongolesischen Tutsi-Rebellen der M23, der Bewegung des 23. März, eroberten in den vergangenen Jahren große Teile des Ostkongo, vor allem die Masisi-Berge, woher die meisten der M23-Kämpfer stammen. Sie waren 1996, damals als Jugendliche, von ihren Almen geflohen, als die ruandischen Völkermörder in den Ostkongo vordrangen und auch dort die Tutsi verfolgten. Viele kongolesische Tutsi-Familien flohen damals nach Ruanda, in ihre Farmen zogen Völkermordtäter ein. FDLR-Militärchef Sylvestre Mudacumura, 1994 Leibwächter des verunglückten ruandischen Ex-Präsidenten Habyarimana, lebte jahrzehntelang im kleinen Ort Katoyi in Masisi in einem ehemaligen Tutsi-Farmhaus.
Die meisten heutigen M23-Kämpfer sind in Flüchtlingslagern in Ruanda aufgewachsen und dort zur Schule gegangen. Viele besitzen die ruandische Staatsbürgerschaft oder dienten gar in Ruandas Armee. Doch sie sehen sich als Kongolesen. Immer wieder formierten sie Rebellenarmeen, um ihre Heimkehr mit der Waffe zu erzwingen – die M23 ist die jüngste dieser bewaffneten Gruppierungen. Die ruandische Tutsi-Regierung ist bereit, ihnen dabei militärisch zu helfen, denn beide verfolgen das Ziel, die FDLR ein für allemal auszuschalten.
Droht ein neuer Völkermord an den Tutsi?
Mit Hilfe von Ruandas Armee ist es den M23-Rebellen in den vergangenen Monaten tatsächlich gelungen, fast das gesamte FDLR-Gebiet in den dichten Wäldern im Osten des Kongo einzunehmen. Dabei starben jüngst einflussreiche FDLR-Kommandanten unter mysteriösen Umständen. Oberst Ruhinda beispielsweise, ein 53-jähriger Ruander und 1994 Leutnant in Ruandas Hutu-Armee, befehligte eine FDLR-Spezialeinheit, die in den vergangenen 20 Jahren mehrfach Ruanda angegriffen hat. Offenbar war er im Dezember 2023 bei Kämpfen zwischen der M23 und Kongos Armee verletzt und ins Krankenhaus nach Goma gebracht worden, wo er letztlich verstarb. In Kigali wurde dies als Erfolgsmeldung gefeiert.
Der Tod von FDLR-Oberst Ruhinda hat offenbart, was auch UN-Ermittler bereits zuvor veröffentlicht haben: Kongos marode Armee hat die FDLR-Miliz als Söldner angeheuert, um mit ihr gegen die Tutsi-Rebellen zu kämpfen. Und auch die Völkermordideologie und der Rassenhass gegen Tutsi werden in den Reihen der kongolesischen Armee immer stärker. Überall im Ostkongo kommt es immer wieder zu brutalen Übergriffen auf Tutsi. Anfang März wurde ein Tutsi in der Provinzhauptstadt Goma von einem Mob gelyncht, mit Macheten zerstückelt und dessen Fleisch gegessen – Formen des Kannibalismus, die an den Völkermord von 1994 erinnern. Tutsi-Familien im Kongo berichten, wie Soldaten wieder von Haus zu Haus gehen und Listen anfertigen, in welchem Haus wie viele Tutsi leben.
All dies sind alarmierende Zeichen. Die UN-Sonderbeauftragte zur Genozidprävention, Alice Wairimu Nderitu, warnte bereits Ende 2022 nach einer Kongo-Reise, sie sei „zutiefst beunruhigt“: Die aktuelle Gewalt gegen Tutsi im Kongo sei ein „Warnsignal“, dass sich erneut „Hass und Gewalt im großen Stil in einem Völkermord entladen“ könnten.
Unterdessen wird die humanitäre Lage als Folge des Krieges immer schlimmer. Allein die Provinz Nord-Kivu zählt fast drei Millionen Kriegsvertriebene. Hilfswerken zufolge verfügen die Menschen in Gomas Vertriebenenlagern am Stadtrand weder über sauberes Wasser noch über genug Nahrung. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz wiederum verzeichnet eine starke Zunahme von Menschen mit Schusswunden in den Flüchtlingslagern. Nachts ziehen bewaffnete, unbezahlte Soldaten und Milizionäre durch die Camps, immer wieder schlagen auch Granaten in den Lagern ein.
Doch auch heute zögert die Internationale Gemeinschaft, aktiv einzugreifen. Schlimmer noch: Derzeit packen die UN-Blauhelme im Kongo ihre Koffer. Auf ausdrücklichen Wunsch von Präsident Tshisekedi soll die UN-Friedensmission bis Ende dieses Jahres abziehen. Immerhin, in jüngster Zeit kommt es auf Druck der USA zu Friedensbemühungen. Die Afrikanische Union hat Angolas Präsident João Lourenço als Vermittler beauftragt, Kongos und Ruandas Präsidenten zu Verhandlungen zu drängen.
Bisher hat Kongos Präsident Tshisekedi sämtliche Verhandlungen sowohl mit der M23 als auch mit Ruanda, das die bewaffnete Gruppe militärisch ausstattet, kategorisch abgelehnt. Er bezichtigte seinen ruandischen Amtskollegen, den Ostkongo annektieren zu wollen, und bezeichnete Präsident Kagame als „Adolf Hitler“ Afrikas. Seit Anfang März gibt es nun allerdings leise Hoffnungen: Lourenço ist es gelungen, Tshisekedi und Kagame die Zusage für ein erstes gemeinsames Treffen abzuringen. Wann dieses stattfindet, ist aber noch nicht bekannt – und völlig offen ist auch, ob daraus langfristig ein Ausweg aus der Spirale der Gewalt erwachsen kann.