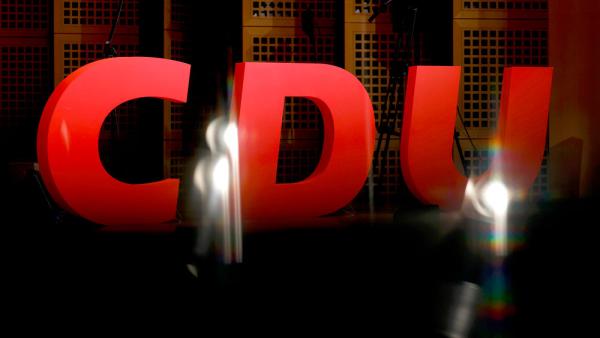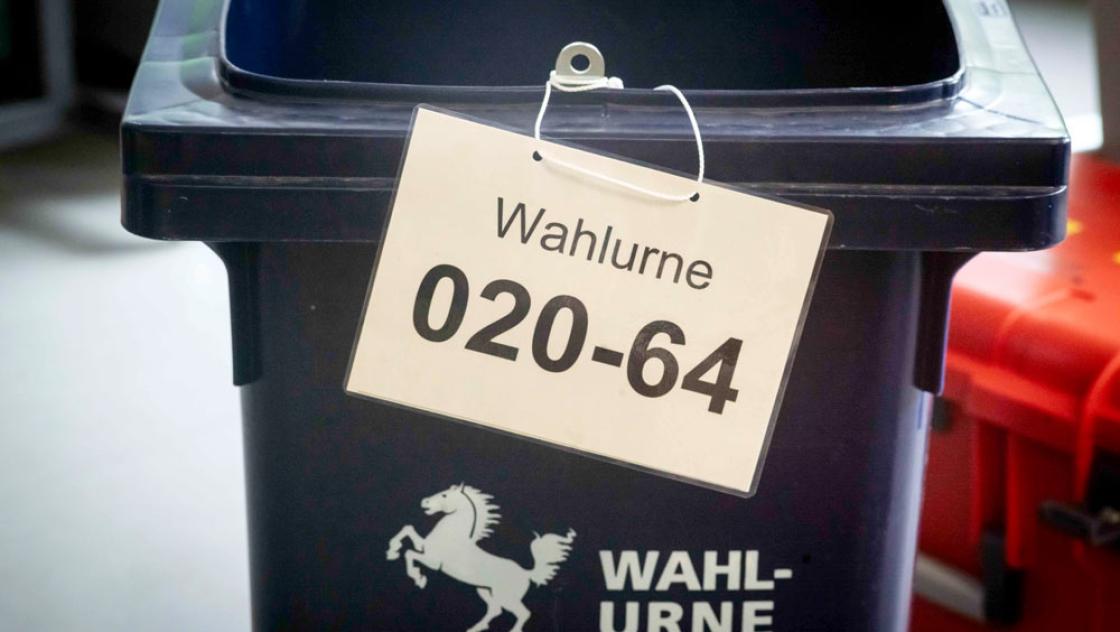
Bild: Symbolbild: Wahlurne der Europawahl, 9.6.2024 (IMAGO / Achim Zweygarth)
Die Europawahl war nicht nur auf europäischer Ebene ein Paukenschlag, sondern auch auf nationaler. Deutschland präsentiert sich als tief gespalten: Im Westen strahlt es in Union-schwarz, im Osten in AfD-blau. Die Parteien der Ampel sind absolut abgeschlagen, bundesweit kommen sie zusammen nur noch auf 31 Prozent, in Teilen des Ostens dagegen sogar nur auf knapp zehn. Wir erleben eine zunehmende „Frikassierung“, eine Zersplitterung der Parteienlandschaft. Selbst das, was wir früher als Große Koalition zu bezeichnen gewöhnt waren, die klassische Paarung aus Union und SPD, bringt gerade mal 44 Prozent auf die Waagschale.
Fast dramatischer noch wird die Lage, wenn man die Zweitplatzierten betrachtet. Daran zeigt sich, dass die AfD keineswegs bloß die neue Volkspartei des Ostens ist, sondern immer mehr auch die Partei der Arbeiterinnen und Arbeiter. Während in Ostdeutschland fast immer die Union hinter der AfD auf Platz zwei liegt, wurde umgekehrt die AfD in erheblichen Teilen des Westens, insbesondere in den ehemaligen Arbeiterhochburgen des Ruhrgebiets, hinter der CDU zur zweitstärksten Partei, und zwar teils deutlich vor der SPD, die ihren Status als Arbeiterpartei endgültig verloren zu haben scheint.
Was der Scholz-SPD mit ihren nur noch 13,9 Prozent – dem schlechtesten Ergebnis bei einer gesamtstaatlichen Wahl seit 1887 – droht, ist das Schicksal der französischen Sozialisten unter François Hollande. Nach dessen schwacher Präsidentschaft gelang es Emmanuel Macron, bei der Präsidentschaftswahl 2017 als Populist der Mitte das alte Parteiensystem zu sprengen und die beiden Volksparteien, Sozialisten und Konservative (Les Républicains), regelrecht zu pulverisieren. Ein ähnliches Schicksal blüht nun der inhaltlich und personell entleerten SPD unter dem Zangenangriff von AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).
In Frankreich waren es die Linkspopulisten unter Jean-Luc Mélenchon, erklärtes Vorbild von Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine, die das linke Vakuum füllten. Gleiches widerfährt der SPD, die eine halbe Million Wähler an das erstmals angetretene BSW verloren hat – allerdings auch und noch gravierender 2,6 Millionen an das Nichtwählerlager, 1,4 Millionen an die Union und ebenfalls eine halbe Million an die AfD.
Die auch von bürgerlicher Seite propagierte Erwartung, die neue Wagenknecht-Partei werde die AfD erhebliche Stimmen kosten – das BSW quasi als letzte Chance –, hat sich dagegen als Chimäre erwiesen. Obwohl Wagenknecht die Wählerinnen und Wähler der AfD im Wahlkampf regelrecht umgarnte, blieb der Zufluss spärlich, ungeachtet der Skandale um Maximilian Krah und Petr Bystron. Daran zeigt sich, dass die Wählerbindung der AfD in den letzten Jahren enorm zugenommen hat. Viele ihre Anhänger wählen die Rechtsradikalen ungeachtet ihres Rufes – oder vielleicht sogar gerade deswegen. Gerade im Osten verfügt die AfD inzwischen über eine feste Stammwählerschaft, die sich durch Verfehlungen von AfD-Politikern in keiner Weise irritieren lässt.
Das BSW-Klientel besteht dagegen ganz überwiegend aus ehemaligen Wählerinnen und Wählern der Linkspartei, die mit deren Migrationspolitik tendenziell offener Grenzen nicht zufrieden sind, und der SPD, die mit deren Unterstützung der Ukraine hadern. Mit aller Macht ist das BSW in das verbliebene linke Lager eingebrochen, haben Lafontaine und Wagenknecht ihre einstige Partei kannibalisiert, die auf nationaler Ebene keine Chancen mehr haben dürfte.
Panik in der Ampel
In der Ampel – und speziell bei SPD und Grünen – geht nun die Angst um, zumal mit Blick auf die im September anstehenden drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Beim Ergebnis der Europawahl habe etwas reingespielt, „was ich mal fast Kontaktschande nennen würde“, versuchte SPD-Generalsekretär und Wahlkampfleiter Kevin Kühnert bei seiner Analyse den beiden Koalitionspartnern den schwarzen Peter zuzuschieben. Diese würden speziell im Osten von einem Teil der Bevölkerung sehr stark abgelehnt, was auch auf die SPD abfärbe.
So sehr diese Erklärung auch von eigenem Versagen ablenken soll, und das zumal mit einem fatalen Begriff, trifft sie doch einen wahren Punkt. Die Grünen als die größten Verlierer dieser Wahl sind von 20,5 Prozent 2019 auf 11,9 abgestürzt. In den knapp drei Jahren der Ampelregierung sind sie zu einer in Teilen des Landes regelrecht verhassten, als toxisch begriffenen Partei geworden. Mit der Konsequenz, dass die Brandmauer seitens der Konservativen teilweise eher gegen die Grünen als gegen die AfD gefordert wird.
Die Folgen sind fatal: Gerade was den Klimaschutz anbelangt, hat die Ampel verbrannte Erde hinterlassen. Das wiederum ist, neben Fehlern der Grünen, vor allem ein „Erfolg“ der FDP, die von Anfang an ihre Strategie der „Opposition aus der Regierung gegen die Regierung“ vor allem gegen die Grünen ausgerichtet hat, egal ob gegen den Atomausstieg oder das Gebäudeenergiegesetz.
Und, so die Ironie der Geschichte, durch das Ergebnis der Europawahl fühlen sich die Liberalen in ihrer Konfrontationsstrategie noch bestärkt. Dass sie von ihrem, allerdings bereits miserablen, 2019er-Ergebnis von 5,4 Prozent nur zwei Promillepunkte verloren haben, wird als Stopp des Abwärtstrends gefeiert. So im Kurs der radikalen Profilierung vermeintlich bestätigt, wird die FDP diesen nicht nur durchhalten, sondern weiter verstärken – auch auf die Gefahr eines möglichen Bruchs der Ampelkoalition hin.Das aber heißt, dass bei den laufenden Verhandlungen um den Bundeshaushalt 2025 heftige Auseinandersetzungen unausweichlich sind. „Unsere Anhänger wollen uns kämpfen sehen, die erwarten mehr Reibung, mehr Auseinandersetzung, mehr sozialdemokratisches Profil“, so für die SPD noch am Wahlabend unisono Kevin Kühnert und Parteichef Lars Klingbeil. Und in der Tat: Gerade weil die SPD so viele Wählerinnen und Wähler an das Nichtwählerlager verloren hat, will und muss sie ihre Position in der Ampel deutlicher kenntlich machen.
Gleiches aber gilt für die Lindner-FDP, die auf Bundesebene nach wie vor mit der Fünfprozenthürde zu kämpfen hat, von Ostdeutschland ganz zu schweigen. Alle drei Ampelparteien, aber insbesondere FDP und SPD, kämpfen folglich immer stärker auf eigene Rechnung und machen kaum noch Anstalten, die eigene Profilierung hinter das Gesamtinteresse zurückzustellen.
So dominieren die parteipolitischen Imperative das gesamte Agieren und Erscheinungsbild der Ampel. Die Konsequenz ist eine höchst dysfunktionale, zunehmend blockierte Regierung im Zustand absoluter Zerstrittenheit – und darüber thront ein „Nö“-Kanzler als lame duck, der die eigene Verantwortung für den auf ihn zugeschnitten EU-Wahlkampf weitgehend negiert.
Angesichts dessen erscheint es fast als ausgeschlossen, dass die drei Parteien den – wieder einmal – versprochenen Neuanfang schaffen können. Dabei wäre angesichts der außen- wie innenpolitisch dramatischen Lage ein solcher dringend geboten, als eine konzentrierte und konzertierte Aktion.
Doch der systemische Parteiimperativ geht dahin, das Maximale allein für sich selbst rauszuholen, auch gegen die politische und ökonomische Vernunft. Dies manifestiert sich am stärksten im erbitterten Widerstand der FDP gegen die so dringend gebotene Verbreiterung der Finanzierungsgrundlage des Bundeshaushalts. Selbst der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), ansonsten eher Vertreter des schlanken Staates, fordert eine Ausnahme von der Schwarzen Null und ein Sondervermögen für den Standort Deutschland, genau wie die ökonomischen Experten von links bis konservativ.[1] Mit Investitionen von 400 Mrd. Euro in Verkehrswege, Kitas und Schulen, den Wohnungsbau und den Klimaschutz sollen laut BDI der öffentliche Investitionsstau aufgelöst und private Investitionen mobilisiert werden.
Was aber ist dagegen die handlungsleitende Parteilogik der FDP? Ließe sie die Schwarze Null oder die Schuldenbremse fallen, würde die Union aus ebenfalls rein parteiegoistischen Gründen gegen die „Umfallerpartei“ Front machen. Hinzu kommt, dass auch in der Bevölkerung eine deutliche Mehrheit für die Einhaltung der Schwarzen Null plädiert, gegen den ökonomischen Sachverstand. Deshalb hält die FDP an ihrem Austeritätskurs unverbrüchlich fest, koste es das Land, was es wolle. Gleichzeitig verspricht Lindner seiner Klientel weitere Steuererleichterungen, obwohl in dieser Notlage der Republik unbedingt über das Gegenteil nachgedacht werden müsste, nämlich über eine größere Indienstnahme der starken Schultern.
Merz-Union: Taktik ohne Strategie
Bei alledem spielt aber auch der vermeintliche Wahlsieger, die Union, eine ausgesprochen unrühmliche Rolle. Auch ihr geht Parteiinteresse eindeutig vor Landesinteresse. Getrieben von der Hoffnung auf baldige Neuwahlen und die eigene Spitzenkandidatur gibt vor allem der Partei- und Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz keine taugliche Antwort auf die historische Krisenlage, wenn er lediglich vehement die Einhaltung der Schuldenbremse fordert. Denn jegliche Konstellation unter seiner Führung würde die Finanzierungsprobleme der Ampel erben, die das Land schon jetzt an den Rand der Regierungsunfähigkeit treiben.
Noch verfahrener stellt sich die Lage mit Blick auf den Osten dar. Teilweise kommen AfD und BSW dort zusammen auf über 50 Prozent. Das lässt erahnen, wie schwierig es zukünftig sein wird, Regierungen zu bilden. Doch während sich Sahra Wagenknecht aus strategischen Gründen offen für Koalitionen sogar mit der Union zeigt, erteilte CDU-Chef Merz Koalitionen mit dem BSW vorschnell eine Absage, die er für die Landesebene anschließend zurücknehmen musste. Denn worauf er auch in diesem Fall keinerlei Antwort gab, ist die Frage, wie die östlichen Bundesländer dann zu einer Regierung kommen sollen. Schließlich hält die Union 35 Jahre nach dem Mauerfall noch immer trotzig an ihrer Hufeisentheorie fest: Wenn es mit der AfD eine erwiesen rechtsextremistische Partei gibt, muss es, so die verquere Logik, auch ein linkes Pendant dazu geben, sprich: die Linkspartei als Nachfolgepartei der SED. Dass Bodo Ramelow seit bald zehn Jahren höchst solide und allenfalls sozialdemokratisch in Thüringen regiert, übrigens mit weit christlicherem Habitus als so mancher CDU-Politiker, spielt in dieser Betrachtung keine Rolle. Damit aber, so die Ironie der Geschichte, spielt die Union dem BSW regelrecht in die Hände. Denn gegen Merz‘ Verdikt stellt die Ost-CDU längst Gedankenexperimente an, wie mit Wagenknechts neuer Truppe zu koalieren wäre. Und in der Tat: So wenig mit einer Partei außenpolitisch Staat zu machen ist, für die genau wie für die AfD nicht Putin, sondern Selenskyj der Kriegstreiber ist, wird man doch auf Landesebene mit vernünftigen Leute wie der ehemaligen Eisenacher Bürgermeisterin Katja Wolf, damals Linkspartei, heute BSW, reden können und müssen, wenn die CDU das absurde Koalitionsverbot mit der Linkspartei aufrecht erhalten, aber trotzdem regieren will.
Die Frage ist bloß, ob sich die neue Partei tatsächlich in die Verantwortung nehmen lassen wird. Bisher lautete Wagenknechts Devise gegen den Reformerflügel der Linken stets: Bloß keine Verantwortung übernehmen, denn wer dies tut, kann keine Fundamentalkritik mehr üben. Das ist das Glück der Verantwortungsverweigerer und die Tragik derer, die Verantwortung übernehmen: Wer regiert, macht Fehler; und wer in einer Koalition schmerzliche Kompromisse machen muss, entzaubert sich selbst ziemlich schnell und verliert so an Attraktivität. Das trifft längst auch die Linkspartei.
Deswegen plädierte Wagenknecht in der Vergangenheit stets gegen Koalitionen und für Fundamentalopposition. Und da sie mit ihrer neuen Partei in erster Linie auf die Bundestagswahl zielt, würde eine Regierungsübernahme in einem Ostbundesland ihre Strategie grundlegend gefährden. Das nämlich ist der große strategische Vorteil der AfD wie auch des BSW: Die rote Karte kassieren nur Parteien, die an der Regierung sind. Die Radikalen profitieren dagegen davon, dass sie keiner Bewährung ausgesetzt sind. Das wiederum ist ein Grund dafür, warum jetzt in der Union, aber auch in Teilen der Medien, erste Überlegungen angestellt werden, ob man nicht auch die AfD entzaubern müsse, indem man sie in Verantwortung bringt. Wenn Merz davon spricht, dass die Wagenknecht-Partei sowohl links- als auch rechtsextrem sei, warum sollte man dann nicht gleich mit einer wenigstens „nur“ rechtsextremen AfD koalieren? So lautet die Argumentation in einem Teil der CDU, dem die AfD-Mitglieder ohnehin viel näher sind; viele davon gehörten schließlich einst zur Union – warum also nicht koalieren?
Das rationale Argument dahinter ist das genannte: Desavouieren und blamieren können sich Parteien tatsächlich vor allem in Verantwortung. Siehe Robert Sesselmann, den ersten AfD-Landrat in Sonneberg, der nach einem Jahr schon deutlich an Zuspruch verloren hat.
Aber: Anders als im kommunalen Bereich werden auf Landesebene Gesetze erlassen. Schon deshalb verbietet es sich, eine erwiesen rechtsextremistische Partei hier in Verantwortung zu bringen. Und zwar nicht zuletzt deshalb, um zu verhindern, dass sie auf diese Weise salonfähig gemacht wird.
Österreich ist dafür das schlagende Beispiel: 2000 kam Jörg Haiders FPÖ erstmals als Juniorpartner in die Bundesregierung; 2018 folgte, jetzt schon als Vizekanzler, Heinz-Christian Strache; und am 29. September könnte Herbert Kickl zum selbsternannten „Volkskanzler“ gekürt werden – ein weiterer großer Schritt der Normalisierung des Rechtsradikalismus in Europa. Angesichts der rasenden „Entdämonisierung“ der Ultrarechten sei an dieser Stelle auch an den deutschen Weg erinnert. 1930 gab es die erste Regierungsbeteiligung der NSDAP auf Landesebene, drei Jahre später war Adolf Hitler Reichskanzler. Und so sehr sich die Zeiten und Akteure auch unterscheiden: Schon damals begann das Elend der „Entzauberung“ in Thüringen.
[1] Albrecht von Lucke, Gegen Ampel und AfD: Die mobilisierte Republik, in: „Blätter“, 2/2024, S. 5-8, hier S. 8.