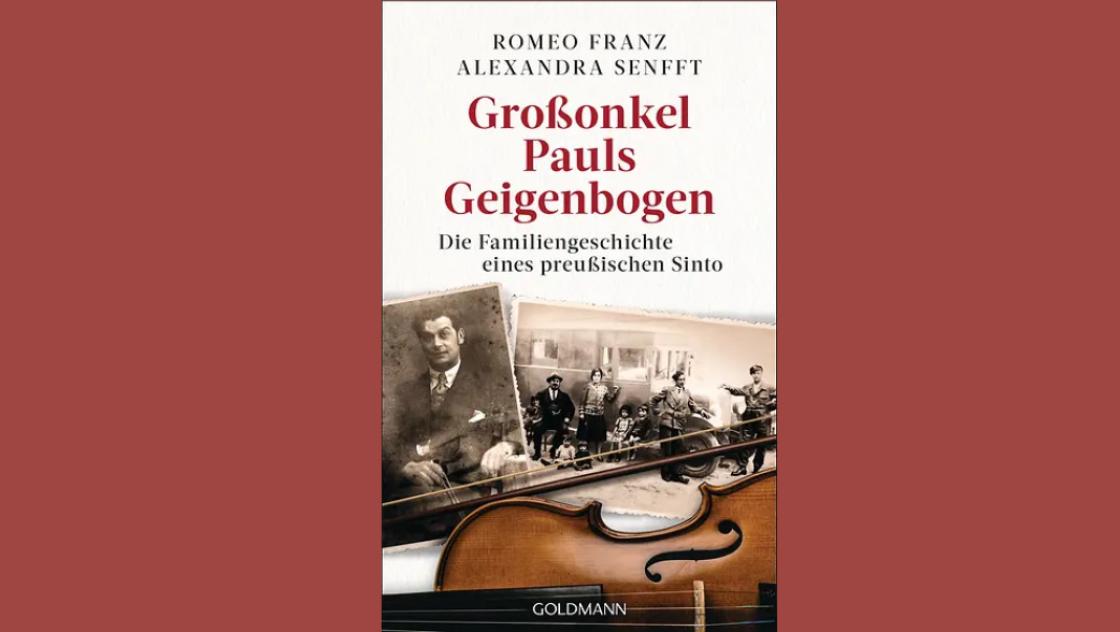
Bild: Romeo Franz und Alexandra Senfft, Großonkel Pauls Geigenbogen: Die Familiengeschichte eines preußischen Sinto, Cover: Goldmann Verlag
Es hat sehr lange gedauert, bis Sinti und Roma als rassistisch verfolgte Opfer des Holocaust anerkannt wurden. Und das, obwohl bis zu einer halben Million von ihnen dem NS-Terror zum Opfer gefallen sind. Wobei diese Zahl nur eine grobe Schätzung darstellt: Viel zu spät hat die Forschung begonnen, sich mit dem Schicksal jener Menschengruppe zu beschäftigen, die von den Nationalsozialisten als „Zigeuner und nach Zigeunerart umherziehende Personen“ klassifiziert und verfolgt wurde. In Deutschland und Österreich lebten um 1930 ungefähr 41 000 Sinti und Roma, davon starben etwa 25 000 in den Konzentrations- und Vernichtungslagern der Nazis. Nach dem Krieg und dem „Baro Marepen“, dem „Großen Morden“, wie der Holocaust auf Sinti-Romanes genannt wird,[1] kehrten nur zehn Prozent von ihnen wieder nach Hause zurück.
Die durchgestrichene Schreibweise des „Z-Wortes“, das als abwertende und oft gleichzeitig romantisierende Fremdzuschreibung nicht sachlich und neutral verwendet werden kann, haben Romeo Franz und Alexandra Senfft in ihrem gemeinsam verfassten Buch „Großonkel Pauls Geigenbogen. Die Familiengeschichte eines preußischen Sinto“ gewählt. Darin erzählen sie die Geschichte der weitläufigen Sinto-Familie des Jazzmusikers und Bürgerrechtlers Romeo Franz, besonders deren Leidens- und Fluchterfahrungen während der NS-Verfolgung. Franz stützt sich dabei auf seine eigenen Erinnerungen als Kind – er wurde 1966 in Kaiserslautern geboren – sowie auf die Erzählungen von zahlreichen Verwandten, vor allem seiner Großmutter. Die Journalistin Alexandra Senfft hat die Fakten mit Hilfe von Archiven verifiziert und durch Literaturrecherche sowie Gespräche mit Zeitzeug:innen ergänzt. Das Buch schildert auch die nur zögerliche Aufarbeitung dieser Verbrechen in der Nachkriegszeit und die Bedeutung antiziganistischer Bürgerrechtsarbeit, für die sich Franz seit Jahren engagiert. Seit 2018 ist er als Politiker der Grünen Abgeordneter im Europaparlament.
Mit der Kombination aus persönlicher Familiengeschichte und zeithistorischer Einordnung gelingt es, die besondere Art und Weise von rassistischer Ausgrenzung zu vermitteln, die Sinti und Roma seit Jahrhunderten erfahren. Die Ursprünge der knapp zwölf Millionen Sinti und Roma, die heute in Europa leben, gehen auf Menschen zurück, die um das vierte und fünfte Jahrhundert nach Christus aus dem Punjab im Nordwesten Indiens nach und nach über Persien und Armenien bis nach Europa kamen. In Deutschland ist ihre Existenz seit dem 15. Jahrhundert nachgewiesen. Wie man es bei einer so langen Geschichte und einem so großen Verbreitungsgebiet erwarten muss, gibt es unter Sinti und Roma eine ganz erhebliche Bandbreite an Kulturen und Lebensstilen. Als Sinti bezeichnen sich etwa die in Westeuropa siedelnden Gruppen, um sichtbar zu machen, dass sie – im Unterschied zu den erst seit dem 19. Jahrhundert aus Osteuropa immigrierten Roma – bereits seit vielen Jahrhunderten hierzulande ansässige Staatsbürger:innen sind.
Gemeinsames Merkmal all der vielfältigen Gruppierungen ist ihr romanessprachiger Hintergrund. Romanes ist eine mit dem Sanskrit verwandte indogermanische Sprache, hat also trotz der Wortähnlichkeit nichts mit den vom Lateinischen abgeleiteten romanischen Sprachen zu tun. Im Lauf der Jahrhunderte hat sich eine solche Fülle an Dialekten und Variationen entwickelt, dass sich Sinti und Roma nicht überall problemlos untereinander verständigen können. Auch gibt es bislang keine vereinheitlichte Schriftsprache, sondern Romanes wird nach wie vor überwiegend mündlich übermittelt. Geschätzt beherrscht heute nur etwa die Hälfte der europäischen Sinti und Roma diese Sprache. Trotzdem ist die Fähigkeit, sich auf Romanes zu verständigen, dasjenige Merkmal, das sich noch am ehesten eignet, um die Gruppe der Sinti und Roma zu umreißen. Eine biologische Abstammungslinie, wie sie das diasporische Judentum mit dem Mutterprinzip eingeführt hat, gibt es hier nicht. Heiraten mit „Gadjes“ (das Romanes-Wort für Nichtroma) ist kein Tabu, und auch wenn Familienzusammenhänge sehr wichtig sind, zählen vor allem das Selbstverständnis und die Anerkennung der eigenen Tradition. Aber auch die kann kaum fest umrissen werden, denn Sinti und Roma haben sich kulturell stark den Gepflogenheiten der Länder angepasst, in denen sie leben. Sie sprechen deren Sprache, wählen landesübliche Namen und sind in katholisch geprägten Ländern katholisch, in evangelischen evangelisch, in islamischen muslimisch.
Die Nichtsesshaftigkeit wiederum ist in erster Linie eine von der Mehrheitsgesellschaft zugeschriebene kulturelle Eigenart und oft ein Klischee. Erstens gibt es in Europa schon immer nichtsesshafte Gruppen, auch ohne Romanes-Hintergrund – die „Jenischen“ zum Beispiel. Zweitens ist die mobile Lebensweise der Sinti und Roma in vielen Fällen nicht frei gewählt, sondern eine Folge von Diskriminierung. In Westeuropa führte etwa ihr Ausschluss aus den Zünften dazu, dass viele auf Wanderberufe ausgewichen sind und ihren Lebensunterhalt als Musiker:innen und Artist:innen, als Händler:innen oder Messerschleifer:innen verdienten. Mobilität, Pragmatismus und Anpassungsfähigkeit sind zudem wichtige Ressourcen, wenn man schnell auf äußere Gefahren reagieren muss.
Die Flucht als einzige Rettung
Ein Beispiel dafür ist die abenteuerliche Fluchtgeschichte von Franzens Großmutter Ursula Blum, die zusammen mit ihrem Mann und dessen Familie auf der Flucht vor den Nazis jahrelang durch Italien, Kroatien und den ganzen Balkan bis nach Odessa und wieder zurück reiste. Dabei gaben sie sich teilweise als deutsche Schausteller:innentruppe aus, die mit dem Auftrag zur Unterhaltung deutscher Soldaten unterwegs sei. Auf dieser Flucht, 1942 in Zagreb, kam auch Romeo Franzens Mutter Mery zur Welt.
Wenn es die gesellschaftspolitische Situation aber zuließ, haben sich Sinti und Roma häufig fest angesiedelt. So wuchs die 1892 geborene Urgroßmutter von Romeo Franz, Frieda Pohl, in Brandenburg auf und zog als Kind mit ihren Eltern nach Berlin. Dass sie trotz ihres festen Wohnsitzes als Sintizza ins Visier der Nazis geriet, ist vermutlich einer Denunziation zuzuschreiben. Im Oktober 1941 wurden sie und ihre Kinder von der „Rassehygienischen Forschungsstelle“ des Reichsgesundheitsamtes erfasst, also Nase, Augen und Hände fotografiert und die Gesichter vermessen. Die 1936 eingerichtete Institution unter der Leitung des Psychiaters und Rassentheoretikers Robert Ritter hatte die absurde Aufgabe, „echte Zigeuner“ von „Mischlingen“ und anderen „Herumziehenden“ zu unterscheiden und entsprechend zu klassifizieren. Friedas älteste Tochter Ursula ergriff die Flucht, zwei andere Geschwister wurden jedoch in Konzentrationslager deportiert: Die 1927 geborene Bärbel starb in Ravensbrück, der 1926 geborene Joschi überlebte Auschwitz nur knapp und starb 1948, gerade 22 Jahre alt, an den Spätfolgen der erlittenen Gewalt.
Bis Sinti und Roma als rassistisch Verfolgte offiziell anerkannt wurden, hat es bis zum 21. Jahrhundert gedauert. Denn anders als bei den jüdischen Opfern des Holocaust hielt sich in Bezug auf die „Zigeuner“ auch noch Jahrzehnte nach dem Krieg die Vorstellung, sie wären aufgrund ihrer Lebensweise – vermeintlich zu Kriminalität neigend und arbeitsscheu – irgendwie zu Recht in die Konzentrationslager gekommen. Bis in die 1980er Jahre wurde allgemein geleugnet, dass es sich hier überhaupt um eine rassistisch motivierte Verfolgung handelte. Erst seit 2012 gibt es in Berlin ein Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas, und erst 2015 rief das Europäische Parlament den 2. August als jährlichen „Europäischen Holocaust-Gedenktag für die Roma“ aus.
Stereotype und Unwissen über diese Bevölkerungsgruppe halten sich bis heute. Um so wichtiger ist dieses Buch, das wirklich allen ans Herz zu legen ist, die sich für das Thema interessieren. Es ist unterhaltsam geschrieben, setzt kein Vorwissen voraus und lässt eine Generation von Zeitzeug:innen zu Wort kommen, deren Erfahrungen es wert sind, endlich Gehör zu finden.
Romeo Franz und Alexandra Senfft: Großonkel Pauls Geigenbogen. Die Familiengeschichte eines preußischen Sinto. Goldmann, München, 384 Seiten, 24 Euro.
[1] Auf Romanes wird der Holocaust an den europäischen Roma während der NS-Zeit als Porajmos (deutsch: „das Verschlingen“) bezeichnet.









