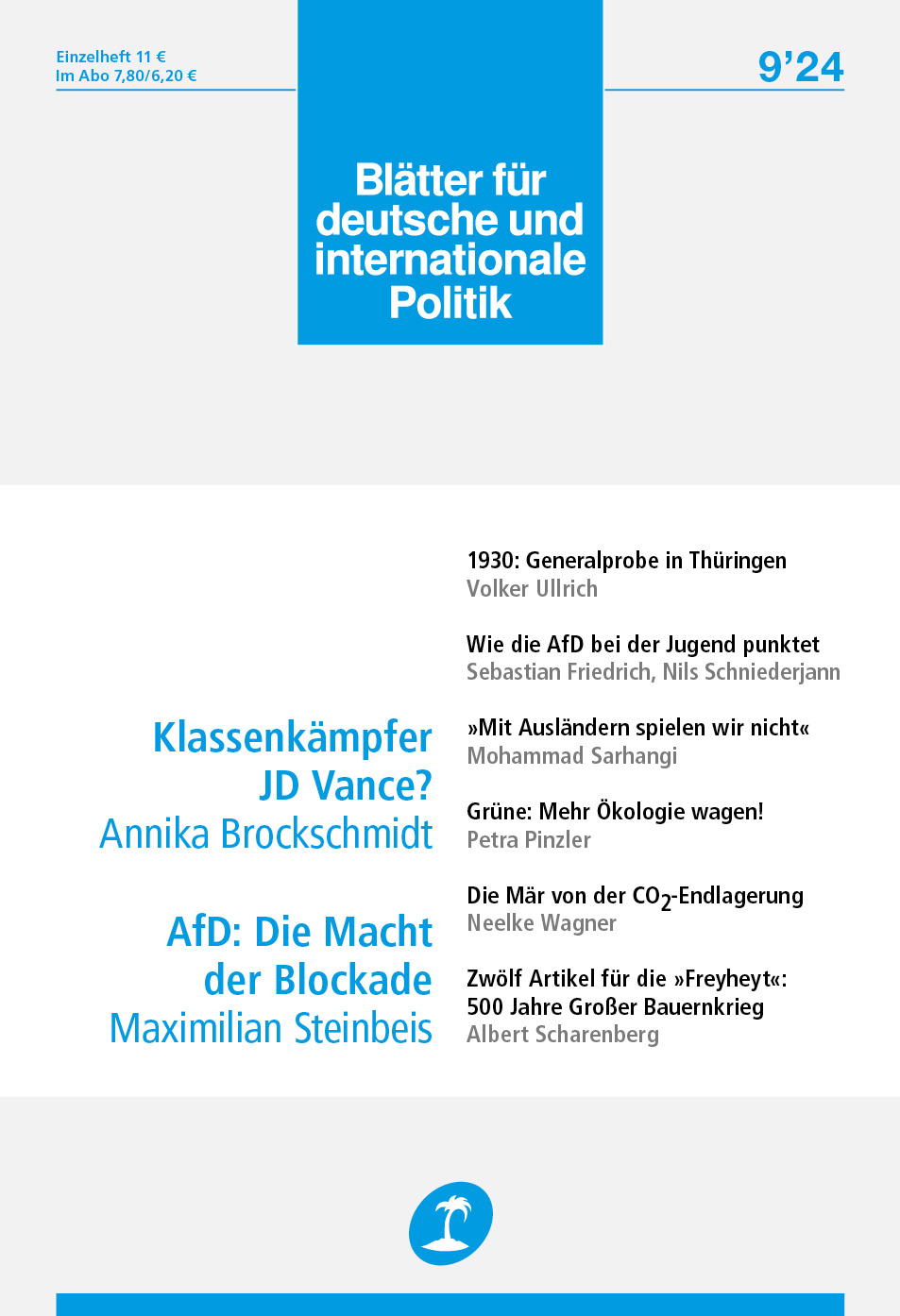Wie die NSDAP 1930 die Zerstörung der Demokratie übte

Bild: Das Deutschen Nationaltheater mit dem Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar um 1930 (IMAGO / United Archives / M-Verlag Berlin / A. Schulze)
Am 23. Januar 1930 kommt es im thüringischen Landtag zu einer erregten Aussprache. Auf der Tagesordnung steht die Wahl einer neuen bürgerlichen Rechtsregierung, der einer der engsten Gefolgsleute Hitlers und Mitputschist von 1923, Wilhelm Frick, als Innen- und Volksbildungsminister angehören soll. Zu Beginn kritisiert der vormalige Ministerpräsident und SPD-Fraktionsvorsitzende, August Frölich, dass der Landtagspräsident die schwarz-rot-goldene Fahne auf dem Landtagsgebäude habe einziehen lassen. Wolle man dadurch demonstrieren, fragt er, „dass die Farben des Dritten Reiches unter Hitler-Frick anstelle der Reichs- und Landesfarben treten sollen“? Mit dem Nationalsozialisten Frick, so fährt der Redner fort, werde „ein Hochverräter als Verfassungsminister“ bestellt, der als bayerischer Beamter schon einmal den Eid auf die Verfassung gebrochen und aus seiner Gegnerschaft gegen das parlamentarisch-demokratische System nie einen Hehl gemacht habe.
Frölich erinnert daran, dass Frick im Reichstag für die Amnestierung des Mitbeteiligten am Rathenau-Mord, Ernst Werner Techow, plädiert und Straffreiheit für die Erzberger-Attentäter Schulz und Tillessen gefordert hatte. Der DVP, die sich an der Rechtsregierung beteiligen will, ruft er ins Gedächtnis, dass Frick gerade erst im Dezember 1929 den verstorbenen Außenminister Gustav Stresemann als bezahlten Agenten des Auslands geschmäht habe, weil er den Friedensnobelpreis angenommen hatte. Immer wieder von Zwischenrufen der Nationalsozialisten unterbrochen, schließt Frölich seine Rede mit den Worten: „Der heutige Tag wird durch die Wahl des Herrn Frick zu einem Tage der politischen und kulturellen Schande Thüringens.“
Der Fraktionsvorsitzende der DVP, Georg Witzmann, versucht am Nachmittag, die Haltung seiner Partei zu rechtfertigen. Gegen erhebliche Bedenken habe man sich entschlossen, in die Regierung einzutreten, getreu dem Grundsatz, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten, „die den guten Willen haben, mit ihrer Arbeit dem Wohle des Landes zu dienen“. Frick habe versprochen, den Eid auf die Verfassung zu leisten, und überdies erklärt, er habe Stresemann keine Bestechlichkeit vorwerfen wollen. Eine Brandmauer nach rechts steht für die thüringische DVP nicht zur Debatte. Im Gegenteil, die Nationalsozialisten stünden der DVP „weltanschaulich und politisch näher“ als die Sozialdemokraten, versichert Witzmann. Am Ende wird die Regierung mit 28 gegen 22 Stimmen der SPD, KPD und DDP bestätigt. Mit Frick zieht der erste nationalsozialistische Minister in eine Landesregierung ein.
Dass ausgerechnet Weimar – die Stadt, in der sich die Republik ihre demokratische Verfassung gegeben hatte –, den Nationalsozialisten als Sprungbrett in eine wichtige Machtposition dienen sollte, geschah keineswegs zufällig. Denn nach dem Zwischenspiel der Einheitsfrontregierung von SPD und KPD im Herbst 1923, das wie in Sachsen durch Reichsexekution beendet worden war, hatte in Thüringen eine starke Bewegung nach rechts eingesetzt. Aus den Landtagswahlen vom 10. Februar 1924 war der „Thüringische Ordnungsbund“ – ein Zusammenschluss von DNVP, DVP und Thüringischem Landbund – als stärkste Kraft hervorgegangen. Er verfehlte mit 35 von 72 Landtagsmandaten allerdings die Mehrheit und war deshalb auf die Duldung des Völkisch-Sozialen Blocks, einer Nachfolgeorganisation der verbotenen NSDAP, angewiesen, der mit 9,3 Prozent der Stimmen und sieben Landtagsmandaten ebenfalls einen Überraschungserfolg erzielt hatte.
Als nach Wiederbegründung der NSDAP im Februar 1925 ein reichsweites Redeverbot gegen Hitler verhängt wurde, war es der Innenminister der Ordnungsbund-Regierung, der diese Maßnahme aufhob. Thüringen löste Bayern als Tummelplatz für die rechtsextreme Szene ab. „Nirgendwo in Deutschland fanden Hitler, die NSDAP, völkische Antisemiten, Wehrverbände und extreme Nationalisten ein besseres Betätigungsfeld“, bilanziert der Historiker Karsten Rudolph.
Im März 1925 trat Hitler erstmals in Weimar in mehreren überfüllten Versammlungen auf. Es folgten weitere Auftritte im Oktober 1925. Während seiner Aufenthalte stieg der Parteiführer am liebsten im Hotel Elephant, dem traditionsreichen Quartier am Markt, ab, wo man ihm schon früh einen roten Teppich ausrollte. Die erwiesene Gastfreundschaft war auch ein Grund für Hitler, den für Anfang Juli 1926 geplanten ersten Reichsparteitag der NSDAP nach Aufhebung des Verbots nach Weimar einzuberufen. Nach den vorausgegangenen Querelen in der völkischen Bewegung präsentierte sich die Partei hier in neuer Geschlossenheit, straff ausgerichtet auf den „Führer“ als unumstrittene Integrationsfigur. Am Nachmittag des 4. Juli durfte Hitler im Deutschen Nationaltheater sprechen – an demselben Ort also, wo Friedrich Ebert am 6. Februar 1919 die Nationalversammlung eröffnet und die Verfassunggebende Nationalversammlung getagt hatte. „An der Stelle, wo Ebert saß, sitzt und steht heute Adolf Hitler (…). Das ist der Beginn einer neuen Zeit“, rühmte der Gauleiter der NSDAP, Artur Dinter, beim „Generalappell“ von SA und SS.
Im September 1927 setzte Hitler den Autor des antisemitischen Bestsellers „Die Sünde wider das Blut“ von seinem Posten ab, weil dieser mit seiner sektiererischen Idee einer Wiederherstellung der „reinen Heilslehre“ die Kreise des Parteiführers störte. Zum Nachfolger als Gauleiter berief er den bisherigen Geschäftsführer Fritz Sauckel, der es als Hitler unbedingt ergebener Gefolgsmann noch weit bringen sollte. In der Weimarer Gauleitung begann ein unscheinbarer Funktionär als Kassierer und Buchhalter seine Karriere, die ihn zu einem der mächtigsten Männer des Dritten Reiches aufsteigen ließ: Martin Bormann.
In Weimar fand auch der junge Baldur von Schirach, ein Sohn des letzten Großherzoglichen Theaterintendanten, seinen Weg zu Hitler, auf den er Huldigungsverse verfasste und der ihn im Oktober 1931 zum Reichsjugendführer der NSDAP ernennen wird. Neben dem völkischen Literaturhistoriker und bekennenden Antisemiten Adolf Bartels und dessen Schüler Hans Severus Ziegler, seit 1925 stellvertretender Gauleiter, war es Schirach, der Hitler Zugang zu konservativ-großbürgerlichen Kreisen Weimars verschaffte. „Ich liebe nun einmal Weimar“, äußerte der Parteiführer im Jahr 1928. „Ich brauche Weimar, wie ich Bayreuth brauche. Und es wird der Tag kommen, da ich dieser Stadt und ihrem Theater noch manche Förderung zuteil werden lassen werde. Mit Weimar und Bayreuth habe ich noch viel vor.“
Die Exekutive von innen her erobern
Bei den thüringischen Landtagswahlen vom 8. Dezember 1929 errang die NSDAP 11,3 Prozent der Stimmen. (In Weimar bekam sie sogar 23,8 Prozent.) Damit übertraf sie das Ergebnis der Landtagswahlen vom Februar 1927 um mehr als das Dreifache. Der Erfolg kam nicht von ungefähr. Die Partei hatte unter Sauckels Führung einen schlagkräftigen Apparat aufgebaut und mit einem aggressiven Wahlkampf ihre Agitation bis in die kleinen ländlichen Gemeinden Thüringens hineingetragen. Ihr Zuwachs ging vor allem auf Kosten der bürgerlichen Parteien – ein Symptom für Verschiebungen im Wählerverhalten, mit denen sich bereits der kommende Erdrutsch bei der Reichstagswahl vom 14. September 1930 ankündigte. Obwohl die NSDAP nur sechs Landtagssitze errungen hatte, befand sie sich doch in einer Schlüsselposition. Denn wie schon 1924 fehlte den bürgerlichen Parteien der Mitte und der Rechten eine Mehrheit. Ihren 23 Mandaten standen 24 Mandate der SPD (18) und der KPD (6) gegenüber. Da sie eine Koalition mit den Sozialdemokraten ausgeschlossen hatten, waren sie also, um eine Regierung bilden zu können, auf die Unterstützung der sechs nationalsozialistischen Abgeordneten angewiesen. Mit einer bloßen Tolerierung wollte Hitler es diesmal nicht bewenden lassen; vielmehr strebte er von Anfang an die direkte Beteiligung an der Regierung an.
Über seine Motive hat sich Hitler mit einer für ihn ganz ungewohnten Offenheit in einem Brief an einen in Übersee lebenden Anhänger der NS-Bewegung vom 2. Februar 1930 ausgelassen. Darin konstatierte er einen „großen Umschwung“ in der öffentlichen Wahrnehmung der NSDAP. Es sei „staunenswert, wie sich hier die vor wenigen Jahren noch selbstverständliche arrogante, hochnäsige oder dumme Ablehnung der Partei in eine erwartungsvolle Hoffnung verwandelt“ habe. Diese Hoffnung aber würde man enttäuschen, wenn man bei einem prinzipiellen Nein zur Regierungsbeteiligung bliebe. Seine Bereitschaft, sich aktiv in die Koalitionsverhandlungen einzuschalten, verband Hitler mit der Forderung nach zwei Schlüsselressorts, dem Innen- und dem Volksbildungsministerium: „Dem Innenministerium untersteht die gesamte Verwaltung, das Personalreferat, also Ein- und Absetzung aller Beamten sowie die Polizei. Dem Volksbildungsministerium untersteht das gesamte Schulwesen, angefangen von der Volksschule bis zur Universität in Jena sowie das Theaterwesen. Wer diese beiden Ministerien besitzt und rücksichtslos und beharrlich seine Macht in ihnen ausnutzt, kann Außerordentliches (be)wirken.“
Es ging Hitler also nicht nur um die bloße Regierungsbeteiligung, sondern darum, die Exekutive von innen her zu erobern. „Da werden wir die erste Probe aufs Exempel liefern“, prophezeite der Berliner Gauleiter Joseph Goebbels am 8. Januar 1930. Als Kandidat für die Übernahme des Doppelministeriums könne, so Hitler weiter, „nur ein durchgekochter (!) Nationalsozialist von ebenso großer Fachkenntnis wie bedingungsloser nationalsozialistischer Gesinnung“ infrage kommen. In seinem frühen Parteigänger, dem ehemaligen Leiter der politischen Abteilung in der Münchner Polizeidirektion und amtierenden Vorsitzenden der NSDAP-Reichstagsfraktion, Wilhelm Frick, glaubte Hitler die geeignete Persönlichkeit gefunden zu haben: „Ein energischer, kühner und verantwortungsfreudiger Beamter von außerordentlich großem Können und fanatischer Nationalsozialist!“
Der Vorschlag, den wegen Hochverrats rechtskräftig verurteilten Teilnehmer am Putsch von 1923 zum Minister zu ernennen, wurde von der DVP als unzumutbar zurückgewiesen. „So fuhr ich denn selbst nach Weimar“, berichtete Hitler in dem Brief vom 2. Februar, „und habe den Herren ganz kurz in aller Bestimmtheit versichert, dass entweder Dr. Frick unser Minister wird oder Neuwahlen kommen.“ Neuwahlen aber waren das Letzte, was sich die bürgerlichen Parteien wünschen konnten, weil sie zu einer weiteren Stärkung der NSDAP führen würden. Hitler setzte den bürgerlichen Parteien eine Frist von drei Tagen, andernfalls werde er einen Antrag auf Auflösung des Landtags stellen lassen. Noch sträubte sich die DVP.
Hitler befand sich jedoch in einer starken Verhandlungsposition und sie wurde noch gestärkt durch einen Vortrag, den er am 10. Januar vor führenden Vertretern der thüringischen Wirtschafts- und Industrieverbände hielt und der offensichtlich einen großen Eindruck machte. „Abends spricht Hitler in geschlossenem Kreis. Vor 150 Großkopfeten. Es stinkt nach Vornehmheit. Hitler spricht fabelhaft. So hörte ich ihn selten“, zeigte sich Goebbels hochzufrieden. Auch aus Kreisen der Wirtschaft wurde nun starker Druck auf die DVP ausgeübt, und mit Ablauf des Ultimatums gab sie ihren Widerstand auf. Am 23. Januar 1930 wurde, wie eingangs geschildert, die Koalitionsregierung gewählt. „Frick ist nun Minister in Weimar. Das war eine schwere Geburt“, hielt Goebbels in seinem Tagebuch fest. Fricks Parteigenosse Wilhelm Marschler wurde zum Staatsrat ernannt und war in dieser Position berechtigt, an allen Abstimmungen im Kabinett teilzunehmen. In der DVP fehlte es nicht an warnenden Stimmen. „Es tut mir in der Seele weh, dass ich euch in der Gesellschaft seh’“, rief der DVP-Reichstagsabgeordnete Siegfried von Kardorff auf dem Mannheimer Parteitag im März 1930 den Delegierten aus Thüringen zu. Dass sich die DVP dort überhaupt auf Verhandlungen mit der NSDAP eingelassen hatte, zeigt, wie weit die Partei seit dem Tod Stresemanns unter seinem Nachfolger Ernst Scholz nach rechts abgedriftet war. Auf Landesebene mit den Nationalsozialisten gemeinsame Sache zu machen, während man zur gleichen Zeit auf Reichsebene noch in eine Große Koalition mit den Sozialdemokraten eingebunden war – das war ein Widerspruch in sich. Insofern warf das thüringische Experiment auch bereits einen Schatten auf das nahe Ende der Regierung Hermann Müllers.
Die „Säuberung“ der Beamtenschaft
Minister Frick enttäuschte die in ihn gesetzten Erwartungen nicht. Zwei Aufgaben hatte Hitler dem Parteifreund gestellt: Als Innenminister sollte er „eine langsame Säuberung des Verwaltungs- und Beamtenkörpers von den roten Revolutionserscheinungen vornehmen“. Vor allem auf dem Gebiet des Polizeiwesens gebe es „sehr viel zu tun“. Und als Volksbildungsminister sollte er die „Nationalisierung des Schulwesens“ vorantreiben: „Wir werden ebenso sehr den Lehrkörper von den marxistisch-demokratischen Erscheinungen säubern wie umgekehrt den Lehrplan unseren nationalsozialistischen Tendenzen und Gedanken anpassen.“
Mit großer Energie machte sich Frick ans Werk, um die Verhältnisse in Thüringen in diesem Sinne umzukrempeln. Gleich in seiner Antrittsrede vor den Beamten seiner beiden Ministerien machte er deutlich, dass nun ein „neuer Geist“ in Weimar einziehen werde, der sich grundsätzlich vom „landesverräterischen Novembergeist“ unterscheiden solle. Am 18. März 1930 brachte er im Landtag den Entwurf eines Ermächtigungsgesetzes ein, das die Landesregierung für ein halbes Jahr weitgehend unabhängig von der parlamentarischen Kontrolle machen sollte. Das Gesetz wurde am 29. März mit einfacher Mehrheit (28 gegen 25 Stimmen) im Landtag angenommen. Unter dem Deckmantel einer Reform und Verschlankung der Verwaltung wurden republiktreue Beamte entlassen und durch Gefolgsleute der NSDAP ersetzt. Allerdings sah die Reichsregierung dem Treiben Fricks nicht tatenlos zu. Bereits am 18. März 1930 hatte der sozialdemokratische Innenminister Carl Severing der Landesregierung mitgeteilt, ihm seien Nachrichten zugegangen, „die begründete Zweifel darüber erwecken, ob die Voraussetzungen für die Gewährung eines Reichszuschusses für Polizeizwecke“ noch erfüllt seien. Gegen die Sperrung der Reichsgelder legte Ministerpräsident Erwin Baum vom Thüringischen Landbund „feierlich Verwahrung“ ein. Der seit dem 30. März 1930 amtierende neue Innenminister Joseph Wirth von der Zentrumspartei verständigte sich zwar im April mit der thüringischen Landesregierung über eine Aufhebung der Sperre des Reichszuschusses, ohne in der grundsätzlichen Frage, ob Nationalsozialisten in die Polizei eingestellt werden dürften, eine Einigung erzielt zu haben. Frick schuf vollendete Tatsachen, indem er die Ämter der Polizeidirektionen von Weimar und Gera mit seinen Vertrauensleuten besetzte. Als Wirth daraufhin im Juni 1930 erneut die Polizeigelder sperren ließ, reichte Ministerpräsident Baum Klage beim Staatsgerichtshof in Leipzig ein. Der Konflikt zwischen Thüringen und dem Reich wurde im Dezember 1930 mit einem Vergleich beigelegt. Thüringen verpflichtete sich, das „unpolitische Verhalten der einzelnen Beamten im Dienst unbedingt“ zu gewährleisten; das Reich musste die Sperre der Polizeikostenzuschüsse aufheben.
Ungeachtet aller Einsprüche aus Berlin setzte Frick seine Politik der „Säuberung“ der Beamtenschaft unbeirrt fort. Goebbels, der ihn Anfang Juni 1930 in Weimar aufsuchte, war beeindruckt: „Er ist guten Mutes, hat eine Mordscourage, provoziert und ist frech gegen die Bonzen in Berlin. In der Tat, ein deutscher Minister.“ Vom Abbau des Personals im öffentlichen Dienst, zu dem auch das Land Thüringen aufgrund der prekären Finanzlage gezwungen war, wurden vor allem Beamte betroffen, die der SPD angehörten oder ihr nahestanden. In das Volksbildungsministerium berief Frick drei seiner Parteigenossen als „Fachberater“, unter ihnen den stellvertretenden Gauleiter Hans Severus Ziegler. Sie übten eine Art Nebenregierung aus, hatten Zugang zu Personalakten, die sie nutzten, um unliebsame Lehrer anzuschwärzen. In die thüringischen Behörden zog ein Geist des allgegenwärtigen Verdachts und der Denunziation ein.
Parallel zu den administrativen und personellen Maßnahmen machte sich Frick daran, in der Kulturpolitik des Landes eine radikale Wende einzuleiten. Am 16. April 1930 wurde im Amtsblatt des Volksbildungsministeriums ein Erlass veröffentlicht, der die Wiedereinführung von Schulgebeten zur Pflicht machte. Zur Begründung hieß es, dass „art- und volksfremde Kräfte“ schon seit langem versuchten, „die geistig-sittlich-religiösen Grundlagen unseres deutschen Denkens und Fühlens zu zerstören, um das deutsche Volk zu entwurzeln und es so leichter beherrschen zu können“. Diesen verderblichen Einflüssen könne das deutsche Volk nur Widerstand leisten, „wenn es die religiös-sittlichen Triebkräfte seines Wesens sich rein bewahrt und sie der heranwachsenden Jugend überliefert“. Drei der vorgeschlagenen Gebete richteten sich eindeutig gegen die demokratische Verfassungsordnung von Weimar und atmeten den Geist völkisch-nationalistischer Unversöhnlichkeit. So lautete ein Gebet: „Vater, in deiner allmächtigen Hand / Steht unser Volk und Vaterland. / Du warst der Ahnen Stärke und Ehr’, / Bist unser ständige Waffe und Wehr. / Drum mach’ uns frei von Betrug und Verrat. / Mache uns stark zu befreiender Tat. / Schenk’ uns des Heilandes heldischen Mut, / Ehre und Freiheit sei höchstes Gut! / Unser Gelübde und Losung sei: / Deutschland, erwache! Herr, mach’ uns frei! / Das walte Gott!“
„Deutschland erwache“ – unter diesem Schlachtruf der Nationalsozialisten sollte den Schülerinnen und Schülern nationalpolitische Gesinnung eingetrichtert werden. Wer mit den „art- und volksfremden Kräften“ gemeint war, daran ließ Frick im Mai 1930 im Landtag keinen Zweifel. Die „Freiheitsgebete“, so erklärte er, sollten der „Abwehr des Betruges“ dienen, der „durch den Marxismus und die Juden am deutschen Volk begangen“ worden sei. Unter den Koalitionspartnern erhob sich kaum Widerspruch, und auch die Proteste des Thüringer Lehrervereins und der evangelischen Landeskirche hielten sich in Grenzen. Ein Antrag der SPD-Landtagsfraktion, den Erlass zurückzunehmen, wurde von den Parteien der Regierungskoalition zurückgewiesen. Eine Klage vor dem Leipziger Staatsgerichtshof bescherte Frick allerdings eine Niederlage. In seinem Urteil vom 11. Juli 1930 wurden drei der besonders anstößigen Gebetstexte verworfen, weil sie die „Empfindungen Andersdenkender“ verletzten und damit gegen Artikel 148, Absatz 2 der Reichsverfassung verstießen.
Die nationalsozialistische Politisierung der Kultur
Noch vor der Einführung der Schulgebete hatte Frick im Februar 1930 eine Verfügung gegen Erich Maria Remarques Roman „Im Westen nichts Neues“ erlassen. Das Antikriegsbuch war im Frühjahr 1929 erschienen und rasch zu einem Bestseller avanciert. Nun wurden die Schulräte in Thüringen angewiesen, darüber zu berichten, an welchen Schulen das Buch angeschafft worden war und welche Lehrer es im Unterricht benutzt hatten. Eine weitere Verwendung als Klassenlektüre wurde generell untersagt. Diese Bestimmungen deckten sich mit den Bestrebungen des „Kampfbundes für deutsche Kultur“, der im August 1927 unter Leitung des Chefideologen der NSDAP, Alfred Rosenberg, gegründet worden war. Auf seiner Pfingsttagung in Weimar 1930, die unter der Schirmherrschaft Fricks stand, wurde unter anderem gefordert, dass der „deutsche Wehrwille gestählt“ werden müsse. Remarques Erfolgsbuch war in den Augen der NS-Kulturwächter geeignet, eben diesen „Wehrwillen“ zu beeinträchtigen. Das galt auch für die Filmversion des Romans. Gegen den Streifen, der im Dezember 1930 in Berlin Premiere hatte, lief die NSDAP unter Anleitung von Gauleiter Goebbels Sturm. Schließlich verhängte die Oberste Filmprüfstelle am 1. Dezember ein Aufführungsverbot – eine Kapitulation vor dem SA-Terror. „Die n. s. Straße diktiert der Regierung ihr Handeln“, triumphierte Hitlers Mann für die Propaganda.
Der nächste schwerwiegende Eingriff Fricks in das Kulturleben folgte Anfang April 1930 mit dem Erlass „Wider die Negerkultur für deutsches Volkstum“. Seit Jahren, hieß es darin, würden sich „fast auf allen kulturellen Gebieten in steigendem Maße fremdrassige Einflüsse geltend“ machen, die geeignet seien, „die sittlichen Kräfte des deutschen Volkstums zu unterwühlen“. Es läge „im Interesse der Erhaltung und Erstarkung des deutschen Volkstums“, alle Erzeugnisse, die eine „Verherrlichung des Negertums“ darstellten, als „Zersetzungserscheinungen nach Möglichkeit zu unterbinden“. Gegen Schauspielunternehmen, die „weder in sittlicher noch artistischer Beziehung als zuverlässig“ angesehen werden könnten, sollten die Behörden einschreiten, wobei der „strengste Maßstab“ anzulegen sei. Dieser Erlass bot die Handhabe für zahlreiche Verbote. So wurde die Aufführung von Friedrich Wolfs Abtreibungsdrama „Cyankali“, das Erwin Piscators Berliner Ensemble in Gera und Jena aufführen wollte, untersagt. Die Stücke von Ernst Toller und Walter Hasenclever verschwanden aus dem Repertoire der staatlichen Theater.
Am 22. Mai 1930 rechnete der SPD-Abgeordnete Max Greil, der vor 1924 Volksbildungsminister gewesen war, im thüringischen Landtag mit Frick ab. Diesem ginge es darum, alle Bereiche des Kulturlebens „im parteipolitischen nationalsozialistischen Sinne“ zu politisieren. Sein „Ukas gegen die Negerkultur“ richte sich in Wahrheit gegen die Juden, und das solle Frick auch öffentlich bekennen. Mit dem „klassischen Geist des Weltbürgertums im Sinne Goethes“ habe das alles nichts mehr zu tun. „Es ist der Geist nationalistischer Engherzigkeit, es ist der Geist chauvinistischer Kriegshetzerei.“
In seinem berüchtigten Erlass hatte Frick bekanntgegeben, dass er den Architekten Paul Schultze-Naumburg zum neuen Leiter der Vereinigten Kunstlehranstalten in Weimar bestellt habe und diese zu einem „Mittelpunkt deutscher Kultur“ ausgebaut werden sollten. Schultze-Naumburg, den Frick auch als einen „Kunstberater“ angeheuert hatte, hatte sich als ein vehementer Gegner des Bauhauses und Verfechter einer „rassetüchtigen“ deutschen Kultur einen Namen gemacht. Sein Haus in Saaleck bei Bad Kösen, unterhalb der Burgruine gelegen, war ein beliebter Treffpunkt völkisch-rechtsextremer Kreise. Im Juni 1930 war auch Goebbels in Begleitung von Frick und Walter Darré, dem NS-Agrarideologen, dort zu Gast. „Das Schultze-Haus liegt wundervoll über der Saale, herrlich in die Landschaft hineinkomponiert, ein wahrer Edelsitz (…). Ich sah noch nie ein so stilvolles Haus“, zeigte er sich angetan. Der Berliner Gauleiter ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, dem Grab der Rathenau-Mörder einen Besuch abzustatten.
In seiner Rede zur Einweihung der neugestalteten Vereinigten Kunstlehranstalten am 10. November 1930 geißelte Schultze-Naumburg die moderne Kunst, die „nur noch aus verbogenen und verkrampften Zerrbildern“ bestünde und „die Bildhaftmachung der geistigen und körperlichen Minderwertigkeit“ zum Ziel habe. Mit der deutschen Jugend sei er einig in der Absicht, „alle jene Volksverderber und Volksverräter aus dem deutschen Hause zu jagen, in dem sie nichts zu suchen haben“.
Es blieb nicht nur bei Worten. Im Oktober ließ Schultze-Naumburg im Van de Velde-Bau die Wandfresken des Bauhausmeisters Oskar Schlemmer übermalen. Anfang November wurden auf Geheiß Fricks aus den Ausstellungsräumen des Weimarer Schlossmuseums 70 Werke moderner Künstler entfernt, darunter Gemälde und Zeichnungen von Otto Dix, Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky und Paul Klee. Der Volksbildungsminister rechtfertigte die Aktion, die bereits die Kampagne gegen „Entartete Kunst“ des Jahres 1937 vorwegnahm, damit, dass die verfemten Werke „nichts gemeinsam mit nordisch-deutschem Wesen“ hätten und sich darauf beschränkten, „das ostische und sonstige minderrassige Untermenschentum darzustellen“. Widerstand gegen den Weimarer „Bildersturm“ regte sich kaum. In der liberalen Hauptstadtpresse aber wurde er gebrandmarkt als das, was er war: „ein Skandal in einem Kulturstaat“ – so das „Berliner Tageblatt“.
Übertroffen wurde dieser Skandal noch durch den dreistesten Coup Fricks: die Berufung des Rassentheoretikers Hans F. K. Günther als Professor an die Universität Jena. Auch damit erfüllte er die Erwartungen Hitlers, der in seinem Brief vom 2. Februar 1930 als „ersten Schritt“ der angestrebten „geistigen Umwälzung“ die „Errichtung eines Lehrstuhls für Rassefragen und Rassekunde“ in Jena ins Auge gefasst und für die Besetzung ebenjenen Günther, den Autor einer „Rassenkunde des deutschen Volkes“, in Vorschlag gebracht hatte. Als sich der Rektor, der Kirchenhistoriker Karl Heussi, dem Verlangen Fricks widersetzte, begehrte der von den nationalsozialistischen Studenten bereits beherrschte AStA gegen die Leitung der Universität auf. Dafür, dass sie „mehr Verständnis für die Schaffung notwendiger Voraussetzungen zu Deutschlands Erneuerung“ aufgebracht habe als die Professoren, wurde die Jenaer Studentenschaft von Frick ausdrücklich belobigt. Das einzige Zugeständnis an den Lehrkörper der Universität war, dass die ursprüngliche Bezeichnung – „Lehrstuhl für menschliche Züchtungskunde“ – in „Lehrstuhl für Sozialanthropologie“ umgewandelt wurde. Hitler ließ es sich nicht nehmen, am 15. November 1930 zur Antrittsvorlesung Günthers zu erscheinen, die dem Thema „Die Ursachen des Rassenverfalls des deutschen Volkes seit der Völkerwanderungszeit“ gewidmet war.
Vorgeschmack auf die Machtübernahme
Am 1. April 1931 fand Fricks Regierungszeit in Thüringen ein jähes Ende. Die DVP-Fraktion schloss sich einem von den Sozialdemokraten und Kommunisten eingebrachten Misstrauensantrag an. Den Ausschlag für den Koalitionsbruch gaben nicht Fricks Maßnahmen als Minister, sondern beleidigende Äußerungen des Gauleiters Sauckel in einem Leitartikel der Parteizeitung „Der Nationalsozialist“. Darin hatte er die Vertreter der DVP als „trottelhafte Greise, Verräter und Betrüger“ beschimpft, „die mit ihrer bodenlosen Unverschämtheit mit dem Schicksal unseres Volkes ihr frevelhaftes Spiel treiben“. Das war selbst für die Partei, die monatelang alle Provokationen Fricks geduldig ertragen hatte, zu viel. Hitler war, wie die Presse berichtete, noch am Vortag nach Weimar gereist, um die DVP umzustimmen, konnte aber nichts mehr ausrichten. In der Debatte über den Misstrauensantrag am 1. April bezeichnete der Abgeordnete der DDP, Philipp Kallenbach, die Ergebnisse der vierzehnmonatigen Regierungstätigkeit Fricks als „geradezu verheerend“: „Die Befriedung des Landes ist zerstört. Agitations- und Demonstrationslust, ja selbst Hass und Einseitigkeit gegen weite Volksschichten waren die Triebkräfte der Verwaltungsmaßnahmen. Alle Gebiete des öffentlichen Lebens sind, soweit es in der kurzen Zeit möglich war, im parteipolitischen Sinn der NSDAP politisiert. (…) Als Mittel zum Zweck diente eine rücksichtslose Personalpolitik, eine Futterkrippenpolitik, die offen und zugestandenermaßen wie noch nie betrieben wurde.“
Erst nach Fricks Rücktritt, im Vorfeld der Reichspräsidentenwahl vom Frühjahr 1932, wurde bekannt, dass der Innen- und Volksbildungsminister insgeheim versucht hatte, Hitler die deutsche Staatsbürgerschaft zu verschaffen. Die Affäre erregte, als sie Anfang Februar 1932 ruchbar wurde, großes Aufsehen. In Weimar wurde ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss unter Vorsitz des SPD-Politikers Hermann Brill eingesetzt, der die Angelegenheit aufklären sollte. Auch Hitler und Frick wurden als Zeugen geladen. Danach ergab sich folgendes Bild: Im Sommer 1930, während Regierungschef Baum im Urlaub war, hatte Frick die Vorbereitungen für eine Einbürgerung Hitlers getroffen, indem er ihn zum Gendarmeriekommissar in Hildburghausen ernennen, aber gleichzeitig von allen Verpflichtungen als Beamter freistellen wollte. Zwei Ministerialbeamte wurden unter „strengster Amtsverschwiegenheit“ verpflichtet, die entsprechenden Formalitäten in die Wege zu leiten. Auf dem Gautag in Gera am 12. Juli 1930 hatte Frick Hitler die Ernennungsurkunde überreicht, und dieser hatte den Empfang mit seiner Unterschrift bestätigt. Danach aber kamen dem Parteiführer offenbar Bedenken, ob der Titel eines Gendarmeriekommissars ihn in der Öffentlichkeit nicht der Lächerlichkeit aussetzen würde. Jedenfalls zerriss er einige Tage später in München die Urkunde. Im Untersuchungsausschuss sagte er aus, er habe von vornherein die Ernennung nicht annehmen wollen.
Die Groteske um Hitlers Einbürgerungsversuch von 1930 war Tagesgespräch. „Tolle Pressehetze […]. Verrückte Karikaturen“, ärgerte sich Goebbels. Es war die Rede von einer „Köpenickiade“, einem „Schildbürgerstreich“, aus Hildburghausen wurde „Schildburghausen“. Dabei entbehrte das Ganze nicht eines ernsten Hintergrunds, worauf die „Vossische Zeitung“ in einem Leitartikel aufmerksam machte: Mit seiner „missglückten Schiebung“ habe Frick abermals bewiesen, dass die Nationalsozialisten nicht gewillt seien, sich an gesetzliche Vorschriften zu halten. „Es wäre gut, wenn der wahre Charakter der Partei endlich auch außerhalb Bayerns, wo man die Dinge aus der Nähe miterlebt hat, erkannt wird.“ In Thüringen blieb diese Mahnung ungehört. Bei den Landtagswahlen von Ende Juli 1932 sollte die NSDAP mit 42,5 Prozent der Stimmen stärkste Partei werden und mit Fritz Sauckel den Ministerpräsidenten stellen.
Rückblickend hat Hermann Brill die „Ära Frick“ in Thüringen als „eines der wichtigsten Vorpostengefechte in der großen Schlacht zwischen Demokratie und Diktatur“ bezeichnet. In der Tat: Während seiner Amtszeit hatte Frick einen Vorgeschmack dessen geliefert, was von einer Machtübernahme der Nationalsozialisten zu erwarten war. Für vierzehn Monate hatte Thüringen als ein Experimentierfeld gedient, auf dem sie die Maßnahmen erproben konnten, die sie in noch weit größerem Umfang drei Jahre später auf Reichsebene umsetzen sollten.
Hitler dankte Frick in einem persönlich gehaltenen Schreiben vom 2. April 1931 dafür, dass es ihm gelungen sei, „Thüringen in den Mittelpunkt der nationalen, politischen und wirtschaftlichen Sanierung Deutschlands zu rücken“: „Wir alle glauben felsenfest an die Stunde, die Sie wieder – und dieses Mal dann für immer – zum Dienst an unserem Volk in verantwortungsreicher Stelle aufrufen wird.“ Tatsächlich sollte Frick im „Kabinett der nationalen Konzentration“ vom 30. Januar 1933 mit dem Posten des Innenministers belohnt und damit an eine der wichtigsten Schaltstellen der Macht gesetzt werden.
Der Text beruht auf dem jüngsten Buch des Autors „Schicksalsstunden einer Demokratie – das aufhaltsame Scheitern der Weimarer Republik“, das gerade beim Verlag C.H.Beck erschienen ist. Dort finden sich auch ausführliche Quellennachweise.