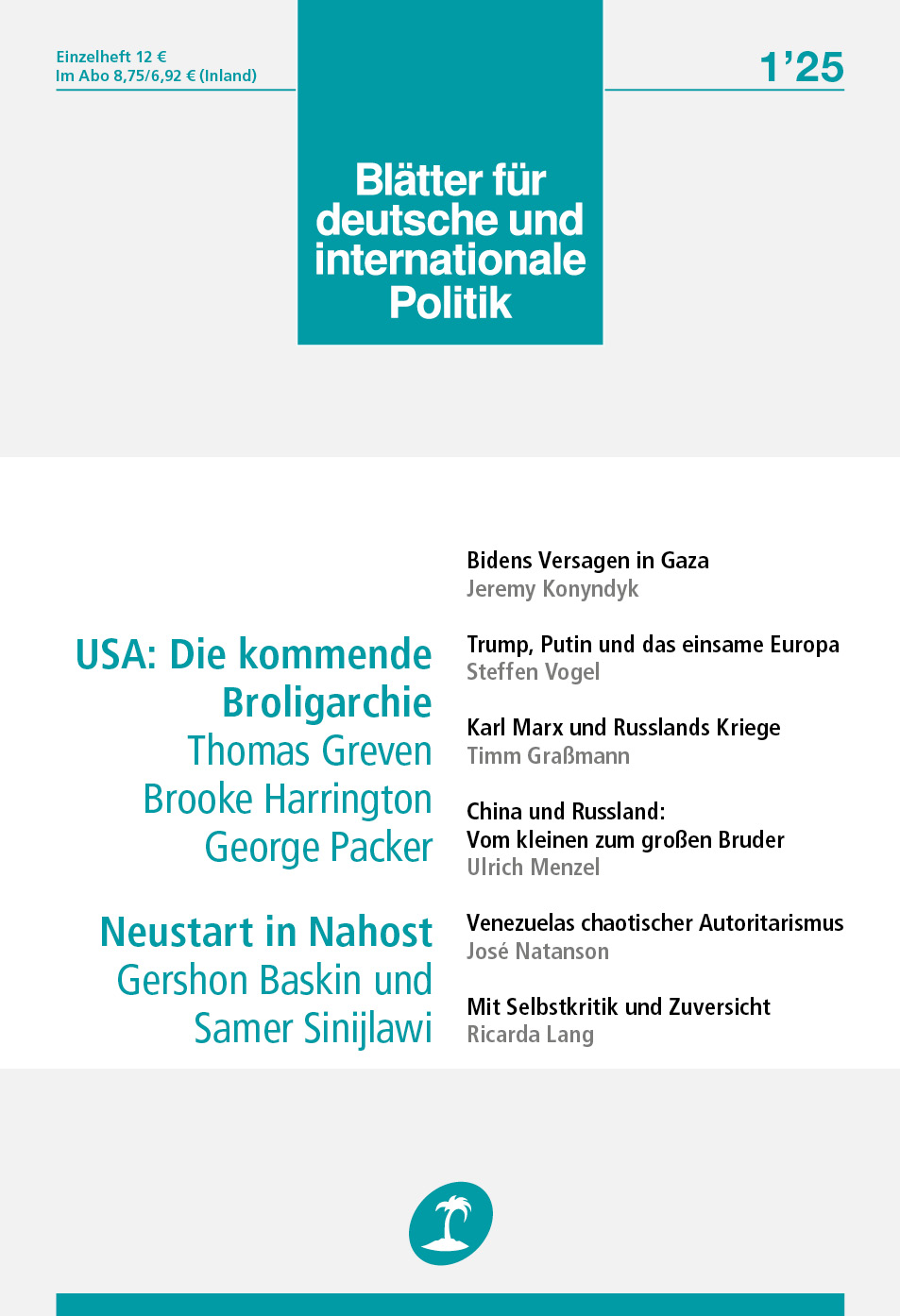Bild: Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro, 7.11.2024 (IMAGO / ITAR-TASS / Alexander Kryazhev)
Ausgerechnet jene Wahlen, die für eine demokratische Normalisierung Venezuelas stehen sollten, entpuppten sich als Beginn eines neuerlichen Abstiegs in den Abgrund der politischen Krise und des sozialen Konflikts. Bereits kurz nachdem der Leiter des Nationalen Wahlrats (CNE), Elvis Amoroso, am 28. Juli den Sieg Nicolás Maduros über den Kandidaten der Opposition, Edmundo González Urrutia, mit 51,2 Prozent der Stimmen und nur sechs Punkten Vorsprung verkündet hatte, wurde offenkundig, dass die Regierung Wahlbetrug begangen hatte. Anders als bei allen vorangegangenen Präsidentschaftswahlen stellte der Wahlrat dieses Mal nicht nach Wahllokalen, Abstimmungszentren und Wahlurnen aufgeschlüsselte Daten und Protokolle zur Verfügung, um die offiziellen Angaben mit jenen der Wahlbeobachter der Opposition abgleichen zu können. Bis heute ist auch nicht bekannt, welche Kandidaten in den einzelnen Bundesstaaten und Städten Venezuelas gewonnen haben.
Die wichtigste Oppositionskoalition, die Plataforma Unitaria Democrática, veröffentlichte angesichts dessen von ihren Wahlbeobachtern aufgenommene Fotos der Wahlprotokolle im Internet. Insgesamt konnte sie so 83 Prozent der abgegebenen Stimmen dokumentieren. Ihre Auszählung ergab einen Sieg von 67 Prozent für den Oppositionskandidaten gegenüber 30 Prozent für Maduro, was in etwa dem entspricht, was in den Umfragen vorhergesagt worden war. Auch die beiden unabhängigen internationalen Wahlbeobachtermissionen, das UN-Expertengremium und das Carter Center, versicherten, dass die Wahlen nicht fair gewesen seien. Der venezolanische Vertreter des Carter Centers, das die Regierung in Caracas selbst beauftragt hatte, erklärte später, dass der Kandidat der Opposition der Gewinner sei. Doch weder die in der Folge von der Opposition ausgerufenen Demonstrationen noch die internationalen Proteste oder die Tatsache, dass selbst verbündete linke Regierungen wie die Brasiliens und Kolumbiens sich weigern, die Ergebnisse anzuerkennen, werden Maduro daran hindern, am 10. Januar 2025 seine dritte Amtszeit als Präsident anzutreten. Vielmehr hat sich die venezolanische Regierung angesichts des großen internen und externen Drucks durch den von ihr kontrollierten Obersten Gerichtshof bestätigten lassen, dass die Wahlen korrekt abgelaufen seien und Maduro der rechtmäßige Präsident Venezuelas sei.
Schon die Bedingungen, unter denen die Wahlen vom 28. Juli stattfanden, können bestenfalls als semi-kompetitiv bezeichnet werden. Die ursprüngliche Spitzenkandidatin der Opposition, María Corina Machado, wurde disqualifiziert. Als sie versuchte, eine Ersatzkandidatin zu nominieren, eine 70-jährige Philosophin, die noch nie ein öffentliches Amt bekleidet hatte, wurde diese ebenfalls ausgeschlossen, diesmal in einem Verwaltungsverfahren ohne Begründung. In letzter Minute registrierte die Opposition González Urrutia. Doch während des Wahlkampfs wurden der Opposition alle möglichen Hindernisse in den Weg gelegt – schwerwiegende, wie die Verhaftung Dutzender Aktivisten und Organisatoren der Opposition, bis hin zu banalen, wie etwa das Verbot für Machado, sich innerhalb Venezuelas mit dem Flugzeug fortzubewegen.
Noch nie zuvor hatte die bolivarische[1] Regierung, die in ihrer langen Geschichte an der Macht alle möglichen Schandtaten begangen hat, die Ergebnisse einer nationalen Wahl gefälscht. Dieser Wahlbetrug war etwas Neues. Chávez hatte die Wahlen auf faire Weise gewonnen, 2013 setzte sich Maduro mit einem minimalen, aber nachweisbaren Vorsprung durch (trotzdem sprach die Opposition von Betrug), und 2018 brauchte er das nicht zu tun, weil die Mehrheit der Opposition beschloss, nicht zur Wahl anzutreten (da ihre wichtigsten Politiker von dieser ausgeschlossen worden waren). Mit dem Betrug vom 28. Juli hat der Chavismus nun den Druck des autoritären Korsetts, das er dem Land mindestens seit 2015 angelegt hat, ein weiteres Mal erhöht. Damals hatte die Opposition eine qualifizierte Mehrheit im Parlament gewonnen, die die Regierung durch eine Reihe von Manövern des Obersten Gerichtshofs und durch die Einberufung einer konfusen verfassungsgebenden Versammlung de facto annullierte.
Ein System der Hybridität und Zweideutigkeit
Wie also lässt sich das venezolanische Regime definieren? Am besten durch eine Kombination aus verschiedenen Elementen. Da wäre zunächst der Autoritarismus: die totale Kontrolle der Staatsgewalt, illegale Verhaftungen, die Einschränkung der Pressefreiheit, schwerste Menschenrechtsverletzungen, politische Verfolgung, Verbote, Militarisierung und, seit 2024, Wahlbetrug. Allerdings ist die Repression gegen Oppositionelle, Gewerkschafter und soziale Aktivisten selektiv. Sie betrifft nicht alle, es gibt auch keine geheimen Folterzentren wie die Mechanikerschule der Marine während der argentinischen Militärdiktatur, und es werden keine Menschen in Stadien mit Maschinengewehren erschossen wie während der Pinochet-Diktatur in Chile. Aber die Unterdrückung ist systematisch, sie erfolgt schon seit Jahren. Es handelt sich somit nicht um einen Unfall oder einen Fehler, um etwas, das einmal passiert ist, sondern um eine permanente Praxis.
Gleichzeitig lassen sich auch einige Züge eines totalitären Regimes erkennen, das sich nicht auf die Kontrolle der politischen Institutionen beschränkt, sondern in die Gesellschaft vordringt und in das Privatleben der Menschen eingreift: Dazu gehören Schikanen gegen in der Öffentlichkeit stehende Oppositionelle, die soziale Identifizierung von Dissidenten – in der berühmten Tascón-Liste wurden Bürger genannt, die das Abberufungsreferendum gegen Maduros Vorgänger Hugo Chávez von 2004 mit ihrer Unterschrift unterstützt hatten, woraufhin es zu diversen Fällen von Diskriminierung und Verfolgung im öffentlichen Dienst kam. Hinzu kommen neue Formen der biopolitischen Kontrolle, etwa durch das „Carnet de la Patria“ – einem offiziell freiwilligen staatlichen Ausweis, ohne den man aber bestimmte Sozialleistungen nicht erhält und dessen Daten in einer aus China importierten Software zentralisiert werden. Diese ermöglicht es, die politischen Präferenzen der Menschen mit dem Zugang zu Unterstützungsleistungen zu verknüpfen. Und schließlich ist da die als „Sippenhaft“ bekannte und unter anderem in Ostdeutschland praktizierte Methode, die darin besteht, die Angehörigen von flüchtigen Gegnern zu schikanieren, um sie emotional zu brechen, damit sie den Aufenthaltsort der Verfolgten verraten. So wurde die Schwester eines venezolanischen Militärs, der beschuldigt wurde, sich gegen die Regierung verschworen zu haben, in ihrem Haus verhaftet und acht Tage lang festgehalten, wobei man ihr ein Foto ihres fünfjährigen Sohnes zeigte und ihr drohte, diesem den Finger abzuschneiden, wenn sie nicht gestehe, wo ihr Bruder sei (es gibt mehrere ähnliche Fälle).
Die engen Grenzen der Freiheit
Dennoch handelt es sich bei Venezuela nicht um ein totales Polizeiregime mit Konzentrationslagern und Gestapo. Man kann auf der Terrasse einer Bar ein Bier mit einer Gruppe von Akademikern und NGO-Mitarbeitern trinken, die über Maduro lachen und die Regierung lautstark infrage stellen, ohne große Angst haben zu müssen. Anders als in Gesellschaften, die lange Diktaturen erlebt haben, in denen die Menschen instinktiv ihre Stimme senken, wenn sie den Präsidenten infrage stellen, wird in Venezuela Kritik nicht gemurmelt, sondern geschrien. Gleichzeitig hüten sich viele davor, dieselbe Kritik in WhatsApp-Gruppen zu äußern, da es Fälle gab, in denen Inhaftierten abgehörte Gespräche oder Chats gezeigt wurden. Unter Venezolanern ist es üblich, Nachrichten alle ein bis zwei Wochen zu löschen, denn es kann vorkommen, dass die Polizei dich bei einer zufälligen Kontrolle nach dem Telefon fragt, dich zwingt, es zu entsperren, und anfängt, zu lesen.
Es gibt aber auch weiterhin Freiräume, wenngleich in engen Grenzen. Venezuela, das muss man betonen, ist keine klassische Diktatur mit Panzern, die in Regierungsgebäude eindringen, und der fulminanten Aufhebung der öffentlichen Gewalt. Es ist auch nicht Nicaragua. Heute gibt es drei oppositionelle Gouverneure und etwa 100 oppositionelle Bürgermeister. Die großen Medien wurden geschlossen oder haben sich mit dem Chavismo verbündet, wie der Fernsehsender „Globovisión“, der den Putsch gegen Chávez unterstützt hatte und später von regierungsnahen Geschäftsleuten übernommen wurde, oder „Últimas Noticias“, eine der wenigen gedruckten Zeitungen, die noch im Umlauf sind. Einige digitale Medien wie „Efecto Cocuyo“, die kolumbianische Tageszeitung „El Tiempo“ oder die argentinische „Infobae“ sind blockiert – um auf sie zuzugreifen, muss man einen VPN-Tunnel benutzen, etwas, das alle Venezolaner gelernt haben zu tun. Im Jahr 2023 wurde „Simón“, ein Film über einen studentischen Aktivisten, der während der Proteste 2017 verhaftet und gefoltert wurde, mit großem Erfolg in den Kinos des Landes gezeigt. Anders als in Ländern wie China sind die sozialen Medien zugelassen; Twitter (heute X) ist in Venezuela gar zur wichtigsten öffentlichen Plattform avanciert.
Venezuela ist aber auch keine Demokratie, das Land hat vielmehr einen Prozess der Entdemokratisierung durchlaufen.[2] Es handelt sich um ein System, das in verschiedenen Anläufen errichtet wurde und nicht das Produkt eines revolutionären Fahrplans ist, wie die Sozialismen der Sowjetunion, Chinas und – mit seinen Höhen und Tiefen – Kubas; es ist ein Apparat, der sich öffnet und schließt, der demokratischere und autoritärere Momente beinhaltet, der plastisch ist und ständig mit Hybridität und dem Rückgriff auf eine zynische Zweideutigkeit spielt: Ich nenne es „chaotischen Autoritarismus“.
Chaos als Bedingung politischer Stabilität
Es ist ein System, in dem der autoritäre Wille der Regierung mit der Zerbrechlichkeit des Staates und der Schwäche seiner Bürokratie, seiner Ineffizienz und Korruption kollidiert. In Venezuela ist der Staat nicht dazu in der Lage, die Kontrolle über die gesamte Bevölkerung oder das gesamte Staatsgebiet auszuüben, so dass sich der Autoritarismus mit einer Tendenz des Laissez-faire im Bereich der Wirtschaftskriminalität vermischt, aber auch mit einer Politik, bestimmte Zonen privaten Gewaltakteuren zu überlassen, deren paradigmatischstes Beispiel die Selbstverwaltung des Strafvollzugs durch kriminelle Organisationen ist. Chaotischer Autoritarismus bedeutet, dass es keine perfekte Befehlskette gibt, die einen kohärenten Plan umsetzt, keine zentrale Behörde, die in der Lage ist, das Geschehen vertikal zu kontrollieren. Aus diesem Grund ist das Chaos weder ein Unfall noch ein unerwünschtes Ergebnis, sondern vielmehr die paradoxe Bedingung der Möglichkeit politischer Stabilität und der Gültigkeit des autoritären Modells.
Die autoritäre Wende ist nur einer der Punkte des Dreiecks, aus denen sich die venezolanische Tragödie zusammensetzt. Der zweite Punkt ist die Wirtschaftskrise. Infolge einer Reihe von Politiken, die seit Beginn der Ära Chávez verfolgt wurden – darunter der ständige Anstieg des Haushaltsdefizits, die Erhöhung der Auslandsverschuldung sowie unproduktive Verstaatlichungen –, ist das BIP innerhalb von nur fünf Jahren auf ein Viertel gesunken: In der Geschichte des modernen Kapitalismus ist ein Zusammenbruch dieses Ausmaßes, ohne dass es eine Invasion oder einen Krieg gegeben hätte, nicht bekannt. Venezuela – das Land mit den größten Erdölreserven der Welt – erlitt zwei Hyperinflationen, musste seine Wirtschaft zur Hälfte dollarisieren, um seine Währung minimal zu stabilisieren, und vertrieb 7,5 Millionen Menschen, was das sichtbarste Zeichen für den dritten Punkt des Dreiecks, die soziale Katastrophe, ist. Das Land des Sozialismus des 21. Jahrhunderts ist heute eines der zwei oder drei Länder mit der größten Ungleichheit in Lateinamerika. Während Maduro die autoritäre Wende verantwortet, ist das sozioökonomische Debakel in erster Linie Chávez zuzuschreiben (wenngleich Maduro dessen Auswirkungen nun bewältigen muss).
Vom Hoffnungsträger zum Problemfall für die lateinamerikanische Linke
Für die lateinamerikanische Linke ist Venezuelas autoritäre Wende ein Problem, denn das Land war, vor allem in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts, so etwas wie ein Leuchtturm. Mit seinem frühen Triumph bei den Wahlen von 1998 wurde Chávez zur Vaterfigur für eine Reihe fortschrittlicher Präsidenten und zum intellektuellen Urheber eines Modells der Verheißung, einer Neugründung des Staates mittels einer grundlegenden Verfassungsreform, dem später Evo Morales in Bolivien und Rafael Correa in Ecuador folgen sollten (die andere Verheißung, die ab 2003 der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva repräsentierte, bot eine größere Kontinuität mit der vorherigen Phase). Ausgestattet mit einem außergewöhnlichen Charisma und einem Ehrgeiz, der dem sagenhaften Ölvorkommen seines Landes entsprach, gab Chávez einer Linken, die nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende der Sowjetunion deprimiert und von der Leere des „dritten Weges“ Tony Blairs ernüchtert war, neue Hoffnung.
Als er jedoch nach seiner Wiederwahl mit 60 Prozent der Stimmen begann, vom Sozialismus zu sprechen, auch wenn er den Zusatz „des 21. Jahrhunderts“ hinzufügte, begab er sich bereits ein Stück weit auf Abwege. Niemand glaubte Chávez so recht, doch die vernünftigeren linken Regierungen ließen ihn gewähren. Der zentrale Punkt ist, dass Venezuela in dieser Phase trotz seiner enormen institutionellen Probleme weiterhin eine Demokratie blieb: Das Foto, das die Präsidenten Chávez (Venezuela), Lula (Brasilien), Néstor Kirchner (Argentinien), Correa (Ecuador), Morales (Bolivien) und Tabaré Vázquez (Uruguay) auf der gleichen Bühne zeigte, war das Bild ein und derselben Familie, dysfunktional, aber geeint.
Dieses Bild ist zerbrochen. Die autoritäre Wende, die Nicolás Maduro 2015 einleitete, als er der Opposition die Kontrolle über die Nationalversammlung entriss, und die bei den Präsidentschaftswahlen vom 28. Juli ihre Krönung erfuhr, stellt Venezuela auf eine völlig andere Bühne. Alle südamerikanischen Länder sind trotz ihrer Schwierigkeiten nach wie vor Demokratien (auch wenn sie, wie im Falle Boliviens, durch einen Staatsstreich institutionell unterbrochen wurden). Venezuela aber ist heute nicht mehr demokratisch und reiht sich damit in den kleinen Club aus Kuba und Nicaragua ein, den beiden anderen autoritären Regimen in Lateinamerika.
Für die progressiven Kräfte ist dies schon deshalb ein Problem, weil alle drei Länder für sich in Anspruch nehmen, links zu sein, woran die Rechte jedes Mal erinnert, wenn ein Wahlkampf bevorsteht; und es ist auch deshalb ein Problem, weil keines dieser Länder große sozioökonomische Erfolge vorweisen kann: Die venezolanische Wirtschaft ist eine Katastrophe, Nicaragua verzeichnet Armutsquoten von über 80 Prozent und Kuba durchlebt die tiefste Wirtschaftskrise seit der „Sonderperiode“ (und nur im letzteren Fall ist die Situation auf die US-Blockade zurückzuführen).[3] Das ökonomische Scheitern dieser drei Länder steht im Gegensatz zu den wirtschaftlichen Erfolgen der gemäßigteren Linksregierungen und den transideologischen Wundern von Panama und der Dominikanischen Republik, über die wenig gesprochen wird, obwohl insbesondere letztere die am schnellsten wachsende lateinamerikanische Wirtschaft der letzten 50 Jahre ist. Hatte das Land in den 1960er Jahren mehr oder weniger das gleiche BIP wie Haiti, so ist es heute gleichauf mit Venezuela, bei nur einem Drittel an Einwohnern.
Zwischen tropischer Perestroika und militärischer Kontrolle
Trotz der Wirtschaftskrise, der sozialen Katastrophe und der Bemühungen der progressiven Präsidenten Brasiliens und Kolumbiens, Lula und Gustavo Petro, scheint Maduro nicht bereit zu sein, sich zu bewegen. Die Fähigkeit der internationalen Gemeinschaft, auf ihn einzuwirken, ist äußert begrenzt. Unter dem Druck der Lima-Gruppe und von Sanktionen der EU und der USA durchlief der Chavismus zwischen 2017 und 2019 eine Phase extremer diplomatischer Isolation. US-Präsident Donald Trump zog damals gar einen „chirurgischen Schlag“ gegen Venezuela in Erwägung, doch seine Militärberater überzeugten ihn, diesen nicht auszuführen. In diesem Moment, dem schlimmsten in der jüngeren Geschichte Venezuelas, als die Wirtschaft am Boden lag (es war die Zeit des Klopapier- und Zahnpastamangels) und die Ölproduktion auf einen historischen Tiefstand gesunken war (auf 400 000 Barrel pro Tag, verglichen mit drei Mio. auf dem Höhepunkt und 800 000 heute), hielt Maduro trotz allem durch: Er führte eine orthodoxe Anpassung durch, begann die Wirtschaft zu öffnen (in einer Art „tropischer Perestroika“, die bis heute andauert) und baute ein Netzwerk internationaler Verbündeter auf, das bis heute, erweitert und verbessert, fortbesteht: Neben Kuba und Nicaragua gehören dazu die Großmächte China, Russland und seit kurzem auch Indien sowie Mittelmächte wie der Iran und die Türkei, deren Lieferungen von Treibstoff, Ersatzteilen für die Ölindustrie und Lebensmitteln sich als entscheidend für die Bewältigung der Krise erwiesen haben.
Zugleich sind die Bolivarischen Nationalen Streitkräfte weiterhin loyal. Der erwartete und von der Opposition tausendfach angekündigte Bruch ist nie eingetreten. Das Militär ist nicht nur ein Verbündeter oder Unterstützer der Regierung, sondern ein fester Bestandteil des bolivarischen Systems. Es kontrolliert strategische Steuerungshebel – Häfen, Polizei, Flughäfen, die Erdöl- und Stahlindustrie sowie die Grenzen – und ist kapillar über den ganzen Staat verteilt. So ist es beispielsweise für die Versorgung des Einzelhandels mit Benzin zuständig, was von zentraler Bedeutung für das tägliche Überleben ist.
Auch die Wirtschaftsleistung hat sich verbessert. Die Dollarisierung hat zwar die Ungleichheit vertieft, aber eine Erholung der Wirtschaft ermöglicht (das BIP wird in diesem Jahr schätzungsweise um vier Prozent wachsen), Inseln des Hyperluxuskonsums geschaffen – vor dem Hintergrund himmelhoher Preise, die ein Essen in einem Restaurant in Caracas teurer machen als in Madrid oder Paris –, und einen Boom des Kleinunternehmertums ausgelöst. Dieser zeigt, dass Venezuela sich nicht fern der großen Trends des gegenwärtigen Kapitalismus bewegt, nach Ansicht einiger Analysten könnte er sogar die historische Rentierkultur des Landes verändern. Als Reaktion auf diesen jüngsten und begrenzten, aber dennoch konkreten Aufschwung, hat die Regierung ihre Beziehungen zur nationalen Unternehmerschaft – einschließlich ihrer wichtigsten Organisation, des Handels- und Industrieverbands Fedecámaras –, neu geordnet und ihr jüngst diverse Zugeständnisse gemacht, von der Abschaffung der Steuer auf große Finanztransaktionen bis hin zur stillen Reprivatisierung einiger Unternehmen.
Und auch das venezolanische Kapital hat ein Interesse daran, die in den letzten Jahren erreichte makroökonomische Stabilität und den sozialen Frieden aufrechtzuerhalten. Diese Erwartung deckt sich wiederum mit der eines großen Teils der Gesellschaft, der die beiden großen Zyklen sozialer Proteste in den Jahren 2014 und 2017 hautnah miterlebt hat, ebenso wie den Zusammenbruch der Wirtschaft, der mit den Stromausfällen das Eis in den Tiefkühltruhen schmelzen sah und der um die durch die Migration zerrütteten Familien weint. Trotz des Nachkriegsszenarios, das Venezuela heute bietet, deutet nichts darauf hin, dass die Regierung bereit wäre, ihre Macht abzugeben, nicht einmal durch den Zwang der Verhältnisse. Denn der Preis für einen Rücktritt der Regierung ist extrem hoch: Er würde sich nicht auf einen stillen Wechsel in die parlamentarische Opposition beschränken in der Erwartung, in ein paar Jahren wieder an die Macht zu kommen, sondern böte die düstere Aussicht auf Gefängnis oder Exil. So wie die Dinge derzeit liegen, ist das wahrscheinlichste Szenario eine Verlängerung des Status quo.
Übersetzung aus dem Spanischen: Anne Britt Arps.
[1] Hugo Chávez, der Namensgeber des Chavismus und venezolanischer Präsident von 1998 bis zu seinem Tod 2013, nannte seine Politik „bolivarisch“ und bezog sich damit auf den Helden des lateinamerikanischen Unabhängigkeitskrieges, Simón Bolívar.
[2] Vgl. dazu ausführlich: José Natanson, Venezuela. Ensayo sobre la descomposición, Buenos Aires 2024.
[3] Als „Sonderperiode“ bezeichnete die kubanische Regierung die schwere Wirtschaftskrise nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre.