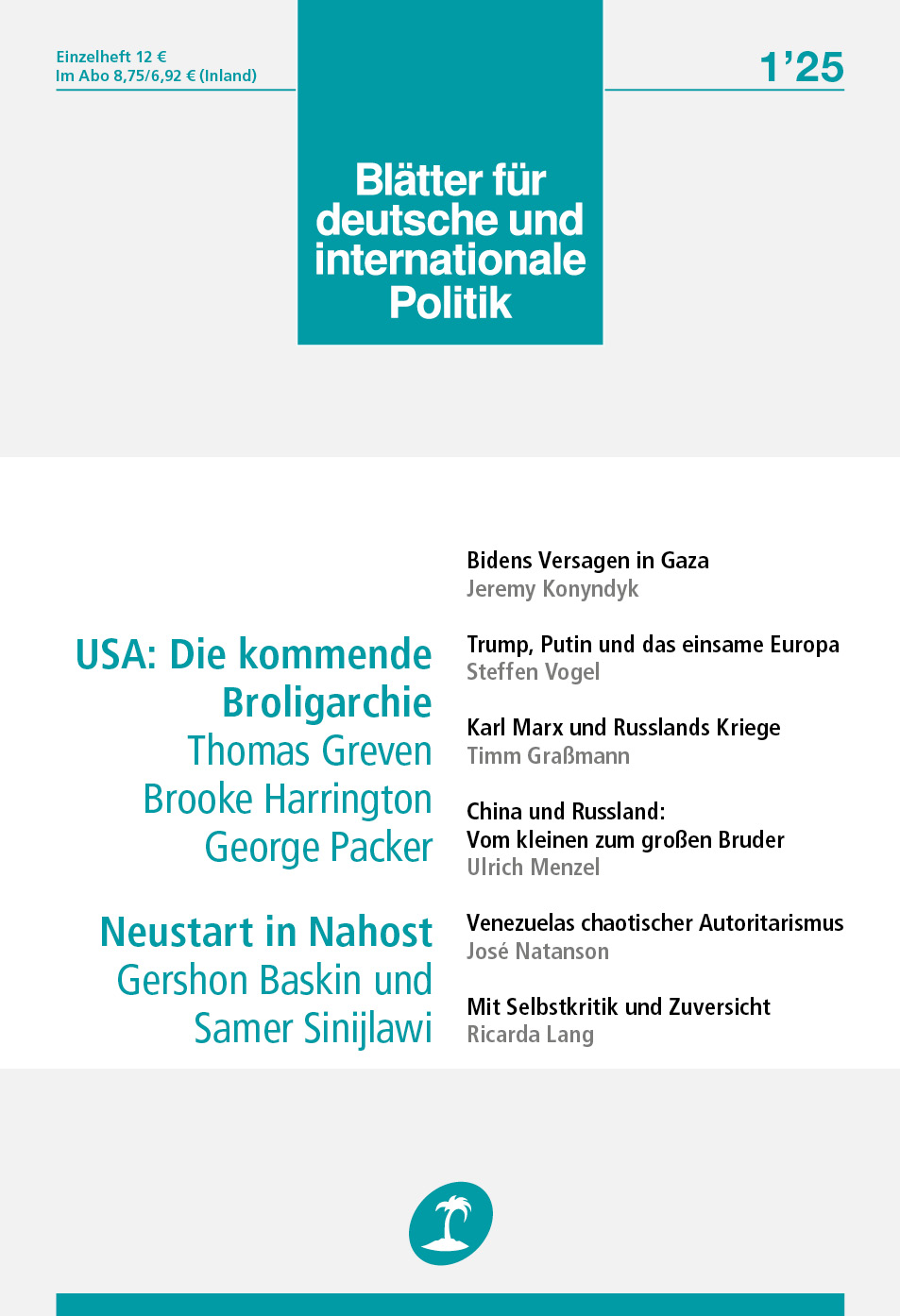Wie sich das Machtverhältnis zwischen China und Russland verkehrt hat

Bild: Wladimir Putin und Xi Jinping beim Empfang des 16. BRICS-Gipfels, 23.10.2024 ( IMAGO / Alexey Nikolskiy / Photohost agency brics-russia2024.ru Kazan Republic of Tatarstan Russia)
Wenige Tage vor der Winterolympiade 2022 in China reiste Wladimir Putin zu einem Gipfeltreffen mit Staatschef Xi Jingping nach Peking, um Rückendeckung für die geplante Invasion der Ukraine zu bekommen, die er nur drei Wochen später beginnen sollte. Am 4. Februar 2022 verkündeten Putin und Xi in einer gemeinsamen Erklärung die „grenzenlose Freundschaft“ ihrer beiden Länder in der Auseinandersetzung mit dem „absteigenden Westen“. Zu bieten hatte Putin nicht viel mehr, als das rohstoffhungrige China mit Energie und Rohstoffen zu beliefern, zu Konditionen weit unterhalb der Weltmarktpreise, und weiterhin als Transitland für die Neue Seidenstraße zur Verfügung zu stehen. Für China hingegen markierte diese Vereinbarung nur eine Zwischenetappe auf dem Weg ins Zentrum der Welt. Die Ankunft dort hatte Xi bereits auf dem 19. Parteitag für das Jahr 2049, pünktlich zum 100. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik (VR) China, angekündigt.
Die offiziellen Fotos, insbesondere die der drei Seidenstraßen-Gipfel 2017, 2019 und 2023, auf denen Putin als herausgehobener Ehrengast immer direkt rechts neben Xi steht, erinnern an das berühmte Foto, das Mao und Stalin anlässlich des 71. Geburtstags des Sowjetführers am 21. Dezember 1949 Seite an Seite neben anderen Größen der kommunistischen Weltbewegung zeigt. Auch damals handelte es sich um die Symbolik einer ebenbürtigen Partnerschaft zweier Staaten bei gleichzeitig höchst asymmetrischen Kräfte- und Abhängigkeitsverhältnissen – allerdings in umgekehrter Richtung.
Wie Putin 2023 nach Peking war Mao im Dezember 1949 als Bittsteller nach Moskau gereist. Bezeichnend ist der Umstand, dass zwischen dem ersten Treffen am 16. Dezember 1949 bis zur Verabschiedung des Vertrages am 4. Februar 1950 glatte zwei Monate verstrichen. Stalin hatte Mao drei Wochen lang in einer ungeheizten Datscha bei Moskau warten lassen, bis die Verhandlungen endlich in Gang kamen. Knackpunkte waren Stalins Forderung, die Innere Mongolei, die er sich bei den Jalta-Verhandlungen 1945 gesichert hatte, der Sowjetunion einzuverleiben und die Eisenbahn- und Bergbaurechte in der Mandschurei aus der Zarenzeit zu restaurieren. Trotz der Demütigung und ungleicher Abhängigkeitsverhältnisse hielt China in der Präambel seiner ersten Verfassung vom 20. September 1954 fest: „Unser Land hat unzerstörbare Freundschaftsbeziehungen mit der großen Union der Sozialistischen Volksrepubliken und den Ländern der Volksdemokratien hergestellt.“
Daran zeigt sich: Die Sowjetunion war am Ende der Stalin-Ära die unbestrittene Vormacht innerhalb des sozialistischen Lagers und China wirtschaftlich wie militärisch haushoch überlegen. China hingegen war bei seiner Gründung nach neun Jahren Krieg gegen Japan und anschließenden fünf Jahren Bürgerkrieg gegen die von den USA unterstützte Nationalchinesische Regierung der Guomindang (GMD) ein erschöpftes und zerstörtes Land mit vielen Millionen Kriegsopfern und einer Landwirtschaft, die das damals schon bevölkerungsreichste Land der Welt nur unzureichend ernähren konnte. Dieses Abhängigkeitsverhältnis Chinas zu Russland nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich heute zu einer Abhängigkeit Russlands von China verkehrt. Wie aber konnte es dazu kommen?
Die Übernahme des sowjetischen Industrialisierungsmodells
Als sich die Sowjetunion Anfang der 1930er Jahre aufgrund der trotz Weltwirtschaftskrise ausbleibenden Revolution in den Industrieländern unter der Parole „Aufbau des Sozialismus in einem Land“ mit der Aufgabe konfrontiert sah, ein Wirtschaftssystem mittels Verstaatlichung und zentraler Planung in Gang zu setzen, konzentrierte sie sich zunächst auf die Schwerindustrie zur Produktion von Investitionsgütern, um weitere Industrien aufbauen zu können. Die Herstellung von Konsumgütern für die städtische Bevölkerung wurde auf das Notwendigste beschränkt. Finanziert werden sollte die Industrialisierung durch die Überschüsse aus der Landwirtschaft.
In den 1950ern sah sich die VR China mit derselben Konstellation wie die Sowjetunion 1929 konfrontiert – allerdings in einer viel gravierenderen Ausprägung.[1] Das Industrialisierungsniveau Chinas war 1952 im Vergleich zur Sowjetunion 1928 wesentlich niedriger. Jeweils pro Kopf betrug das Bruttosozialprodukt der Sowjetunion etwa das Vier- bis Fünffache, die Stahlproduktion das Fünfzehnfache, die ländliche Bevölkerung pro Einheit kultivierten Bodens das Vierfache, um nur einige Kennziffern zu nennen. Der zweite Unterschied betraf die soziale Basis der Revolution. In Russland war die städtische Arbeiterschaft deren Trägerin, in China hingegen sollte es die verarmte bäuerliche Bevölkerung sein, seit dem von Mao durchgesetzten strategischen Schwenk auf der Zunyi-Tagung 1935. Erst nach einem 14-jährigen Krieg, zunächst gegen die japanischen Besatzer und später die GMD, konnten die Kommunisten in Peking und Shanghai die Macht übernehmen. Trotz dieser Unterschiede zur Sowjetunion übernahmen sie mit den Verträgen der 1950er Jahre das stalinistische Modell ganz im Sinne von Maos Losung von 1949: „Die kommunistische Partei der Sowjetunion ist unser Lehrer, wir müssen von ihr lernen.“
Obwohl die chinesische Landwirtschaft viel weniger überschussfähig war als die sowjetische, sollte sie die Basis liefern, um im Rahmen von zwei Fünfjahresplänen (1953-1962) einen schwerindustriellen Komplex nach sowjetischem Muster aus dem Boden zu stampfen. Dafür hatte allerdings erst Stalins Tod im März 1953 den Weg freigemacht. Denn dieser hatte die chinesische Industrialisierung verzögern wollen, womöglich schwanten ihm bereits die Konsequenzen. Erst sein Nachfolger Nikita Chruschtschow war wirklich bereit, sozialistische Bruderhilfe zu gewähren. Die Sowjetunion lieferte die Ausrüstung für 141 Großprojekte, entsandte etwa 10 800 Experten als Wirtschaftsplaner, Manager und Ingenieure, die ihre chinesischen Kollegen vor Ort anlernten. Finanziert wurden die Lieferungen anfänglich durch sowjetische Kredite, die in wachsendem Maße durch chinesische Agrarexporte abgegolten wurden. Aufgrund des amerikanischen Boykotts war der chinesische Außenhandel reiner Osthandel.
Chinas Bruch mit der Sowjetunion
Etwa 1955 zeigte sich, dass die Übernahme des sowjetischen Modells auch angesichts der Belastung durch den Koreakrieg (1950-1953), der 40 Prozent der chinesischen Staatsausgaben verschlang und das Land 200 000 Tote kostete, für China nicht zu verkraften war, zumal beides zulasten der ländlichen Bevölkerung und damit der sozialen Basis der Chinesischen Revolution ging. Die Vorbehalte des Mao-Flügels in der Partei bekamen Aufwind. Ein Indiz war die Teilnahme Chinas an der Bandung-Konferenz 1955 als einzigem Vertreter des sozialistischen Lagers. Bandung gilt als Auftakt der Bewegung der Blockfreien Staaten als neutralem Pol zwischen USA und Sowjetunion. China signalisierte dort eine Führungsrolle für die Länder der „Dritten Welt“, die seit der Volkskommunen-Bewegung 1958 durch ein eigenständiges Entwicklungsmodell unterfüttert wurde, das den Ausgangsbedingungen der Entwicklungsländer eher entsprach als das sowjetische. Statt vorrangiger Schwerindustrialisierung ging es seitdem um die Entwicklung des ländlichen Raums im Zuge einer dezentralen genossenschaftlichen Agroindustrialisierung. Massenhafte Arbeitseinsätze zur Terrassierung von Hügeln und Aushebung von Bewässerungskanälen und nicht importierte Investitionsgüter sollten mangelndes Kapital ersetzen. Mao und nicht Chruschtschow sollte die revolutionäre Führung in der „Dritten Welt“ übernehmen.
Der Konflikt eskalierte 1959 beim Staatsbesuch Chruschtschows in Peking. Im folgenden Jahr zog Moskau über Nacht sämtliche sowjetischen Experten ab, stellte die zugesagten Lieferungen von Ausrüstungsgütern und den sonstigen Technologietransfer ein. Das führte in China zu zahlreichen Investitionsruinen, die nur mit großer Verzögerung oder nie fertiggestellt wurden. Peking verfolgte seitdem gezwungenermaßen unter der Losung „unabhängig und im Vertrauen auf die eigene Kraft“ einen Autarkiekurs.
1964 zündete China seine erste Atombombe, die Sowjetunion stationierte Truppen an der gemeinsamen Grenze und China baute tiefe Tunnel im Pekinger Untergrund. Ohne die katastrophalen Konsequenzen des „Großen Sprungs nach vorn“ von 1958 bis 1960 oder der „Kulturrevolution“ von 1966 bis 1969 leugnen zu wollen, in deren Verlauf die Mao-Fraktion sich gegenüber dem moderaten Flügel um Liu Shaoqi und Deng Xiaoping endgültig durchsetzte, verfolgte China doch in der Mao-Ära bis zu dessen Tod 1976 ein eher gleichgewichtiges Wachstum, bei dem die Landwirtschaft und die Leichtindustrie gegenüber der Schwerindustrie nicht zu kurz kamen.
Der wirtschaftliche Aufstieg Chinas und der Zerfall der Sowjetunion
Die Wende Chinas erfolgte auf dem berühmten 3. Plenum des 11. Zentralkomitees 1978. Nach einem bizarren innerparteilichen Linienkampf gegen die von der „Viererbande“ angeführte Mao-Fraktion kehrte Deng Xiaoping ins Zentrum der Macht zurück. Seitdem standen die Öffnung des Landes nach Westen und Wirtschaftsreformen auf der Agenda. Das 3. Plenum bildete den Auftakt eines welthistorisch beispiellosen exportgetriebenen Wirtschaftswachstums mit zehnprozentigen Wachstumsraten über vier Jahrzehnte. Das war allerdings nur möglich, weil der Autarkiekurs der Mao-Ära dafür die Grundlage gelegt hatte.
Während sich die Sowjetunion seit den 1970er Jahren in Richtung einer Rohstoffexportökonomie bewegte – man denke nur an das erste Erdgasröhrengeschäft mit der Bundesrepublik –, begann Chinas Exportoffensive entsprechend dem Theorem der komparativen Kosten in den arbeitsintensiven Branchen der Konsumgüterindustrie. Wieder sollte Kapital durch Arbeit ersetzt werden, um die Container für den Export mit Textilien und Produkten der Montageindustrie zu füllen. Statt auf sowjetische setzte China seitdem auf westliche Technik, die durch Direktinvestitionen ins Land geholt wurde, und arbeitete sich Schritt für Schritt in immer anspruchsvollere Branchen vor. Wie in den 1950er Jahren entsandte Peking massenhaft Studierende ins diesmal westliche Ausland, die bevorzugt in den als hart geltenden MINT-Fächern an Technischen Universitäten studierten. Nach der Rückkehr sollten sie in Führungspositionen eingesetzt werden. Auch wenn Peking privaten Unternehmern neben den dominanten Staatskonzernen einen breiten Spielraum einräumte, so verfolgte es den neuen Kurs doch unter strikter Ägide der Partei und behielt die aus der Sowjetunion übernommene Doppelstruktur bei: Neben jedem Manager oder Bürokraten stand ein Parteisekretär, der im Zweifelsfalle das letzte Wort hatte – auch in den Joint Ventures mit ausländischen Firmen.
Anders als in der Sowjetunion konnte in China der Zusammenbruch des Systems trotz des Pekinger Frühlings vermieden werden, weil die Partei sich der unbedingten Loyalität der Armee sicher sein konnte. Das zweitwichtigste Amt nach dem Generalsekretär ist der Vorsitz in der Militärkommission der Partei noch vor dem Amt des Staatspräsidenten. Mit dem Zerfall der Sowjetunion etablierte sich in den ehemaligen zentralasiatischen Sowjetrepubliken eine Kette von Pufferstaaten, die sich dem chinesischen Einfluss öffneten. Deren spätere Mitgliedschaft in der Shanghai Cooperation Organisation (SCO) und der Neuen Seidenstraßen-Initiative (NSI) stellt das unter Beweis. China konnte trotz der anfänglichen Proteste des Westens sein exportgetriebenes Wachstum fortsetzen, sein Beitritt zur Welthandelsorganisation (WTO) 2001 wirkte wie ein Brandbeschleuniger. Noch 1980 hatte das sowjetische Sozialprodukt das Fünffache des chinesischen betragen, heute beträgt das chinesische das Zehnfache des russischen – eine welthistorisch einzigartige Rochade zwischen zwei Großmächten.[2]
Chinas Logik des Profits, Russlands Logik der Rente
Die Sowjetunion zerfiel nach 1989/90 nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. In den chaotischen Jelzin-Jahren benötigte der Staat dringend Finanzmittel, die „erwirtschaftet“ wurden, indem man die Staatskonzerne zu Schnäppchenpreisen an die „Oligarchen“ verscherbelte. Russland exportiert seitdem Rüstungsgüter, Energie und Rohstoffe und importiert Konsumgüter, die unter westlichen Labels in China hergestellt werden. Die Verkehrung der Handelsbeziehungen aus den 1950er Jahren bahnte sich an. Am Ende der Jelzin-Ära war Russland strukturell zu einer Rohstoffexportökonomie herabgesunken, China hingegen am Ende der Ära Deng zu einer formidablen Wirtschaftsmacht aufgestiegen, die in immer neue Hochtechnologiesektoren vorstieß. 1991 hatte China die russische Wirtschaftsleistung absolut und 2018 auch pro Kopf übertroffen, obwohl die chinesische Bevölkerung das Zehnfache der russischen beträgt.
Seit 2012 erfolgte ein paralleler Aufstieg von Putin in Russland und Xi in China, der auch bezüglich der innenpolitischen Konsolidierung ihrer Macht und der Ausschaltung jeglicher Opposition Parallelen aufweist. Xi wurde 2012 Generalsekretär und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission der Partei und 2013 Staatspräsident. Die Demütigung seines neben ihm sitzenden Vorgängers Hu Jintao auf der Bühne des 20. Parteitags, als dieser gegen seinen Willen vor laufenden Kameras aus dem Saal eskortiert wurde, war die Demonstration absoluter Macht.
Putin kehrte nach dem Intermezzo als Ministerpräsident 2012 ins Amt des Staatspräsidenten zurück und setzte 2020 eine Verfassungsänderung durch, die ihn wie Xi auf Lebenszeit im Amt hält. Nur die wirtschaftliche Basis, auf die sich beider Aufstieg stützt, weist strukturelle Unterschiede auf, die erklären, warum Russland heute zu einem Vasallen Chinas herabgesunken ist, während China sich anschickt, die USA nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch herauszufordern. Make China great again[3] – so groß, wie es zuletzt vor etwa 600 Jahren auf dem Höhepunkt des Tributsystems während der Ming-Dynastie war.
Der strukturelle Unterschied resultiert aus der Logik des Profits gegenüber der Logik der Rente. Die Logik des Profits verlangt internationale Wettbewerbsfähigkeit. Diese gewinnt man durch Innovationen, Risikobereitschaft, neue Produkte und Verfahren und durch Investitionen, um die Produktivität zu steigern. Dieser Logik ist China seit der Ära Dengs trotz des Gewaltmonopols der Partei gefolgt. Heute besitzt es in einer breiten Palette von Branchen eine hohe Wettbewerbsfähigkeit und erobert einen Markt nach dem anderen. Je nach Berechnungsmethode hat es die USA seit etwa zehn Jahren wirtschaftlich ein- oder sogar überholt.
Militär statt wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit
In der Logik der Rente hingegen entstehen Einkommen aus der Kontrolle über einkommensträchtige Ressourcen. Im Mittelalter war das der Boden, den die Grundherren den Bauern zur Bearbeitung zur Verfügung stellten und dafür einen Teil der Ernte als Grundrente kassierten. Insofern sind Renten leistungslose Einkommen. Die Grundherren mussten nur Sorge tragen, die Kontrolle über den Boden zu behaupten und ggf. auszuweiten, um weitere Renten zu kassieren. Das Erzgebirge oder der Harz mit ihrem Silberbergbau sind frühe Beispiele einer Bergwerksrente. Der Grundherr bzw. Ritter musste lediglich einen Teil seiner Rente in Schildknappen „investieren“, um ggf. aufständische Bauern oder Bergleute in Schach zu halten.
Russland ist nach der Wende von 1989/1990 im Unterschied zu China der Logik der Rente gefolgt, da seine Industrie unter Weltmarktbedingungen nicht konkurrenzfähig war. Aus deren ehemaligen Managern wurden Oli-garchen. Wirtschaftlich interessant blieb nur der von ihnen kontrollierte Rohstoffsektor, dessen Erzeugnisse auf eine weltweite Nachfrage stießen. So mutierte die zu Sowjetzeiten breit aufgestellte Planwirtschaft, angeführt von den Riesen Gazprom und Rosneft, zu einer Rohstoffexportökonomie. Die Rüstungsindustrie wurde behauptet, indem sie neben Rohstoffen zur zweiten Komponente im russischen Exportwarenkorb avancierte, deren Produkte auf eine politisch bedingte Nachfrage stoßen. Steigende Weltmarktpreise führten wie in den Ländern am Persischen Golf zu steigenden Renten, die den exorbitanten Lebensstil der Oligarchen, vergleichbar dem der Ölscheichs, ermöglichen.
Erst Geschöpf und dann oberster Pate aller Oligarchen wurde Putin, der die Rentenökonomie politisch garantiert. Wer gegen ihn opponiert, selbst wenn er ein Oligarch ist, wird kaltgestellt. Daher muss ein Teil der Rente in die Organe des Staatsapparats aus Polizei, Armee, Geheimdiensten, Präsidentengarden, Leibwachen und sogar privaten Söldnern „investiert“ werden. Söldnerarmeen vom Schlage Wagner lassen sich auch außenpolitisch einsetzen und werden von afrikanischen oder arabischen Autokraten gerne engagiert, wenn sie ihrer eigenen Armee oder Präsidentengarde nicht mehr vertrauen. So werden sie sogar zu einem Instrument, die Rentenbasis über die Grenzen Russlands zu erweitern, da auch die genannten Autokraten sich an der Logik der Rente orientieren. Insofern wirkt auch die Logik der Rente wie die Logik des Profits als ein Schwungrad der Globalisierung.
Gas statt Öl, Piplines statt Häfen
Kein Zufall ist es, dass Russland, im Unterschied zu anderen klassischen Rentenstaaten wie denen am Persischen Golf, durch den Export von Rohstoffen nicht von einem internationalen Markt mit schwankenden Notierungen abhängig, sondern an langfristige Lieferverträge gebunden ist. Dies resultiert aus dem Aggregatzustand der exportierten Energieträger: Sie sind im Falle Russlands eher gasförmig und nicht wie bei Öl flüssig.[4] Erdöl wird per Leitung zu einem Ölterminal transportiert und von dort per Tanker zu den großen Ölimporthäfen in Westeuropa und Ostasien. In deren Raffinerien wird es zu Kraftstoffen oder petrochemischen Produkten verarbeitet, die per Binnenschiff oder Eisenbahn und zuletzt per Tankwagen zu den industriellen oder privaten Endverbrauchern, den Tankstellen und Heizungskellern gebracht werden. An jeder Zwischenstation kann es problemlos in großen oder kleinen Tanks bis zum Reservekanister im Kofferraum gelagert werden. Auf diese Weise entsteht ein globaler Ölmarkt mit unterschiedlichen Preisen für diverse Ölsorten, Herkunftsländer, Jahreszeiten und in Abhängigkeit von der Entfernung zu den Raffinerien, was sich z.B. an den täglich mehrfach wechselnden Preisnotierungen an den Tankstellen ablesen lässt.
Erdgas hingegen wird von der Förderstelle bis zum Endverbraucher durch eine Leitung gepumpt. Per Schiff lässt es sich nur mit großem Aufwand und zu hohen Kosten transportieren, wenn es zuvor vom gasförmigen in einen flüssigen Zustand versetzt worden ist, um am Flüssiggasterminal wieder rückverwandelt zu werden, bevor es in ein Leitungsnetz eingespeist werden kann. Lagern kann man es nur bedingt und sehr viel aufwendiger in großen unterirdischen Gasspeichern. Das erklärt, warum der Gashandel keinem internationalen Markt mit schwankenden Preisen ausgesetzt ist, sondern auf langfristigen Lieferverträgen beruht, deren Konditionen zudem politischen Erwägungen folgen können.
Auch der Transport von Öl und Gas ist auf den Routen unterschiedlichen Risiken ausgesetzt. Die Routen der Öltanker können durch Piraterie, Beschuss wie im Falle der Huthi an der Einfahrt ins Rote Meer, Sperrungen von Meerengen, etwa der Straße von Hormus, oder Havarien wie im Falle des Suezkanals blockiert werden. Die Reedereien können aber flexibel und unmittelbar darauf reagieren, indem sie ihre Tanker auf andere Routen umleiten und andere Ölterminals ansteuern. Das Netz der Gasleitungen, insbesondere wenn es grenzüberschreitenden Charakter hat, ist anderen Gefahren ausgesetzt. Ein Transitland, das Durchleitungsgebühren kassiert, kann den Hahn zudrehen, ein Sabotageakt wie im Fall von Nordstream 1 und 2 kann den Gastransport dauerhaft unterbrechen. Lieferanten und Kunden können darauf aber nur bedingt und mit großer Zeitverzögerung reagieren, weil nur mit großer Zeitverzögerung durch die Verflüssigung auf ein anderes Transportmedium oder auf andere Leitungen ausgewichen werden kann, die im Extremfall erst verlegt werden müssen, was Jahre oder Jahrzehnte in Anspruch nimmt.
Hinzu kommt ein restriktiver geophysikalischer Faktor. Russland ist zwar mit Abstand das flächenmäßig größte Land der Welt und verfügt über eine nahezu komplette Ausstattung mit natürlichen Ressourcen, aber im Unterschied zu anderen Rohstoffexportländern nur über beschränkten Zugang zur Hohen See. Die lange Polarküste Sibiriens ist vereist. Die Ausfahrt aus der Ostsee lässt sich von Dänemark in der Sundpassage sperren, die Ausfahrt aus dem Schwarzen Meer von der Türkei am Bosporus bzw. aus dem Mittelmeer von Großbritannien in Gibraltar. Die nicht ganzjährig nutzbare Passage aus dem Weißen Meer bedarf des Golfstroms entlang der norwegischen Küste und der russische Zugang zum Pazifik nicht nur der Anbindung durch die Transsibirische Eisenbahn, sondern auch der Ausfahrt aus dem Japanischen Meer durch die Meerenge zwischen Südkorea und Japan. Alle genannten Länder sind den USA über die Nato oder durch bilaterale Verträge verpflichtet. China hat demgegenüber eine lange Küste mit vielen eisfreien Häfen und freiem Zugang zum Indopazifik. Die USA sind geopolitisch eine große Insel mit drei Küsten am Atlantik, an der Karibik und am Pazifik, die von niemandem blockiert werden können.
Dies erklärt, warum Russland bevorzugt nicht nur Gas, sondern auch Öl nicht via Terminal, sondern via Pipeline aus dem europäischen wie aus dem asiatischen Teil des Landes exportiert. Erdölterminals, die durch die Leitungen ESPO I seit 2009/2011 bzw. ESPO II seit 2012 quer durch Sibirien angebunden sind, gibt es nur am Japanischen Meer und ganz im Osten am Ochotskischen Meer. Grenzüberschreitend nach China gibt es mit Sila Sibiri seit 2019 für Gas bzw. ESPO I für Öl jeweils nur eine Leitung. Besser lässt sich die langjährige und durch den Ukrainekrieg gefährdete wirtschaftliche Ausrichtung Richtung Europa kaum illustrieren. Diese Lieferwege umzukehren, würde nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte verlangen.
Die neue Abhängigkeit Russlands von China
Während Russland auch aufgrund seiner Rentenorientierung zu Beginn der Putin-Ära auf den Status einer zweitrangigen Macht herabgesunken war, befand sich China mit Amtsantritt von Xi in den Startlöchern, die Führungsposition der USA wirtschaftlich wie politisch herauszufordern. Lediglich Chinas militärische Basis für diese Herausforderung war selbst im Vergleich zu Russland noch sehr schmal, weil drei Komponenten nicht vorhanden waren: Stützpunkte im Ausland (möglichst weltweit), Trägerflotten zur Kontrolle der Weltmeere und auf U-Booten stationierte Interkontinentalraketen. Beim globalen Handel war China immer noch der Freerider der internationalen öffentlichen Güter, die die USA offerierten – etwa die Durchsetzung des Prinzips Freiheit der Meere oder mit GPS die Bereitstellung eines globalen Navigationssystems.
Solange China seinen globalen Anspruch militärisch nicht unterfüttern kann, will es die seit der Frühen Neuzeit bestehenden Land- und Seerouten nach Westeuropa wiederbeleben, indem es die notwendigen Investitionen in Eisenbahnen, Fernstraßen, Stromtrassen, Häfen, Logistikzentren der Anrainer durch Kredite finanziert und deren Bau übernimmt. Auch sorgt es für den institutionellen Überbau aus Verträgen, Zahlungsmitteln, Konnektivität im technischen Sinne und Sicherheit auf den Routen. Hierbei kommt Russland als Transitland auf den Landrouten ins Spiel, weil es mit der Trasse der Transsibirischen Eisenbahn eine, wenn auch modernisierungsbedürftige, durchgehende Verbindung von Nordost-China bis Moskau mit Anschluss an das westeuropäische Eisenbahnnetz bietet.
Die militärische Absicherung der Seidenstraße
Bis die Verkehrswege der Neuen Seidenstraße auf der kürzesten Route vom Westen Chinas durch die ehemaligen zentralasiatischen Sowjetrepubliken, den Iran und die Türkei nach Europa die Transsib entlasten oder ersetzen können, werden noch Jahre vergehen. Die kürzeste Seeverbindung auf der maritimen Seidenstraße von den südchinesischen Häfen durch das Südchinesische Meer, die Straße von Malakka, via Sri Lanka quer durch das Arabische Meer zur ostafrikanischen Küste und von dort via Rotem Meer und Suezkanal nach Piräus ist vorhanden, bedarf aber des Ausbaus der Häfen und der militärischen Absicherung.
Auch auf diesem Feld ist China aktiv. Eine erste Marinebasis in Djibouti gibt es bereits, ein überdimensionierter Flugplatz auf einer der Malediven-Inseln ist gebaut, der sich auch als Luftdrehkreuz nutzen lässt und erklärt, warum die dortige Regierung sich dem indischen Einfluss entzogen hat, die Häfen von Piräus (ganz) und Venedig (teilweise) wurden gekauft. Auch die Verlängerung des Transportkorridors per Eisenbahn durch den Ausbau der Trasse zwischen Belgrad und Budapest ist im Gange, eine Erklärung dafür, warum Viktor Orbán auf dem ersten Seidenstraßen-Gipfel präsent war. Falls die Suez-Passage blockiert ist, kann die „Perlenkette“ der mit chinesischer Hilfe ausgebauten Häfen rund um Afrika genutzt werden. Eine erste Militärbasis auf der Landroute wurde in Tadschikistan errichtet.
Damit deutet sich in groben Umrissen an, welche Länder künftig formell oder informell dem chinesischen Lager zuzurechnen sind – die Anrainer auf den Routen der Neuen Seidenstraße. Das Abstimmungsverhalten in der UN-Vollversammlung bei den beiden Ukraine-Resolutionen ist dafür ein guter Indikator. Gemeint sind die Länder, die sich der Stimme enthalten haben oder der Abstimmung ganz ferngeblieben sind. Nur am Rande sei bemerkt, dass Indien, bei der alten Seidenstraße wichtiges Bindeglied oder Endpunkt, ausgespart, ja sogar regelrecht umgangen wird, weil Indien nicht als Partner, sondern als künftiger Konkurrent Chinas betrachtet wird.
Xis Ziel, wie auf dem 19. Parteitag angekündigt, bis 2049 wieder wie vor 600 Jahren ins Zentrum der Welt zurückgekehrt zu sein, verfolgt Peking demnach gezielt strategisch und mehrdimensional. Putins Ziel, die Herabstufung seines Landes seit Ende des Ost-West-Konflikts zu revidieren nicht durch die Restauration der Sowjetunion, sondern des zaristischen Imperiums, wirkt demgegenüber fast schon dilettantisch. Es ist anders als bei China wirtschaftlich nicht fundiert und widerspricht zudem in fundamentaler Weise der skizzierten Rentenlogik und den geopolitischen Rahmenbedingungen.
Der Krieg in der Ukraine zementiert den Rollentausch
Bevor Putin die mit seinem Traktat vom 12. Juli 2021 „On the Historical Unity of Russians and Ukrainians“[5] legitimierte „militärische Spezialoperation“ – nämlich die Invasion der Ukraine am 24. Februar 2022 – in die Tat umsetzte, versicherte er sich der chinesischen Rückendeckung und bot im Gegenzug neue Öl- und Gasverträge an sowie den Bau der Gaspipeline Power of Sibiria 2, die 55 Mrd. US-Dollar kosten soll. Hier lässt Xi seinen Freund Putin aber noch zappeln, will sich nicht an den Kosten beteiligen und verlangt hohe Preisrabatte.
Was Putin nicht berücksichtigt hat, war der Widerstandswille der Ukraine und vor allem die, wenn auch erst nur zögerlich und schrittweise, westliche Unterstützung, gepaart mit Sanktionen gegen Moskau. Wirtschaftlich ist Putin in eine fatale Situation geraten, weil die Logik der Rente den reibungslosen Absatz der russischen Rohstoffe voraussetzt. Die Sprengung der beiden Ostsee-Pipelines hat sein Dilemma auf den Punkt gebracht: Wenn er einlenkt, muss er seinen Anspruch auf die Restauration des Zarenreichs aufgeben und verliert womöglich die Unterstützung der Bevölkerung. Wenn er nicht einlenkt, schwinden die Renteneinkünfte der Oligarchen weiter und damit auch die Ressourcen zur Fortsetzung des Krieges. Die russische Armee in der Ukraine kann nicht warten, bis neue Leitungen von Westsibirien nach Ost- und Südasien gebaut sind, um neue Einkünfte zu generieren.
China kommt insofern doppelt ins Spiel, als es in der Lage ist, die ausbleibenden westlichen Konsum- und Investitionsgüter zu liefern, und sicher auch bereit ist, mehr russisches Gas und Öl abzunehmen, soweit das logistisch darstellbar ist – allerdings zu Preisen weit unter dem Weltmarktniveau. Insofern ist China sogar ein Nutznießer der gesprengten Nordstream-Pipelines. Bei Waffenlieferungen zeigt sich China bislang sehr zurückhaltend aus Rücksichtnahme auf die ungleich wichtigeren westlichen Absatzmärkte, die der russische Markt nicht kompensieren kann. Dass Russland zweitklassige Drohnen aus dem Iran und Munition aus Nordkorea aus Sowjetzeiten importiert, unterstreicht, dass China nicht einspringen will. Denkbar ist allenfalls, dass es Dual-Use-Güter liefert und als Drittstaat zur Umgehung der Boykotte fungiert. Die Statusumkehr zeigt beispielhaft der Einsatz nordkoreanischer Hilfstruppen. Im Koreakrieg kämpften chinesische „Freiwillige“ auf nordkoreanischer Seite mit russischen Waffen im Interesse der Sowjetunion. Im Ukrainekrieg kämpfen jetzt Nordkoreaner mit eigenen Waffen im russischen Interesse.
Ein Blick auf den bilateralen Handel vermittelt ein komplett konträres Bild gegenüber den 1950er Jahren. Russland ist nun die Peripherie, die Rohstoffe nach China liefert, zu Konditionen deutlich unter den Weltmarktpreisen, und importiert im Gegenzug Fertigwaren – das klassische Muster der Zentrum-Peripherie-Beziehungen aus der Dependenztheorie. Die Preisrelationen erinnern zudem an die Theorie des ungleichen Tauschs, mit dem seinerzeit die Ausbeutung der Dritten Welt erklärt wurde. China zahlt teilweise nur mit politischer Münze im Sinne von Rückendeckung und Nichtverurteilung, obwohl die Invasion der Ukraine gegen das fundamentale chinesische Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes verstößt.
Auf jeden Fall hat Putins Krieg wie ein Brandbeschleuniger zur Herausbildung einer neuen globalen Konstellation gewirkt. In deren Zentrum steht der Hegemonialkonflikt zwischen der alten absteigenden Ordnungsmacht USA und der neuen aufsteigenden Ordnungsmacht China, zugleich die Anführer eines liberalen und eines autoritären Lagers. Auch wenn diese Etiketten mit der erneuten Präsidentschaft Trumps infrage gestellt scheinen, so hat dessen Losung „Make America Great Again“ doch im Kern eine antichinesische Stoßrichtung und verlangt zu deren Flankierung die substantielle Lastenteilung mit Europa. Die Rhetorik von Joe Biden und Kamala Harris ist zwar moderater, zielte aber in dieselbe Richtung. Auch nach vier Jahren Trump 2.0 wird sich die strukturelle Konstellation für die USA nicht grundlegend geändert haben, werden sie der Anführer der liberalen Welt bleiben.
Es bleibt deshalb die Erkenntnis, dass der Ukrainekrieg wie der Koreakrieg in den 1950er Jahren in gewisser Weise ein Stellvertreterkrieg zwischen Ost und West ist, nur dass China und Russland die Rollen getauscht haben. Russland ist in indirekte Gegnerschaft zu den USA geraten, weil diese mit Abstand der größte Unterstützer der Ukraine sind, und zugleich in eine umfassende Abhängigkeit von China.
Die EU – mit Ausnahme des chinahörigen Ungarns – ist der zweite große Unterstützer und musste nolens volens die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland kappen. Sie ist angesichts der gestiegenen Energiekosten sogar doppelt betroffen. Im Interesse der Aufrechterhaltung eines liberalen Pols in der Weltordnung führt für Europa jedoch kein Weg daran vorbei, die Ukraine in ihrem Stellvertreterkrieg und so indirekt die USA in ihrem Hegemonialkonflikt mit China zu unterstützen. Sonst droht der Beginn des autoritären Jahrhunderts.[6]
[1] Vgl. dazu Ulrich Menzel, Theorie und Praxis des chinesischen Entwicklungsmodells. Ein Beitrag zum Konzept autozentrierter Entwicklung, Opladen 1978, hier S. 245-291.
[2] Daten bei Alexander Libman, Negative Konvergenz. Autoritarismus in China und Russland, in: „Osteuropa“, 7-9/2023, S. 161-176.
[3] Heike Holbig, Making China Great Again. Xi Jinpings Abschied von der Reformära, in: „GIGA Focus Asien“, 2/2018.
[4] Dazu Morena Skalamera, Schmierstoff der Beziehung. Russlands Energie für China, in: „Osteuropa“, 7-9/2023, S. 275-286.
[5] Auf der Internetseite der Regierung unter kremlin.ru/events/president/news/66181.
[6] Ulrich Menzel, Wendepunkte. Am Übergang zum autoritären Jahrhundert, Berlin 2023.